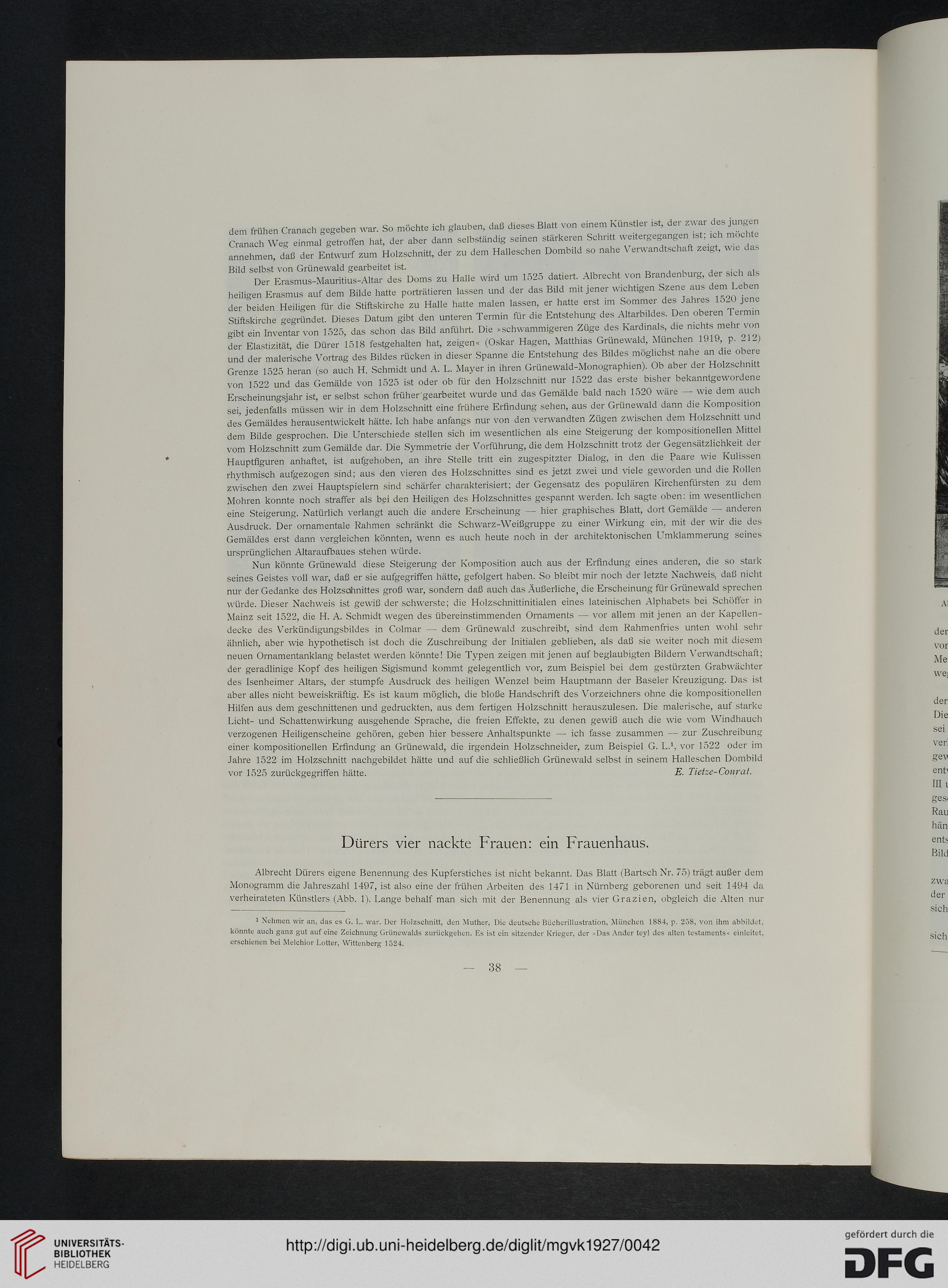dem frühen Cranach gegeben war. So möchte ich glauben, daß dieses Blatt von einem Künstler ist, der zwar des jungen
danach Weg einmal getroffen hat, der aber dann selbständig seinen stärkeren Schritt weitergegangen ist; ich möchte
annehmen, daß der Entwurf zum Holzschnitt, der zu dem Halleschen Dombild so nahe Verwandtschaft zeigt, wie das
Bild selbst von Grünewald gearbeitet ist.
Der Erasmus-Mauritius-Altar des Doms zu Halle wird um 1525 datiert. Albrecht von Brandenburg, der sich als
heiligen Erasmus auf dem Bilde hatte porträtieren lassen und der das Bild mit jener wichtigen Szene aus dem Leben
der beiden Heiligen für die Stiftskirche zu Halle hatte malen lassen, er hatte erst im Sommer des Jahres 1520 jene
Stiftskirche gegründet. Dieses Datum gibt den unteren Termin für die Entstehung des Altarbildes. Den oberen Termin
gibt ein Inventar von 1525, das schon das Bild anführt. Die »schwammigeren Züge des Kardinals, die nichts mehr von
der Elastizität, die Dürer 1518 festgehalten hat, zeigen« (Oskar Hagen, Matthias Grünewald, München 1919, p. 212)
und der malerische Vortrag des Bildes rücken in dieser Spanne die Entstehung des Bildes möglichst nahe an die obere
Grenze 1525 heran (so auch H. Schmidt und A. L. Mayer in ihren Grünewald-Monographien). Ob aber der Holzschnitt
von 1522 und das Gemälde von 1525 ist oder ob für den Holzschnitt nur 1522 das erste bisher bekanntgewordene
Erscheinungsjahr ist, er selbst schon früher'gearbeitet wurde und das Gemälde bald nach 1520 wäre — wie dem auch
sei, jedenfalls müssen wir in dem Holzschnitt eine frühere Erfindung sehen, aus der Grünewald dann die Komposition
des Gemäldes herausentwickelt hätte. Ich habe anfangs nur von den verwandten Zügen zwischen dem Holzschnitt und
dem Bilde gesprochen. Die Unterschiede stellen sich im wesentlichen als eine Steigerung der kompositioneilen Mittel
vom Holzschnitt zum Gemälde dar. Die Symmetrie der Vorführung, die dem Holzschnitt trotz der Gegensätzlichkeit der
Hauptfiguren anhaftet, ist aufgehoben, an ihre Stelle tritt ein zugespitzter Dialog, in den die Paare wie Kulissen
rhythmisch aufgezogen sind; aus den vieren des Holzschnittes sind es jetzt zwei und viele geworden und die Rollen
zwischen den zwei Hauptspielern sind schärfer charakterisiert; der Gegensatz des populären Kirchenfürsten zu dem
Mohren konnte noch straffer als bei den Heiligen des Holzschnittes gespannt werden. Ich sagte oben: im wesentlichen
eine Steigerung. Natürlich verlangt auch die andere Erscheinung — hier graphisches Blatt, dort Gemälde — anderen
Ausdruck. Der ornamentale Rahmen schränkt die Schwarz-Weißgruppe zu einer Wirkung ein, mit der wir die des
Gemäldes erst dann vergleichen könnten, wenn es auch heute noch in der architektonischen Umklammerung seines
ursprünglichen Altaraufbaues stehen würde.
Nun könnte Grünewald diese Steigerung der Komposition auch aus der Erfindung eines anderen, die so stark
seines Geistes voll war, daß er sie aufgegriffen hätte, gefolgert haben. So bleibt mir noch der letzte Nachweis, daß nicht
nur der Gedanke des Holzschnittes groß war, sondern daß auch das Äußerliche, die Erscheinung für Grünewald sprechen
würde. Dieser Nachweis ist gewiß der schwerste; die Holzschnittinitialen eines lateinischen Alphabets bei Schöffer in
Mainz seit 1522, die H. A. Schmidt wegen des übereinstimmenden Ornaments — vor allem mit jenen an der Kapellen-
decke des Verkündigungsbildes in Colmar — dem Grünewald zuschreibt, sind dem Rahmenfries unten wohl sehr
ähnlich, aber wie hypothetisch ist doch die Zuschreibung der Initialen geblieben, als daß sie weiter noch mit diesem
neuen Ornamentanklang belastet werden könnte! Die Typen zeigen mit jenen auf beglaubigten Bildern Verwandtschaft;
der geradlinige Kopf des heiligen Sigismund kommt gelegentlich vor, zum Beispiel bei dem gestürzten Grabwächter
des Isenheimer Altars, der stumpfe Ausdruck des heiligen Wenzel beim Hauptmann der Baseler Kreuzigung. Das ist
aber alles nicht beweiskräftig. Es ist kaum möglich, die bloße Handschrift des Vorzeichners ohne die kompositioneilen
Hilfen aus dem geschnittenen und gedruckten, aus dem fertigen Holzschnitt herauszulesen. Die malerische, auf starke
Licht- und Schattenwirkung ausgehende Sprache, die freien Effekte, zu denen gewiß auch die wie vom Windhauch
verzogenen Heiligenscheine gehören, geben hier bessere Anhaltspunkte — ich fasse zusammen — zur Zuschreibung
einer kompositionellen Erfindung an Grünewald, die irgendein Holzschneider, zum Beispiel G. L.\ vor 1522 oder im
Jahre 1522 im Holzschnitt nachgebildet hätte und auf die schließlich Grünewald selbst in seinem Halleschen Dombild
vor 1525 zurückgegriffen hätte. E. Tietze-Conrat.
Dürers vier nackte Frauen: ein Frauenhaus.
Albrecht Dürers eigene Benennung des Kupferstiches ist nicht bekannt. Das Blatt (Bartsch Nr. 75) trägt außer dem
Monogramm die Jahreszahl 1497, ist also eine der frühen Arbeiten des 1471 in Nürnberg geborenen und seit 1494 da
verheirateten Künstlers (Abb. 1). Lange behalf man sich mit der Benennung als vier Grazien, obgleich die Alten nur
1 Nehmen wir an, das es G. L. war. Der Holzschnitt, den Muther. Die deutsche Bücherillustration, München 1884, p. 238, von ihm abbildet,
konnte auch ganz gut auf eine Zeichnung Grünewalds zurückgehen. Es ist ein sitzender Krieger, der »Das Ander teyl des alten testaments« einleitet
erschienen bei Melchior Lotter, Wittenberg 1524.
— 38 —
danach Weg einmal getroffen hat, der aber dann selbständig seinen stärkeren Schritt weitergegangen ist; ich möchte
annehmen, daß der Entwurf zum Holzschnitt, der zu dem Halleschen Dombild so nahe Verwandtschaft zeigt, wie das
Bild selbst von Grünewald gearbeitet ist.
Der Erasmus-Mauritius-Altar des Doms zu Halle wird um 1525 datiert. Albrecht von Brandenburg, der sich als
heiligen Erasmus auf dem Bilde hatte porträtieren lassen und der das Bild mit jener wichtigen Szene aus dem Leben
der beiden Heiligen für die Stiftskirche zu Halle hatte malen lassen, er hatte erst im Sommer des Jahres 1520 jene
Stiftskirche gegründet. Dieses Datum gibt den unteren Termin für die Entstehung des Altarbildes. Den oberen Termin
gibt ein Inventar von 1525, das schon das Bild anführt. Die »schwammigeren Züge des Kardinals, die nichts mehr von
der Elastizität, die Dürer 1518 festgehalten hat, zeigen« (Oskar Hagen, Matthias Grünewald, München 1919, p. 212)
und der malerische Vortrag des Bildes rücken in dieser Spanne die Entstehung des Bildes möglichst nahe an die obere
Grenze 1525 heran (so auch H. Schmidt und A. L. Mayer in ihren Grünewald-Monographien). Ob aber der Holzschnitt
von 1522 und das Gemälde von 1525 ist oder ob für den Holzschnitt nur 1522 das erste bisher bekanntgewordene
Erscheinungsjahr ist, er selbst schon früher'gearbeitet wurde und das Gemälde bald nach 1520 wäre — wie dem auch
sei, jedenfalls müssen wir in dem Holzschnitt eine frühere Erfindung sehen, aus der Grünewald dann die Komposition
des Gemäldes herausentwickelt hätte. Ich habe anfangs nur von den verwandten Zügen zwischen dem Holzschnitt und
dem Bilde gesprochen. Die Unterschiede stellen sich im wesentlichen als eine Steigerung der kompositioneilen Mittel
vom Holzschnitt zum Gemälde dar. Die Symmetrie der Vorführung, die dem Holzschnitt trotz der Gegensätzlichkeit der
Hauptfiguren anhaftet, ist aufgehoben, an ihre Stelle tritt ein zugespitzter Dialog, in den die Paare wie Kulissen
rhythmisch aufgezogen sind; aus den vieren des Holzschnittes sind es jetzt zwei und viele geworden und die Rollen
zwischen den zwei Hauptspielern sind schärfer charakterisiert; der Gegensatz des populären Kirchenfürsten zu dem
Mohren konnte noch straffer als bei den Heiligen des Holzschnittes gespannt werden. Ich sagte oben: im wesentlichen
eine Steigerung. Natürlich verlangt auch die andere Erscheinung — hier graphisches Blatt, dort Gemälde — anderen
Ausdruck. Der ornamentale Rahmen schränkt die Schwarz-Weißgruppe zu einer Wirkung ein, mit der wir die des
Gemäldes erst dann vergleichen könnten, wenn es auch heute noch in der architektonischen Umklammerung seines
ursprünglichen Altaraufbaues stehen würde.
Nun könnte Grünewald diese Steigerung der Komposition auch aus der Erfindung eines anderen, die so stark
seines Geistes voll war, daß er sie aufgegriffen hätte, gefolgert haben. So bleibt mir noch der letzte Nachweis, daß nicht
nur der Gedanke des Holzschnittes groß war, sondern daß auch das Äußerliche, die Erscheinung für Grünewald sprechen
würde. Dieser Nachweis ist gewiß der schwerste; die Holzschnittinitialen eines lateinischen Alphabets bei Schöffer in
Mainz seit 1522, die H. A. Schmidt wegen des übereinstimmenden Ornaments — vor allem mit jenen an der Kapellen-
decke des Verkündigungsbildes in Colmar — dem Grünewald zuschreibt, sind dem Rahmenfries unten wohl sehr
ähnlich, aber wie hypothetisch ist doch die Zuschreibung der Initialen geblieben, als daß sie weiter noch mit diesem
neuen Ornamentanklang belastet werden könnte! Die Typen zeigen mit jenen auf beglaubigten Bildern Verwandtschaft;
der geradlinige Kopf des heiligen Sigismund kommt gelegentlich vor, zum Beispiel bei dem gestürzten Grabwächter
des Isenheimer Altars, der stumpfe Ausdruck des heiligen Wenzel beim Hauptmann der Baseler Kreuzigung. Das ist
aber alles nicht beweiskräftig. Es ist kaum möglich, die bloße Handschrift des Vorzeichners ohne die kompositioneilen
Hilfen aus dem geschnittenen und gedruckten, aus dem fertigen Holzschnitt herauszulesen. Die malerische, auf starke
Licht- und Schattenwirkung ausgehende Sprache, die freien Effekte, zu denen gewiß auch die wie vom Windhauch
verzogenen Heiligenscheine gehören, geben hier bessere Anhaltspunkte — ich fasse zusammen — zur Zuschreibung
einer kompositionellen Erfindung an Grünewald, die irgendein Holzschneider, zum Beispiel G. L.\ vor 1522 oder im
Jahre 1522 im Holzschnitt nachgebildet hätte und auf die schließlich Grünewald selbst in seinem Halleschen Dombild
vor 1525 zurückgegriffen hätte. E. Tietze-Conrat.
Dürers vier nackte Frauen: ein Frauenhaus.
Albrecht Dürers eigene Benennung des Kupferstiches ist nicht bekannt. Das Blatt (Bartsch Nr. 75) trägt außer dem
Monogramm die Jahreszahl 1497, ist also eine der frühen Arbeiten des 1471 in Nürnberg geborenen und seit 1494 da
verheirateten Künstlers (Abb. 1). Lange behalf man sich mit der Benennung als vier Grazien, obgleich die Alten nur
1 Nehmen wir an, das es G. L. war. Der Holzschnitt, den Muther. Die deutsche Bücherillustration, München 1884, p. 238, von ihm abbildet,
konnte auch ganz gut auf eine Zeichnung Grünewalds zurückgehen. Es ist ein sitzender Krieger, der »Das Ander teyl des alten testaments« einleitet
erschienen bei Melchior Lotter, Wittenberg 1524.
— 38 —