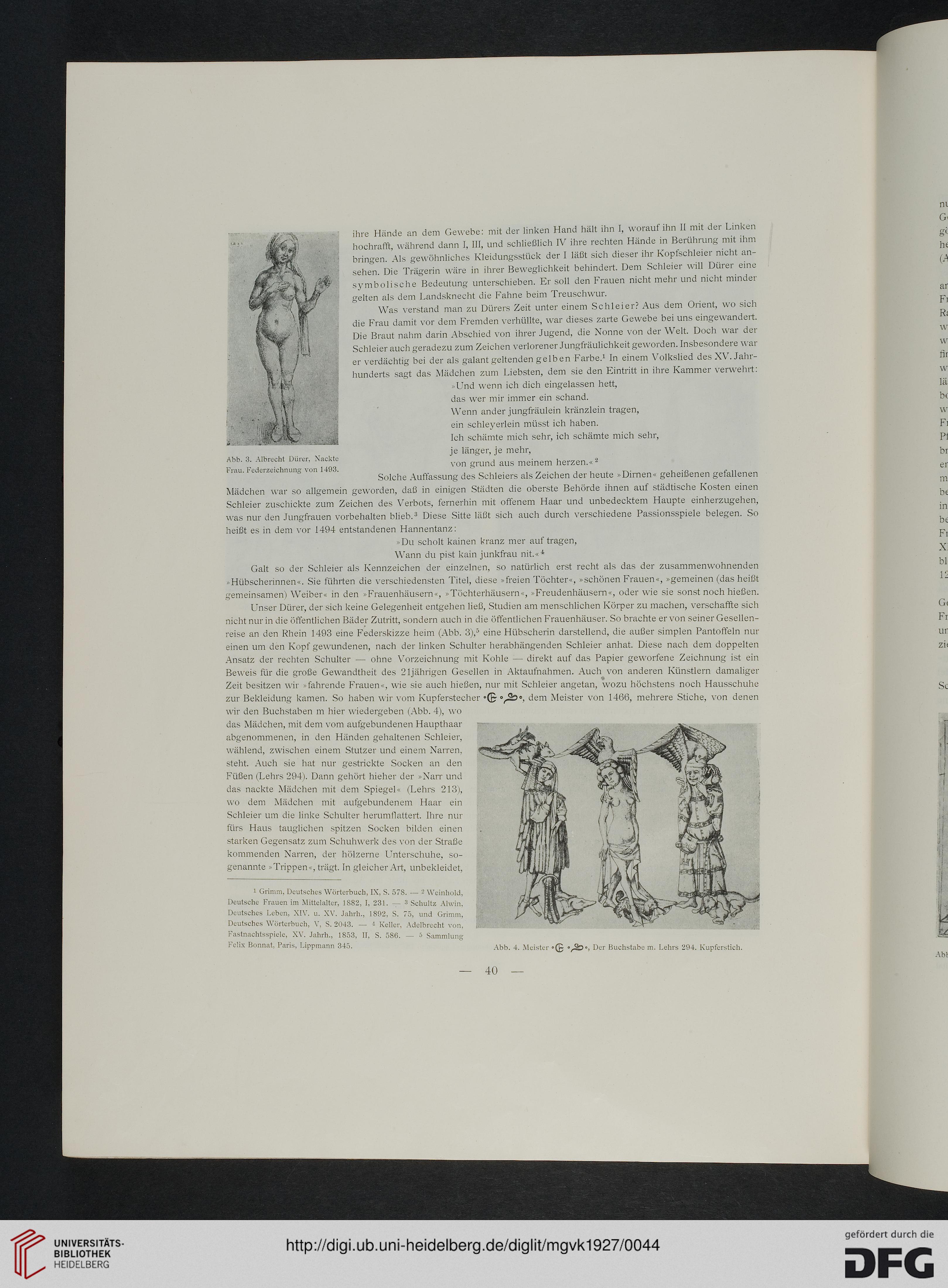Abb. 3. Albrecht Dl
Krau. Federzeichnun
Mädchen war so allgemein
ihre Hände an dem Gewebe: mit der linken Hand hält ihn I, worauf ihn II mit der Linken
hochrafft, während dann I, III, und schließlich IV ihre rechten Hände in Berührung mit ihm
bringen. Als gewöhnliches Kleidungsstück der I läßt sich dieser ihr Kopfschleier nicht an-
sehen. Die Trägerin wäre in ihrer Beweglichkeit behindert. Dem Schleier will Dürer eine
symbolische Bedeutung unterschieben. Er soll den Frauen nicht mehr und nicht minder
gelten als dem Landsknecht die Fahne beim Treuschwur.
Was verstand man zu Dürers Zeit unter einem Schleier? Aus dem Orient, wo sich
die Frau damit vor dem Fremden verhüllte, war dieses zarte Gewebe bei uns eingewandert.
Die Braut nahm darin Abschied von ihrer Jugend, die Nonne von der Welt. Doch war der
Schleier auch geradezu zum Zeichen verlorener Jungfräulichkeit geworden. Insbesondere war
er verdächtig bei der als galant geltenden gelben Farbe.1 In einem Volkslied des XV. Jahr-
hunderts sagt das Mädchen zum Liebsten, dem sie den Eintritt in ihre Kammer verwehrt:
»Und wenn ich dich eingelassen hett,
das wer mir immer ein schand.
Wenn ander jungfräulein kränzlein tragen,
ein schleyerlein müsst ich haben.
Ich schämte mich sehr, ich schämte mich sehr,
je länger, je mehr,
von grund aus meinem herzen.«'-
Solche Auffassung des Schleiers als Zeichen der heute »Dirnen« geheißenen gefallenen
geworden, daß in einigen Städten die oberste Behörde ihnen auf städtische Kosten einen
Schleier zuschickte zum Zeichen des Verbots, fernerhin mit offenem Haar und unbedecktem Haupte einherzugehen,
was nur den Jungfrauen vorbehalten blieb.3 Diese Sitte läßt sich auch durch verschiedene Passionsspiele belegen. So
heißt es in dem vor 1494 entstandenen Hannentanz:
Du scholt kainen kränz mer auf tragen,
Wann du pist kain junkfrau nit.«4
Galt so der Schleier als Kennzeichen der einzelnen, so natürlich erst recht als das der zusammenwohnenden
■Hübscherinnen«. Sie führten die verschiedensten Titel, diese »freien Töchter«, »schönen Frauen«, »gemeinen (das heißt
gemeinsamen) Weiber« in den »Frauenhäusern«, »Töchterhäusern«, »Freudenhäusern«, oder wie sie sonst noch hießen.
Unser Dürer, der sich keine Gelegenheit entgehen ließ, Studien am menschlichen Körper zu machen, verschaffte sich
nicht nur in die öffentlichen Bäder Zutritt, sondern auch in die öffentlichen Frauenhäuser. So brachte er von seiner Gesellen-
reise an den Rhein 1493 eine Federskizze heim (Abb. 3),5 eine Hübscherin darstellend, die außer simplen Pantoffeln nur
einen um den Kopf gewundenen, nach der linken Schulter herabhängenden Schleier anhat. Diese nach dem doppelten
Ansatz der rechten Schulter — ohne Vorzeichnung mit Kohle — direkt auf das Papier geworfene Zeichnung ist ein
Beweis für die große Gewandtheit des 21jährigen Gesellen in Aktaufnahmen. Auch von anderen Künstlern damaliger
Zeit besitzen wir »fahrende Frauen«, wie sie auch hießen, nur mit Schleier angetan, wozu höchstens noch Hausschuhe
zur Bekleidung kamen. So haben wir vom Kupferstecher °Q~ -^J', dem Meister von 1466, mehrere Stiche, von denen
wir den Buchstaben m hier wiedergeben (Abb. 4), wo
das Mädchen, mit dem vom aufgebundenen Haupthaar
abgenommenen, in den Händen gehaltenen Schleier,
wählend, zwischen einem Stutzer und einem Narren,
steht. Auch sie hat nur gestrickte Socken an den
Füßen (Lehrs 294). Dann gehört hieher der »Narr und
das nackte Mädchen mit dem Spiegel« (Lehrs 213),
wo dem Mädchen mit aufgebundenem Haar ein
Schleier um die linke Schulter herumflattert. Ihre nur
fürs Haus tauglichen spitzen Socken bilden einen
starken Gegensatz zum Schuhwerk des von der Straße
kommenden Narren, der hölzerne Unterschuhe, so-
genannte »Trippen«, trägt. In gleicher Art, unbekleidet,
1 Grimm, Deutsches Wörterbuch, IX, S. 578. — 2 Weinhold,
Deutsche Frauen im Mittelalter, 1882, I, 231. — 3 Schultz Alwin,
Deutsches Leben, XIV. u. XV. Jahrh., 1892, S. 75, und Grimm,
Deutsches Wörterbuch, V, S. 2043. — i Keller, Adelbrecht von,
Fastnachtsspiele, XV. Jahrh., 1853, It, S. 586. — 3 Sammlung
Felix Bonnat. Paris, Lippmann 345.
Abb. 4. Meister •(£ ',SS; Der Buchstabe m. Lehrs 294. Kupferstich.
— 40 —
Krau. Federzeichnun
Mädchen war so allgemein
ihre Hände an dem Gewebe: mit der linken Hand hält ihn I, worauf ihn II mit der Linken
hochrafft, während dann I, III, und schließlich IV ihre rechten Hände in Berührung mit ihm
bringen. Als gewöhnliches Kleidungsstück der I läßt sich dieser ihr Kopfschleier nicht an-
sehen. Die Trägerin wäre in ihrer Beweglichkeit behindert. Dem Schleier will Dürer eine
symbolische Bedeutung unterschieben. Er soll den Frauen nicht mehr und nicht minder
gelten als dem Landsknecht die Fahne beim Treuschwur.
Was verstand man zu Dürers Zeit unter einem Schleier? Aus dem Orient, wo sich
die Frau damit vor dem Fremden verhüllte, war dieses zarte Gewebe bei uns eingewandert.
Die Braut nahm darin Abschied von ihrer Jugend, die Nonne von der Welt. Doch war der
Schleier auch geradezu zum Zeichen verlorener Jungfräulichkeit geworden. Insbesondere war
er verdächtig bei der als galant geltenden gelben Farbe.1 In einem Volkslied des XV. Jahr-
hunderts sagt das Mädchen zum Liebsten, dem sie den Eintritt in ihre Kammer verwehrt:
»Und wenn ich dich eingelassen hett,
das wer mir immer ein schand.
Wenn ander jungfräulein kränzlein tragen,
ein schleyerlein müsst ich haben.
Ich schämte mich sehr, ich schämte mich sehr,
je länger, je mehr,
von grund aus meinem herzen.«'-
Solche Auffassung des Schleiers als Zeichen der heute »Dirnen« geheißenen gefallenen
geworden, daß in einigen Städten die oberste Behörde ihnen auf städtische Kosten einen
Schleier zuschickte zum Zeichen des Verbots, fernerhin mit offenem Haar und unbedecktem Haupte einherzugehen,
was nur den Jungfrauen vorbehalten blieb.3 Diese Sitte läßt sich auch durch verschiedene Passionsspiele belegen. So
heißt es in dem vor 1494 entstandenen Hannentanz:
Du scholt kainen kränz mer auf tragen,
Wann du pist kain junkfrau nit.«4
Galt so der Schleier als Kennzeichen der einzelnen, so natürlich erst recht als das der zusammenwohnenden
■Hübscherinnen«. Sie führten die verschiedensten Titel, diese »freien Töchter«, »schönen Frauen«, »gemeinen (das heißt
gemeinsamen) Weiber« in den »Frauenhäusern«, »Töchterhäusern«, »Freudenhäusern«, oder wie sie sonst noch hießen.
Unser Dürer, der sich keine Gelegenheit entgehen ließ, Studien am menschlichen Körper zu machen, verschaffte sich
nicht nur in die öffentlichen Bäder Zutritt, sondern auch in die öffentlichen Frauenhäuser. So brachte er von seiner Gesellen-
reise an den Rhein 1493 eine Federskizze heim (Abb. 3),5 eine Hübscherin darstellend, die außer simplen Pantoffeln nur
einen um den Kopf gewundenen, nach der linken Schulter herabhängenden Schleier anhat. Diese nach dem doppelten
Ansatz der rechten Schulter — ohne Vorzeichnung mit Kohle — direkt auf das Papier geworfene Zeichnung ist ein
Beweis für die große Gewandtheit des 21jährigen Gesellen in Aktaufnahmen. Auch von anderen Künstlern damaliger
Zeit besitzen wir »fahrende Frauen«, wie sie auch hießen, nur mit Schleier angetan, wozu höchstens noch Hausschuhe
zur Bekleidung kamen. So haben wir vom Kupferstecher °Q~ -^J', dem Meister von 1466, mehrere Stiche, von denen
wir den Buchstaben m hier wiedergeben (Abb. 4), wo
das Mädchen, mit dem vom aufgebundenen Haupthaar
abgenommenen, in den Händen gehaltenen Schleier,
wählend, zwischen einem Stutzer und einem Narren,
steht. Auch sie hat nur gestrickte Socken an den
Füßen (Lehrs 294). Dann gehört hieher der »Narr und
das nackte Mädchen mit dem Spiegel« (Lehrs 213),
wo dem Mädchen mit aufgebundenem Haar ein
Schleier um die linke Schulter herumflattert. Ihre nur
fürs Haus tauglichen spitzen Socken bilden einen
starken Gegensatz zum Schuhwerk des von der Straße
kommenden Narren, der hölzerne Unterschuhe, so-
genannte »Trippen«, trägt. In gleicher Art, unbekleidet,
1 Grimm, Deutsches Wörterbuch, IX, S. 578. — 2 Weinhold,
Deutsche Frauen im Mittelalter, 1882, I, 231. — 3 Schultz Alwin,
Deutsches Leben, XIV. u. XV. Jahrh., 1892, S. 75, und Grimm,
Deutsches Wörterbuch, V, S. 2043. — i Keller, Adelbrecht von,
Fastnachtsspiele, XV. Jahrh., 1853, It, S. 586. — 3 Sammlung
Felix Bonnat. Paris, Lippmann 345.
Abb. 4. Meister •(£ ',SS; Der Buchstabe m. Lehrs 294. Kupferstich.
— 40 —