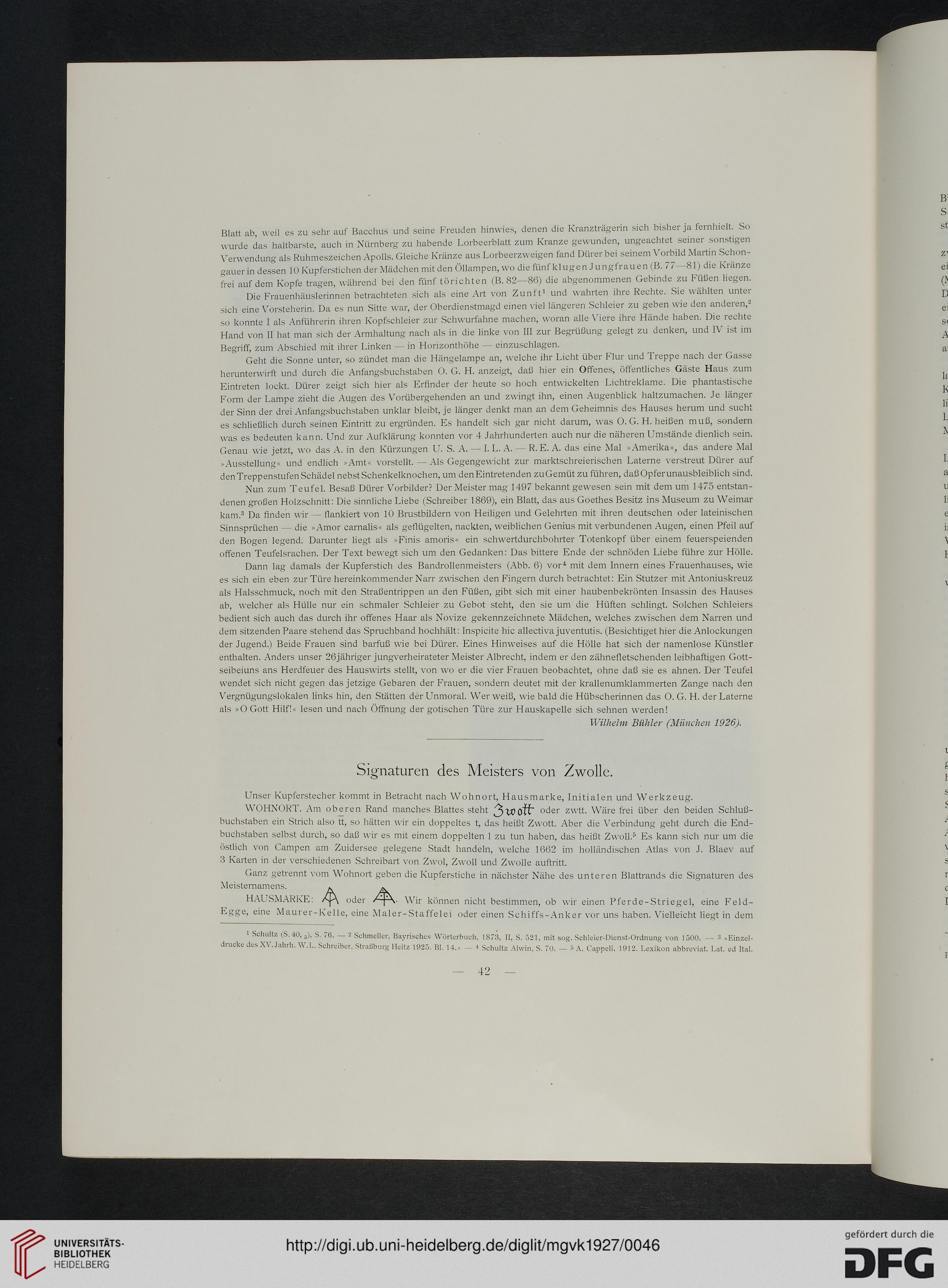Blatt ab, weil es zu sehr auf Bacchus und seine Freuden hinwies, denen die Kranzträgerin sich bisher ja fernhielt. So
wurde das haltbarste, auch in Nürnberg zu habende Lorbeerblatt zum Kranze gewunden, ungeachtet seiner sonstigen
Verwendung als Ruhmeszeichen Apolls. Gleiche Kränze aus Lorbeerzweigen fand Dürer bei .seinem Vorbild Martin Schi >n-
gauerin dessen 10 Kupferstichen der Mädchen mit den Öllampen, wo die fünf klugen Jungfrauen (B. 77—81) die Kränze
frei auf dem Kopfe tragen, während bei den fünf törichten (B. 82—86) die abgenommenen Gebinde zu Füßen liegen.
Die Frauenhäuslerinnen betrachteten sich als eine Art von Zunft1 und wahrten ihre Rechte. Sie wählten unter
sich eine Vorsteherin. Da es nun Sitte war, der Oberdienstmagd einen viel längeren Schleier zu geben wie den anderen,2
so konnte I als Anführerin ihren Kopfschleier zur Schwurfahne machen, woran alle Viere ihre Hände haben. Die rechte
Hand von II hat man sich der Armhaltung nach als in die linke von III zur Begrüßung gelegt zu denken, und IV ist im
Begriff, zum Abschied mit ihrer Linken — in Horizonthöhe — einzuschlagen.
Geht die Sonne unter, so zündet man die Hängelampe an, welche ihr Licht über Flur und Treppe nach der Gasse
herunterwirft und durch die Anfangsbuchstaben O. G. H. anzeigt, daß hier ein Offenes, öffentliches Gäste Haus zum
Eintreten lockt. Dürer zeigt sich hier als Erfinder der heute so hoch entwickelten Lichtreklame. Die phantastische
Form der Lampe zieht die Augen des Vorübergehenden an und zwingt ihn, einen Augenblick haltzumachen. Je länger
der Sinn der drei Anfangsbuchstaben unklar bleibt, je länger denkt man an dem Geheimnis des Hauses herum und sucht
es schließlich durch seinen Eintritt zu ergründen. Es handelt sich gar nicht darum, was O. G. H. heißen muß, sondern
was es bedeuten kann. Und zur Aufklärung konnten vor 4 Jahrhunderten auch nur die näheren Umstände dienlich sein.
Genau wie jetzt, wo das A. in den Kürzungen U. S. A. — I. L. A. — R. E. A. das eine Mal »Amerika«, das andere Mal
»Ausstellung« und endlich »Amt« vorstellt. — Als Gegengewicht zur marktschreierischen Laterne verstreut Dürer auf
den Treppenstufen Schädel nebst Schenkelknochen, um den Eintretenden zu Gemüt zu führen, daß Opfer unausbleiblich sind.
Xun zum Teufel. Besaß Dürer Vorbilder? Der Meister mag 1497 bekannt gewesen sein mit dem um 1475 entstan-
denen großen Holzschnitt: Die sinnliche Liebe (Schreiber 1869), ein Blatt, das aus Goethes Besitz ins Museum zu Weimar
kam.3 Da finden wir— flankiert von 10 Brustbildern von Heiligen und Gelehrten mit ihren deutschen oder lateinischen
Sinnsprüchen — die »Amor carnalis« als geflügelten, nackten, weiblichen Genius mit verbundenen Augen, einen Pfeil auf
den Bogen legend. Darunter liegt als »Finis amoris« ein schwertdurchbohrter Totenkopf über einem feuerspeienden
offenen Teufelsrachen. Der Text bewegt sich um den Gedanken: Das bittere Ende der schnöden Liebe führe zur Hölle.
Dann lag damals der Kupferstich des Bandrollenmeisters (Abb. 6) vor4 mit dem Innern eines Frauenhauses, wie
es sich ein eben zur Türe hereinkommender Narr zwischen den Fingern durch betrachtet: Ein Stutzer mit Antoniuskreuz
als Halsschmuck, noch mit den Straßentrippen an den Füßen, gibt sich mit einer haubenbekrönten Insassin des Hauses
ab, welcher als Hülle nur ein schmaler Schleier zu Gebot steht, den sie um die Hüften schlingt. Solchen Schleiers
bedient sich auch das durch ihr offenes Haar als Novize gekennzeichnete Mädchen, welches zwischen dem Narren und
dem sitzenden Paare stehend das Spruchband hochhält: Inspicite hic allectiva juventutis. (Besichtiget hier die Anlockungen
der Jugend.) Beide Frauen sind barfuß wie bei Dürer. Eines Hinweises auf die Hölle hat sich der namenlose Künstler
enthalten. Anders unser 26jähriger Jungverheirateter Meister Albrecht, indem er den zähnefletschenden leibhaftigen Gott-
seibeiuns ans Herdfeuer des Hauswirts stellt, von wo er die vier Frauen beobachtet, ohne daß sie es ahnen. Der Teufel
wendet sich nicht gegen das jetzige Gebaren der Frauen, sondern deutet mit der krallenumklammerten Zange nach den
Vergnügungslokalen links hin, den Stätten der Unmoral. Wer weiß, wie bald die Hübscherinnen das 0. G. H. der Laterne
als »OGott Hilf!« lesen und nach Öffnung der gotischen Türe zur Hauskapelle sich sehnen werden!
Wilhelm Bühler (München 1926).
Signaturen des Meisters von Zwolle.
Unser Kupferstecher kommt in Betracht nach Wohnort, Hausmarke, Initialen und Werkzeug.
WOHNORT. Am oberen Rand manches Blattes steht 3woff" oder zwtt. Wäre frei über den beiden Schluß-
buchstaben ein Strich also tt, so hätten wir ein doppeltes t, das heißt Zwott. Aber die Verbindung geht durch die End-
buchstaben selbst durch, so daß wir es mit einem doppelten 1 zu tun haben, das heißt Zwoll.5 Es kann sich nur um die
östlich von Campen am Zuidersee gelegene Stadt handeln, welche 1662 im holländischen Atlas von J. Blaev auf
3 Karten in der verschiedenen Schreibart von Zwol, Zwoll und Zwolle auftritt.
Ganz getrennt vom Wohnort geben die Kupferstiche in nächster Nähe des unteren Blattrands die Signaturen des
Meisternamens. . .
HAUSMARKE: oder AfV Wir können nicht bestimmen, ob wir einen Pferde-Striegel, eine Feld-
Egge, eine Maurer-Kelle, eine Maler-Staffelei oder einen Schiffs-Anker vor uns haben. Vielleicht liegt in dem
i Schultz (S. 40, a). S. 76. — 2 Schneller, Bayrisches Wörterbuch, 1873, II, S. 521, mit sog. Schleier-Dienst-Ordnung von 1500. — 3 .Einzel-
drucke des X\ .Jahrh. W.L. Schreiber, Straßburg Heitz 1925. Bl. 14.. - •. Schultz Alwin, S. 70. - 5 A. Cappeli, 1912. Lexikon abbreviat. Lat. ed Ital.
42 —
wurde das haltbarste, auch in Nürnberg zu habende Lorbeerblatt zum Kranze gewunden, ungeachtet seiner sonstigen
Verwendung als Ruhmeszeichen Apolls. Gleiche Kränze aus Lorbeerzweigen fand Dürer bei .seinem Vorbild Martin Schi >n-
gauerin dessen 10 Kupferstichen der Mädchen mit den Öllampen, wo die fünf klugen Jungfrauen (B. 77—81) die Kränze
frei auf dem Kopfe tragen, während bei den fünf törichten (B. 82—86) die abgenommenen Gebinde zu Füßen liegen.
Die Frauenhäuslerinnen betrachteten sich als eine Art von Zunft1 und wahrten ihre Rechte. Sie wählten unter
sich eine Vorsteherin. Da es nun Sitte war, der Oberdienstmagd einen viel längeren Schleier zu geben wie den anderen,2
so konnte I als Anführerin ihren Kopfschleier zur Schwurfahne machen, woran alle Viere ihre Hände haben. Die rechte
Hand von II hat man sich der Armhaltung nach als in die linke von III zur Begrüßung gelegt zu denken, und IV ist im
Begriff, zum Abschied mit ihrer Linken — in Horizonthöhe — einzuschlagen.
Geht die Sonne unter, so zündet man die Hängelampe an, welche ihr Licht über Flur und Treppe nach der Gasse
herunterwirft und durch die Anfangsbuchstaben O. G. H. anzeigt, daß hier ein Offenes, öffentliches Gäste Haus zum
Eintreten lockt. Dürer zeigt sich hier als Erfinder der heute so hoch entwickelten Lichtreklame. Die phantastische
Form der Lampe zieht die Augen des Vorübergehenden an und zwingt ihn, einen Augenblick haltzumachen. Je länger
der Sinn der drei Anfangsbuchstaben unklar bleibt, je länger denkt man an dem Geheimnis des Hauses herum und sucht
es schließlich durch seinen Eintritt zu ergründen. Es handelt sich gar nicht darum, was O. G. H. heißen muß, sondern
was es bedeuten kann. Und zur Aufklärung konnten vor 4 Jahrhunderten auch nur die näheren Umstände dienlich sein.
Genau wie jetzt, wo das A. in den Kürzungen U. S. A. — I. L. A. — R. E. A. das eine Mal »Amerika«, das andere Mal
»Ausstellung« und endlich »Amt« vorstellt. — Als Gegengewicht zur marktschreierischen Laterne verstreut Dürer auf
den Treppenstufen Schädel nebst Schenkelknochen, um den Eintretenden zu Gemüt zu führen, daß Opfer unausbleiblich sind.
Xun zum Teufel. Besaß Dürer Vorbilder? Der Meister mag 1497 bekannt gewesen sein mit dem um 1475 entstan-
denen großen Holzschnitt: Die sinnliche Liebe (Schreiber 1869), ein Blatt, das aus Goethes Besitz ins Museum zu Weimar
kam.3 Da finden wir— flankiert von 10 Brustbildern von Heiligen und Gelehrten mit ihren deutschen oder lateinischen
Sinnsprüchen — die »Amor carnalis« als geflügelten, nackten, weiblichen Genius mit verbundenen Augen, einen Pfeil auf
den Bogen legend. Darunter liegt als »Finis amoris« ein schwertdurchbohrter Totenkopf über einem feuerspeienden
offenen Teufelsrachen. Der Text bewegt sich um den Gedanken: Das bittere Ende der schnöden Liebe führe zur Hölle.
Dann lag damals der Kupferstich des Bandrollenmeisters (Abb. 6) vor4 mit dem Innern eines Frauenhauses, wie
es sich ein eben zur Türe hereinkommender Narr zwischen den Fingern durch betrachtet: Ein Stutzer mit Antoniuskreuz
als Halsschmuck, noch mit den Straßentrippen an den Füßen, gibt sich mit einer haubenbekrönten Insassin des Hauses
ab, welcher als Hülle nur ein schmaler Schleier zu Gebot steht, den sie um die Hüften schlingt. Solchen Schleiers
bedient sich auch das durch ihr offenes Haar als Novize gekennzeichnete Mädchen, welches zwischen dem Narren und
dem sitzenden Paare stehend das Spruchband hochhält: Inspicite hic allectiva juventutis. (Besichtiget hier die Anlockungen
der Jugend.) Beide Frauen sind barfuß wie bei Dürer. Eines Hinweises auf die Hölle hat sich der namenlose Künstler
enthalten. Anders unser 26jähriger Jungverheirateter Meister Albrecht, indem er den zähnefletschenden leibhaftigen Gott-
seibeiuns ans Herdfeuer des Hauswirts stellt, von wo er die vier Frauen beobachtet, ohne daß sie es ahnen. Der Teufel
wendet sich nicht gegen das jetzige Gebaren der Frauen, sondern deutet mit der krallenumklammerten Zange nach den
Vergnügungslokalen links hin, den Stätten der Unmoral. Wer weiß, wie bald die Hübscherinnen das 0. G. H. der Laterne
als »OGott Hilf!« lesen und nach Öffnung der gotischen Türe zur Hauskapelle sich sehnen werden!
Wilhelm Bühler (München 1926).
Signaturen des Meisters von Zwolle.
Unser Kupferstecher kommt in Betracht nach Wohnort, Hausmarke, Initialen und Werkzeug.
WOHNORT. Am oberen Rand manches Blattes steht 3woff" oder zwtt. Wäre frei über den beiden Schluß-
buchstaben ein Strich also tt, so hätten wir ein doppeltes t, das heißt Zwott. Aber die Verbindung geht durch die End-
buchstaben selbst durch, so daß wir es mit einem doppelten 1 zu tun haben, das heißt Zwoll.5 Es kann sich nur um die
östlich von Campen am Zuidersee gelegene Stadt handeln, welche 1662 im holländischen Atlas von J. Blaev auf
3 Karten in der verschiedenen Schreibart von Zwol, Zwoll und Zwolle auftritt.
Ganz getrennt vom Wohnort geben die Kupferstiche in nächster Nähe des unteren Blattrands die Signaturen des
Meisternamens. . .
HAUSMARKE: oder AfV Wir können nicht bestimmen, ob wir einen Pferde-Striegel, eine Feld-
Egge, eine Maurer-Kelle, eine Maler-Staffelei oder einen Schiffs-Anker vor uns haben. Vielleicht liegt in dem
i Schultz (S. 40, a). S. 76. — 2 Schneller, Bayrisches Wörterbuch, 1873, II, S. 521, mit sog. Schleier-Dienst-Ordnung von 1500. — 3 .Einzel-
drucke des X\ .Jahrh. W.L. Schreiber, Straßburg Heitz 1925. Bl. 14.. - •. Schultz Alwin, S. 70. - 5 A. Cappeli, 1912. Lexikon abbreviat. Lat. ed Ital.
42 —