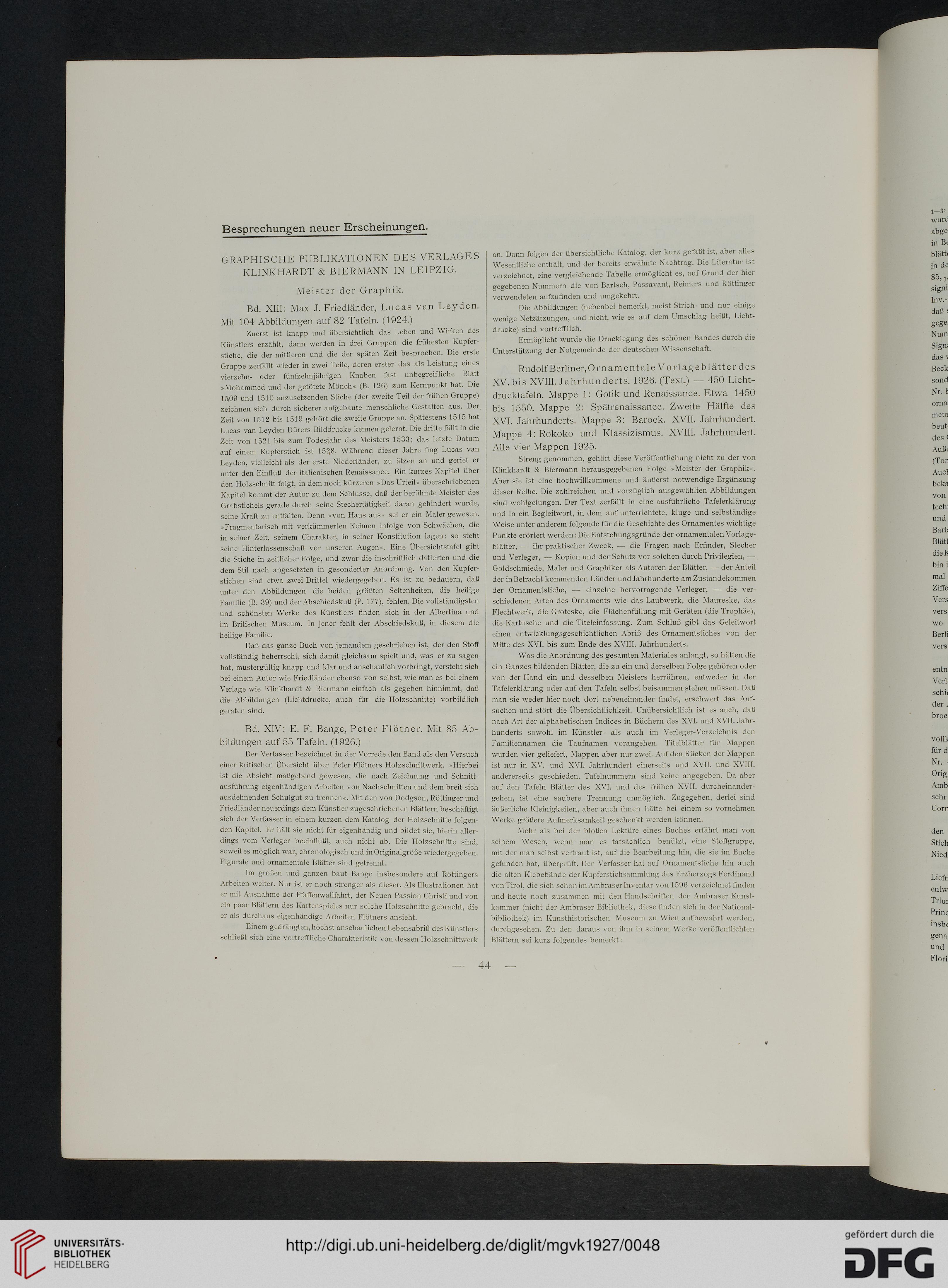Besprechungen neuer Erscheinungen.
GRAPHISCHE PUBLIKATIONEN DES VERLAGES
KLINK HARDT & BIERMANN IN LEIPZIG.
Meister der Graphik.
Bd. XIII: Max J. Friedländer, Lucas van Leyden.
Mit 104 Abbildungen auf 82 Tafeln. (1924.)
Zuerst ist knapp und übersichtlich das Leben und Wirken des
Künstlers erzählt, dann werden in drei Gruppen die frühesten Kupfer-
stiche, die der mittleren und die der späten Zeit besprochen. Die erste
Gruppe zerfällt wieder in zwei Teile, deren erster das als Leistung eines
vierzehn- oder fünfzehnjährigen Knaben fast unbegreifliche Blatt
»Mohammed und der getötete Mönch« (Ii. 126) zum Kernpunkt hat. Die
1509 und 1510 anzusetzenden Stiche (der zweite Teil der frühen Gruppe)
zeichnen sich durch sicherer aufgebaute menschliche Gestalten aus. Der.
Zeit von 1512 bis 1519 gehört die zweite Gruppe an. Spätestens 1515 hat
Lucas van Leyden Dürers Bilddrucke kennen gelernt. Die dritte fällt in die
Zeit von 1521 bis zum Todesjahr des Meisters 1533; das letzte Datum
auf einem Kupferstich ist 152.8. Während dieser Jahre fing Lucas van
Leyden. vielleicht als der erste Niederländer, zu ätzen an und geriet er
unter den Einfluß der italienischen Renaissance. Ein kurzes Kapitel über
den Holzschnitt folgt, in dem noch kürzeren »Das Urteil« überschriebenen
Kapitel kommt der Autor zu dem Schlüsse, daß der berühmte Meister des
Grabstichels gerade durch seine Stechertätigkeit daran gehindert wurde,
seine Kraft zu entfalten. Denn »von Haus aus« sei er ein Maler gewesen.
»Fragmentarisch mit verkümmerten Keimen infolge von Schwächen, die
in seiner Zeit, seinem Charakter, in seiner Konstitution lagen: so steht
seine Hinterlassenschaft vor unseren Augen«. Eine Übersichtstafel gibt
die Stiche in zeitlicher Folge, und zwar die inschriftlich datierten und die
dem Stil nach angesetzten in gesonderter Anordnung. Von den Kupfer-
stichen sind etwa zwei Drittel wiedergegeben. Es ist zu bedauern, daß
unter den Abbildungen die beiden größten Seltenheiten, die heilige
Familie (B. 39) und der Abschiedskuß (P. 177), fehlen. Die vollständigsten
und schönsten Werke des Künstlers finden sich in der Albertina und
im Britischen Museum. In jener fehlt der Abschiedskuß. in diesem die
heilige Familie.
Daß das ganze Buch von jemandem geschrieben ist, der den Stoff
vollständig beherrscht, sich damit gleichsam spielt und, was er zu sagen
hat, mustergültig knapp und klar und anschaulich vorbringt, versteht sich
bei einem Autor wie Friedländer ebenso von selbst, wie man es bei einem
Verlage wie Klinkhardt & Biermann einfach als gegeben hinnimmt, daß
die Abbildungen (Lichtdrucke, auch für die Holzschnitte) vorbildlich
geraten sind.
Bd. XIV: E. F. Bange, Peter Flötner. Mit 85 Ab-
bildungen auf 55 Tafeln. (1926.)
Der Verfasser bezeichnet in der Vorrede den Band als den Versuch
einer kritischen Übersicht über Peter Flötners Holzschnittwerk. »Hierbei
ist die Absicht maßgebend gewesen, die nach Zeichnung und Schnitt-
ausführung eigenhändigen Arbeiten von Nachschnitten und dem breit sich
ausdehnenden Schulgut zu trennen«. Mit den von Dodgson, Röttinger und
Friedländer neuerdings dem Künstler zugeschriebenen Blättern beschäftigt
sich der Verfasser in einem kurzen dem Katalog der Holzschnitte folgen-
den Kapitel. Er hält sie nicht für eigenhändig und bildet sie. hierin aller-
dings vom Verleger beeinflußt, auch nicht ab. Die Holzschnitte sind,
soweit es möglich war, chronologisch und in Originalgröße wiedergegeben.
Figurale und ornamentale Blätter sind getrennt.
Im großen und ganzen baut Bange insbesondere auf Röttingers
Arbeiten weiter. Nur ist er noch strenger als dieser. Als Illustrationen hat
er mit Ausnahme der Pfaffen wallfahrt, der Neuen Passion Christi und von
ein paar Blättern des Kartenspieles nur solche Holzschnitte gebracht, die
er als durchaus eigenhändige Arbeiten Flötners ansieht.
Einem gedrängten,höchst anschaulichenLebcnsabriß des Künstlers
schließt sich eine vortreffliche Charakteristik von dessen Holzscnnittwerk
an. Dann folgen der übersichtliche Katalog, der kurz gefaßt ist, aber alles
Wesentliche enthält, und der bereits erwähnte Nachtrag. Die Literatur ist
verzeichnet, eine vergleichende Tabelle ermöglicht es, auf Grund der hier
gegebenen Nummern die von Bartsch, Passavant, Reimers und Röttinger
verwendeten aufzufinden und umgekehrt.
Die Abbildungen (nebenbei bemerkt, meist Strich- und nur einige
wenige Netzätzungen, und nicht, wie es auf dem Umschlag heißt, Licht-
drucke) sind vortrefflich.
Ermöglicht wurde die Drucklegung des schönen Bandes durch die
Unterstützung der Notgemeinde der deutschen Wissenschaft.
Rudolf Berliner,Orn amentale Vorlageblätter des
XV. bis XVIII. Jahrhunderts. 1926. (Text.) — 450 Licht-
drucktafeln. Mappe 1: Gotik und Renaissance. Etwa 1450
bis 1550. Mappe 2: Spätrenaissance. Zweite Hälfte des
XVI. Jahrhunderts. Mappe 3: Barock. XVII. Jahrhundert.
Mappe 4: Rokoko und Klassizismus. XVIII. Jahrhundert.
Alle vier Mappen 1925.
Streng genommen, gehört diese Veröffentlichung nicht zu der von
Klinkhardt & Biermann herausgegebenen Folge «Meister der Graphik«.
Aber sie ist eine hochwillkommene und äußerst notwendige Ergänzung
dieser Reihe. Die zahlreichen und vorzüglich ausgewählten Abbildungen
sind wohlgelungen. Der Text zerfällt in eine ausführliche Tafelerklärung
und in ein Bcgieitwort, in dem auf unterrichtete, kluge und selbständige
Weise unter anderem folgende für die Geschichte des Ornamentes wichtige
Punkte erörtert werden: Die Entstehungsgründe der ornamentalen Vorlage-
blätter, — ihr praktischer Zweck, — die Fragen nach Erfinder, Stecher
und Verleger, — Kopien und der Schutz vor solchen durch Privilegien, —
Goldschmiede, Maler und Graphiker als Autoren der Blätter. — der Anteil
der in Betracht kommenden Länder und Jahrhunderte am Zustandekommen
der Ornamentstiche, — einzelne hervorragende Verleger, —■ die ver-
schiedenen Arten des Ornaments wie das Laubwerk, die Maureskc, das
Flechtwerk, die Groteske, die Flächenfüllung mit Geräten (die Trophäe),
die Kartusche und die Titeleinfassung. Zum Schluß gibt das Geleitwort
einen entwicklungsgeschichtlichen Abriß des Ornamentstiches von der
Mitte des XVI. bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts.
Was die Anordnung des gesamten Materiales anlangt, so hätten die
ein Ganzes bildenden Blätter, die zu ein und derselben Folge gehören oder
von der Hand ein und desselben .Meisters herrühren, entweder in der
Tafel erklär ung oder auf den Tafeln selbst beisammen stehen müssen. Daß
man sie weder hier noch dort nebeneinander findet, erschwert das Auf-
suchen und stört die Übersichtlichkeit. Unübersichtlich ist es auch, daß
nach Art der alphabetischen Indices in Büchern des XVI. und XVII. Jahr-
hunderts sowohl im Künstler- als auch im Verleger-Verzeichnis den
Familiennamen die Taufnamen vorangehen. Titelblätter für Mappen
wurden vier geliefert, Mappen aber nur zwei. Auf den Rücken der Mappen
ist nur in XV. und XVI. Jahrhundert einerseits und XVII. und XVIII.
andererseits geschieden. Tafelnummern sind keine angegeben. Da aber
auf den Tafeln Blätter des XVI. und des frühen XVII. durcheinander-
gehen, ist eine saubere Trennung unmöglich. Zugegeben, derlei sind
äußerliche Kleinigkeiten, aber auch ihnen hätte bei einem so vornehmen
Werke größere Aufmerksamkeit geschenkt werden können.
Mehr als bei der bloßen Lektüre eines Buches erfährt man von
seinem Wesen, wenn man es tatsächlich benützt, eine Stoffgruppe,
mit der man selbst vertraut ist, auf die Bearbeitung hin, die sie im Buche
gefunden hat, überprüft. Der Verfasser hat auf Ornamentstiche hin auch
die alten Klebebände der Kupferstichsammlung des Erzherzogs Ferdinand
von Tirol, die sich schon im Ambraser Inventar von 1596 verzeichnet finden
und heute noch zusammen mit den Handschriften der Ambraser Kunst-
kammer (nicht der Ambraser Bibliothek, diese finden sich in der National-
bibliothek) im Kunsthistorischen Museum zu Wien aufbewahrt werden,
durchgesehen. Zu den daraus von ihm in seinem Werke veröffentlichten
Blättern sei kurz folgendes bemerkt:
— 44 —
GRAPHISCHE PUBLIKATIONEN DES VERLAGES
KLINK HARDT & BIERMANN IN LEIPZIG.
Meister der Graphik.
Bd. XIII: Max J. Friedländer, Lucas van Leyden.
Mit 104 Abbildungen auf 82 Tafeln. (1924.)
Zuerst ist knapp und übersichtlich das Leben und Wirken des
Künstlers erzählt, dann werden in drei Gruppen die frühesten Kupfer-
stiche, die der mittleren und die der späten Zeit besprochen. Die erste
Gruppe zerfällt wieder in zwei Teile, deren erster das als Leistung eines
vierzehn- oder fünfzehnjährigen Knaben fast unbegreifliche Blatt
»Mohammed und der getötete Mönch« (Ii. 126) zum Kernpunkt hat. Die
1509 und 1510 anzusetzenden Stiche (der zweite Teil der frühen Gruppe)
zeichnen sich durch sicherer aufgebaute menschliche Gestalten aus. Der.
Zeit von 1512 bis 1519 gehört die zweite Gruppe an. Spätestens 1515 hat
Lucas van Leyden Dürers Bilddrucke kennen gelernt. Die dritte fällt in die
Zeit von 1521 bis zum Todesjahr des Meisters 1533; das letzte Datum
auf einem Kupferstich ist 152.8. Während dieser Jahre fing Lucas van
Leyden. vielleicht als der erste Niederländer, zu ätzen an und geriet er
unter den Einfluß der italienischen Renaissance. Ein kurzes Kapitel über
den Holzschnitt folgt, in dem noch kürzeren »Das Urteil« überschriebenen
Kapitel kommt der Autor zu dem Schlüsse, daß der berühmte Meister des
Grabstichels gerade durch seine Stechertätigkeit daran gehindert wurde,
seine Kraft zu entfalten. Denn »von Haus aus« sei er ein Maler gewesen.
»Fragmentarisch mit verkümmerten Keimen infolge von Schwächen, die
in seiner Zeit, seinem Charakter, in seiner Konstitution lagen: so steht
seine Hinterlassenschaft vor unseren Augen«. Eine Übersichtstafel gibt
die Stiche in zeitlicher Folge, und zwar die inschriftlich datierten und die
dem Stil nach angesetzten in gesonderter Anordnung. Von den Kupfer-
stichen sind etwa zwei Drittel wiedergegeben. Es ist zu bedauern, daß
unter den Abbildungen die beiden größten Seltenheiten, die heilige
Familie (B. 39) und der Abschiedskuß (P. 177), fehlen. Die vollständigsten
und schönsten Werke des Künstlers finden sich in der Albertina und
im Britischen Museum. In jener fehlt der Abschiedskuß. in diesem die
heilige Familie.
Daß das ganze Buch von jemandem geschrieben ist, der den Stoff
vollständig beherrscht, sich damit gleichsam spielt und, was er zu sagen
hat, mustergültig knapp und klar und anschaulich vorbringt, versteht sich
bei einem Autor wie Friedländer ebenso von selbst, wie man es bei einem
Verlage wie Klinkhardt & Biermann einfach als gegeben hinnimmt, daß
die Abbildungen (Lichtdrucke, auch für die Holzschnitte) vorbildlich
geraten sind.
Bd. XIV: E. F. Bange, Peter Flötner. Mit 85 Ab-
bildungen auf 55 Tafeln. (1926.)
Der Verfasser bezeichnet in der Vorrede den Band als den Versuch
einer kritischen Übersicht über Peter Flötners Holzschnittwerk. »Hierbei
ist die Absicht maßgebend gewesen, die nach Zeichnung und Schnitt-
ausführung eigenhändigen Arbeiten von Nachschnitten und dem breit sich
ausdehnenden Schulgut zu trennen«. Mit den von Dodgson, Röttinger und
Friedländer neuerdings dem Künstler zugeschriebenen Blättern beschäftigt
sich der Verfasser in einem kurzen dem Katalog der Holzschnitte folgen-
den Kapitel. Er hält sie nicht für eigenhändig und bildet sie. hierin aller-
dings vom Verleger beeinflußt, auch nicht ab. Die Holzschnitte sind,
soweit es möglich war, chronologisch und in Originalgröße wiedergegeben.
Figurale und ornamentale Blätter sind getrennt.
Im großen und ganzen baut Bange insbesondere auf Röttingers
Arbeiten weiter. Nur ist er noch strenger als dieser. Als Illustrationen hat
er mit Ausnahme der Pfaffen wallfahrt, der Neuen Passion Christi und von
ein paar Blättern des Kartenspieles nur solche Holzschnitte gebracht, die
er als durchaus eigenhändige Arbeiten Flötners ansieht.
Einem gedrängten,höchst anschaulichenLebcnsabriß des Künstlers
schließt sich eine vortreffliche Charakteristik von dessen Holzscnnittwerk
an. Dann folgen der übersichtliche Katalog, der kurz gefaßt ist, aber alles
Wesentliche enthält, und der bereits erwähnte Nachtrag. Die Literatur ist
verzeichnet, eine vergleichende Tabelle ermöglicht es, auf Grund der hier
gegebenen Nummern die von Bartsch, Passavant, Reimers und Röttinger
verwendeten aufzufinden und umgekehrt.
Die Abbildungen (nebenbei bemerkt, meist Strich- und nur einige
wenige Netzätzungen, und nicht, wie es auf dem Umschlag heißt, Licht-
drucke) sind vortrefflich.
Ermöglicht wurde die Drucklegung des schönen Bandes durch die
Unterstützung der Notgemeinde der deutschen Wissenschaft.
Rudolf Berliner,Orn amentale Vorlageblätter des
XV. bis XVIII. Jahrhunderts. 1926. (Text.) — 450 Licht-
drucktafeln. Mappe 1: Gotik und Renaissance. Etwa 1450
bis 1550. Mappe 2: Spätrenaissance. Zweite Hälfte des
XVI. Jahrhunderts. Mappe 3: Barock. XVII. Jahrhundert.
Mappe 4: Rokoko und Klassizismus. XVIII. Jahrhundert.
Alle vier Mappen 1925.
Streng genommen, gehört diese Veröffentlichung nicht zu der von
Klinkhardt & Biermann herausgegebenen Folge «Meister der Graphik«.
Aber sie ist eine hochwillkommene und äußerst notwendige Ergänzung
dieser Reihe. Die zahlreichen und vorzüglich ausgewählten Abbildungen
sind wohlgelungen. Der Text zerfällt in eine ausführliche Tafelerklärung
und in ein Bcgieitwort, in dem auf unterrichtete, kluge und selbständige
Weise unter anderem folgende für die Geschichte des Ornamentes wichtige
Punkte erörtert werden: Die Entstehungsgründe der ornamentalen Vorlage-
blätter, — ihr praktischer Zweck, — die Fragen nach Erfinder, Stecher
und Verleger, — Kopien und der Schutz vor solchen durch Privilegien, —
Goldschmiede, Maler und Graphiker als Autoren der Blätter. — der Anteil
der in Betracht kommenden Länder und Jahrhunderte am Zustandekommen
der Ornamentstiche, — einzelne hervorragende Verleger, —■ die ver-
schiedenen Arten des Ornaments wie das Laubwerk, die Maureskc, das
Flechtwerk, die Groteske, die Flächenfüllung mit Geräten (die Trophäe),
die Kartusche und die Titeleinfassung. Zum Schluß gibt das Geleitwort
einen entwicklungsgeschichtlichen Abriß des Ornamentstiches von der
Mitte des XVI. bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts.
Was die Anordnung des gesamten Materiales anlangt, so hätten die
ein Ganzes bildenden Blätter, die zu ein und derselben Folge gehören oder
von der Hand ein und desselben .Meisters herrühren, entweder in der
Tafel erklär ung oder auf den Tafeln selbst beisammen stehen müssen. Daß
man sie weder hier noch dort nebeneinander findet, erschwert das Auf-
suchen und stört die Übersichtlichkeit. Unübersichtlich ist es auch, daß
nach Art der alphabetischen Indices in Büchern des XVI. und XVII. Jahr-
hunderts sowohl im Künstler- als auch im Verleger-Verzeichnis den
Familiennamen die Taufnamen vorangehen. Titelblätter für Mappen
wurden vier geliefert, Mappen aber nur zwei. Auf den Rücken der Mappen
ist nur in XV. und XVI. Jahrhundert einerseits und XVII. und XVIII.
andererseits geschieden. Tafelnummern sind keine angegeben. Da aber
auf den Tafeln Blätter des XVI. und des frühen XVII. durcheinander-
gehen, ist eine saubere Trennung unmöglich. Zugegeben, derlei sind
äußerliche Kleinigkeiten, aber auch ihnen hätte bei einem so vornehmen
Werke größere Aufmerksamkeit geschenkt werden können.
Mehr als bei der bloßen Lektüre eines Buches erfährt man von
seinem Wesen, wenn man es tatsächlich benützt, eine Stoffgruppe,
mit der man selbst vertraut ist, auf die Bearbeitung hin, die sie im Buche
gefunden hat, überprüft. Der Verfasser hat auf Ornamentstiche hin auch
die alten Klebebände der Kupferstichsammlung des Erzherzogs Ferdinand
von Tirol, die sich schon im Ambraser Inventar von 1596 verzeichnet finden
und heute noch zusammen mit den Handschriften der Ambraser Kunst-
kammer (nicht der Ambraser Bibliothek, diese finden sich in der National-
bibliothek) im Kunsthistorischen Museum zu Wien aufbewahrt werden,
durchgesehen. Zu den daraus von ihm in seinem Werke veröffentlichten
Blättern sei kurz folgendes bemerkt:
— 44 —