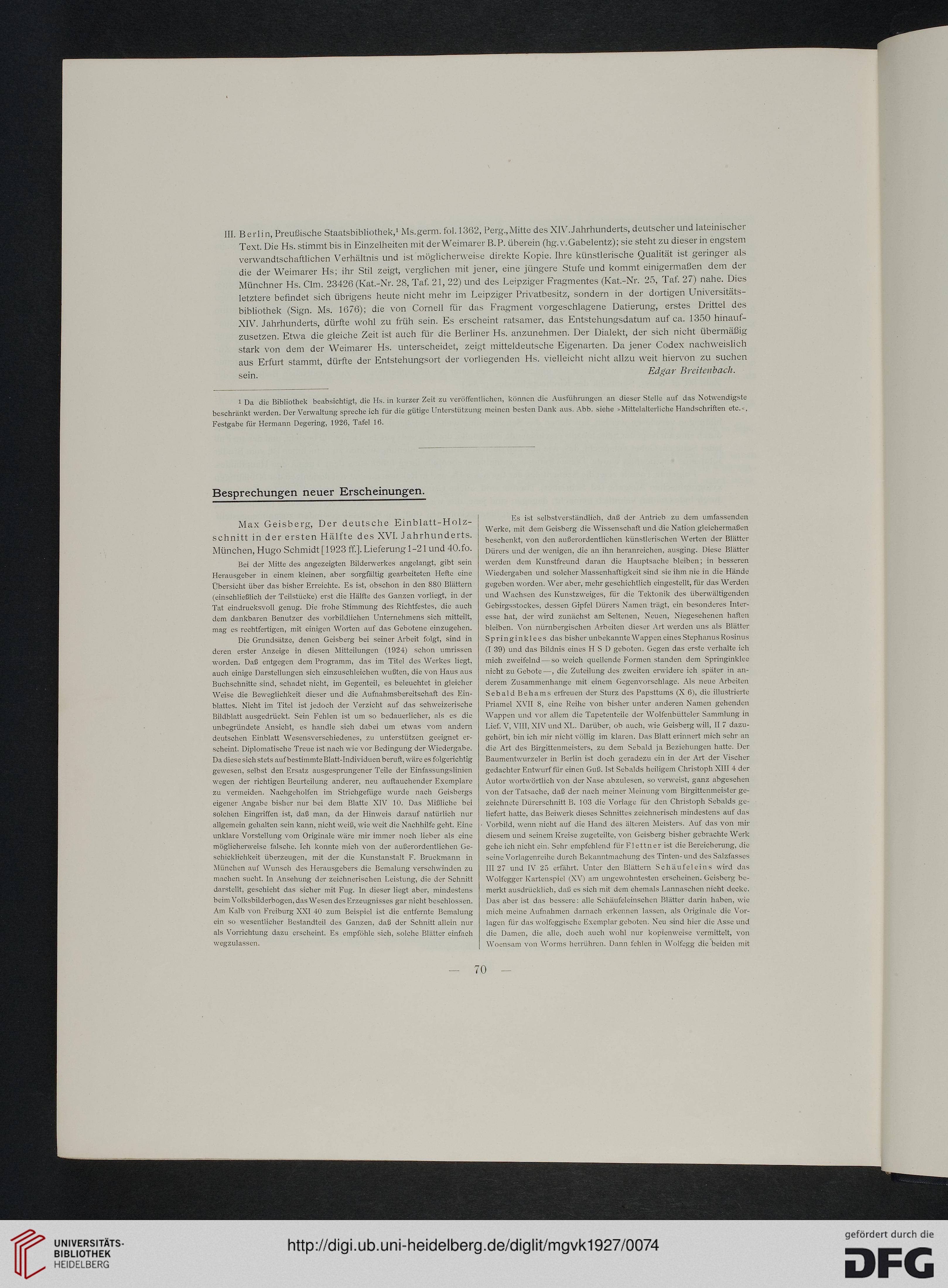HL Berlin, Preußische Staatsbibliothek,1 Ms.germ. fol. 1362, Perg.,Mitte des XlV.Jahrhunderts, deutscherund lateinischer
Text. Die Hs. stimmt bis in Einzelheiten mit der Weimarer B.P. überein (hg. v.Gabelentz); sie steht zu dieser in engstem
verwandtschaftlichen Verhältnis und ist möglicherweise direkte Kopie. Ihre künstlerische Qualität ist geringer als
die der Weimarer Hs; ihr Stil zeigt, verglichen mit jener, eine jüngere Stufe und kommt einigermaßen dem der
Münchner Hs. Clm. 23426 (Kat.-Nr. 28, Taf. 21, 22) und des Leipziger Fragmentes (Kat.-Nr. 25, Taf. 27) nahe. Dies
letztere befindet sich übrigens heute nicht mehr im Leipziger Privatbesitz, sondern in der dortigen Universitäts-
bibliothek (Sign. Ms. 1676); die von Cornell für das Fragment vorgeschlagene Datierung, erstes Drittel des
XIV. Jahrhunderts, dürfte wohl zu früh sein. Es erscheint ratsamer, das Entstehungsdatum auf ca. 1350 hinauf-
zusetzen. Etwa die gleiche Zeit ist auch für die Berliner Hs. anzunehmen. Der Dialekt, der sich nicht übermäßig
stark von dem der Weimarer Hs. unterscheidet, zeigt mitteldeutsche Eigenarten. Da jener Codex nachweislich
aus Erfurt stammt, dürfte der Entstehungsort der vorliegenden Hs. vielleicht nicht allzu weit hiervon zu suchen
sein. Edgar Breitenbach.
1 Da die Bibliothek beabsichtigt, die Hs. in kurzer Zeit zu veröffentlichen, können die Ausführungen an dieser Steile auf das Kotwendigste
beschränkt werden. Der Verwaltung spreche ich für die gütige Unterstützung meinen besten Dank aus. Abb. siehe »Mittelalterliche Handschriften etc. -.
Festgabe für Hermann Degering, 1926. Tafel 16.
Besprechungen neuer Erscheinungen.
Max Geisberg, Der deutsche Einblatt-Holz-
schnitt in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts.
München, Hugo Schmidt [1923 ff.]. Lieferung 1-21 und 40.fo.
Bei der Mitte des angezeigten Bilderwerkes angelangt, gibt sein
Herausgeber in einem kleinen, aber sorgfältig gearbeiteten Hefte eine
Übersicht über das bisher Erreichte. Es ist, obschon in den 880 Blättern
(einschließlich der Teilstücke) erst die Hälfte des Ganzen vorliegt, in der
Tat eindrucksvoll genug. Die frohe Stimmung des Richtfestes, die auch
dem dankbaren Benutzer des vorbildlichen Unternehmens sich mitteilt,
mag es rechtfertigen, mit einigen Worten auf das Gebotene einzugehen.
Die Grundsätze, denen Geisberg bei seiner Arbeit folgt, sind in
deren erster Anzeige in diesen Mitteilungen (1924) schon umrissen
worden. Daß entgegen dem Programm, das im Titel des Werkes liegt,
auch einige Darstellungen sich einzuschleichen wußten, die von Haus aus
Buchschnitte sind, schadet nicht, im Gegenteil, es beleuchtet in gleicher
Weise die Beweglichkeit dieser und die Aufnahmsbereitschaft des Ein-
blattes. Nicht im Titel ist jedoch der Verzicht auf das schweizerische
Bildblatt ausgedrückt. Sein Fehlen ist um so bedauerlicher, als es die
unbegründete Ansicht, es handle sich dabei um etwas vom andern
deutschen Einblatt Wesensverschiedencs, zu unterstützen geeignet er-
scheint. Diplomatische Treue ist nach wie vor Bedingung der Wiedergabe.
Da diese sich stets auf bestimmte Blatt-Individuen beruft, wäre es folgerichtig
gewesen, selbst den Ersatz ausgesprungener Teile der Einfassungslinien
wegen der richtigen Beurteilung anderer, neu auftauchender Exemplare
zu vermeiden. Nachgeholfen im Strichgefüge wurde nach Geisbergs
eigener Angabe bisher nur bei dem Blatte XIV 10. Das Mißliche bei
solchen Eingriffen ist, daß man, da der Hinweis darauf natürlich nur
allgemein gehalten sein kann, nicht weiß, wie weit die Nachhilfe geht. Eine
unklare Vorstellung vom Originale wäre mir immer noch Heber als eine
möglicherweise falsche. Ich konnte mich von der außerordentlichen Ge-
schicklichkeit überzeugen, mit der die Kunstanstalt F. Bruckmann in
München auf Wunsch des Herausgebers die Bemalung verschwinden zu
machen sucht. In Ansehung der zeichnerischen Leistung, die der Schnitt
darstellt, geschieht das sicher mit Fug. In dieser liegt aber, mindestens
beim Volksbilderbogen, das Wesen des Erzeugnisses gar nicht beschlossen.
Am Kalb von Freiburg XXI 40 zum Beispiel ist die entfernte Bemalung
ein so wesentlicher Bestandteil des Ganzen, daß der Schnitt allein nur
als Vorrichtung dazu erscheint. Es empföhle sich, solche Blätter einfach
wegzulassen.
Es ist selbstverständlich, daß der Antrieb zu dem umfassenden
Werke, mit dem Geisberg die Wissenschaft und die Nation gleichermaßen
beschenkt, von den außerordentlichen künstlerischen Werten der Blätter
Dürers und der wenigen, die an ihn heranreichen, ausging. Diese Blätter
werden dem Kunstfreund daran die Hauptsache bleiben; in besseren
Wiedergaben und solcher Masscnhaftigkeit sind sie ihm nie in die Hände
gegeben worden. Wer aber, mehr geschichtlich eingestellt, für das Werden
und Wachsen des Kunstzweiges, für die Tektonik des überwältigenden
Gcbirgsstockes, dessen Gipfel Dürers Namen trägt, ein besonderes Inter-
esse hat, der wird zunächst am Seltenen, Neuen, Niegesehenen haften
bleiben. Von nürnbergischen Arbeiten dieser Art werden uns als Blätter
Springink lees das bisher unbekannte Wappen eines StephanusRosinus
(I 39) und das Bildnis eines H S D geboten. Gegen das erste verhalte ich
mich zweifelnd —so weich quellende Formen standen dem Springinklee
nicht zu Gebote—, die Zuteilung des zweiten erwidere ich später in an-
derem Zusammenhange mit einem Gegenvorschlage. Als neue Arbeiten
Sebald Behams erfreuen der Sturz des Papsttums (X 6), die illustrierte
Priamel XVII 8, eine Reihe von bisher unter anderen Namen gehenden
Wappen und vor allem die Tapetenteile der Wolfenbüttelcr Sammlung in
Lief. V, VIII, XIV und XL. Darüber, ob auch, wie Geisberg will, II 7 dazu-
gehört, bin ich mir nicht völlig im klaren. Das Blatt erinnert mich sehr an
die Art des Birgittenmeisters, zu dem Sebald ja Beziehungen hatte. Der
Baumentwurzeier in Berlin ist doch geradezu ein in der Art der Vischer
gedachter Entwurf für einen Guß. Ist Sebalds heiligem Christoph XIII 4 der
Autor wortwörtlich von der Nase abzulesen, so verweist, ganz abgesehen
von der Tatsache, daß der nach meiner Meinung vom Birgitten meiner ge-
zeichnete Dürerschnitt B. 103 die Vorlage für den Christoph Sebalds ge-
liefert hatte, das Beiwerk dieses Schnittes zeichnerisch mindestens auf das
Vorbild, wenn nicht auf die Hand des älteren Meisters. Auf das von mir
diesem und seinem Kreise zugeteilte, von Geisberg bisher gebrachte Werk
gehe ich nicht ein. Sehr empfehlend für Fl ettner ist die Bereicherung, die
seine Vorlagenrcihe durch Bekanntmachung des Tinten- und des Salzfasses
III 27 und IV 25 erfährt. Unter den Blättern Schäufeleins wird das
Wolfegger Kartenspiel (XV) am ungewohntesten erscheinen. Geisberg be-
merkt ausdrücklich, daß es sich mit dem ehemals Lannaschen nicht decke.
Das aber ist das bessere: alle Schäufeleinschen Blätter darin haben, wie
mich meine Aufnahmen darnach erkennen lassen, als Originale die Vor-
lagen für das wolfeggischc Exemplar geboten. Neu sind hier die Asse und
die Damen, die alle, doch auch wohl nur kopienweise vermittelt, von
Woensam von Worms herrühren. Dann fehlen in Wolfegg die beiden mit
- 70 -
Text. Die Hs. stimmt bis in Einzelheiten mit der Weimarer B.P. überein (hg. v.Gabelentz); sie steht zu dieser in engstem
verwandtschaftlichen Verhältnis und ist möglicherweise direkte Kopie. Ihre künstlerische Qualität ist geringer als
die der Weimarer Hs; ihr Stil zeigt, verglichen mit jener, eine jüngere Stufe und kommt einigermaßen dem der
Münchner Hs. Clm. 23426 (Kat.-Nr. 28, Taf. 21, 22) und des Leipziger Fragmentes (Kat.-Nr. 25, Taf. 27) nahe. Dies
letztere befindet sich übrigens heute nicht mehr im Leipziger Privatbesitz, sondern in der dortigen Universitäts-
bibliothek (Sign. Ms. 1676); die von Cornell für das Fragment vorgeschlagene Datierung, erstes Drittel des
XIV. Jahrhunderts, dürfte wohl zu früh sein. Es erscheint ratsamer, das Entstehungsdatum auf ca. 1350 hinauf-
zusetzen. Etwa die gleiche Zeit ist auch für die Berliner Hs. anzunehmen. Der Dialekt, der sich nicht übermäßig
stark von dem der Weimarer Hs. unterscheidet, zeigt mitteldeutsche Eigenarten. Da jener Codex nachweislich
aus Erfurt stammt, dürfte der Entstehungsort der vorliegenden Hs. vielleicht nicht allzu weit hiervon zu suchen
sein. Edgar Breitenbach.
1 Da die Bibliothek beabsichtigt, die Hs. in kurzer Zeit zu veröffentlichen, können die Ausführungen an dieser Steile auf das Kotwendigste
beschränkt werden. Der Verwaltung spreche ich für die gütige Unterstützung meinen besten Dank aus. Abb. siehe »Mittelalterliche Handschriften etc. -.
Festgabe für Hermann Degering, 1926. Tafel 16.
Besprechungen neuer Erscheinungen.
Max Geisberg, Der deutsche Einblatt-Holz-
schnitt in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts.
München, Hugo Schmidt [1923 ff.]. Lieferung 1-21 und 40.fo.
Bei der Mitte des angezeigten Bilderwerkes angelangt, gibt sein
Herausgeber in einem kleinen, aber sorgfältig gearbeiteten Hefte eine
Übersicht über das bisher Erreichte. Es ist, obschon in den 880 Blättern
(einschließlich der Teilstücke) erst die Hälfte des Ganzen vorliegt, in der
Tat eindrucksvoll genug. Die frohe Stimmung des Richtfestes, die auch
dem dankbaren Benutzer des vorbildlichen Unternehmens sich mitteilt,
mag es rechtfertigen, mit einigen Worten auf das Gebotene einzugehen.
Die Grundsätze, denen Geisberg bei seiner Arbeit folgt, sind in
deren erster Anzeige in diesen Mitteilungen (1924) schon umrissen
worden. Daß entgegen dem Programm, das im Titel des Werkes liegt,
auch einige Darstellungen sich einzuschleichen wußten, die von Haus aus
Buchschnitte sind, schadet nicht, im Gegenteil, es beleuchtet in gleicher
Weise die Beweglichkeit dieser und die Aufnahmsbereitschaft des Ein-
blattes. Nicht im Titel ist jedoch der Verzicht auf das schweizerische
Bildblatt ausgedrückt. Sein Fehlen ist um so bedauerlicher, als es die
unbegründete Ansicht, es handle sich dabei um etwas vom andern
deutschen Einblatt Wesensverschiedencs, zu unterstützen geeignet er-
scheint. Diplomatische Treue ist nach wie vor Bedingung der Wiedergabe.
Da diese sich stets auf bestimmte Blatt-Individuen beruft, wäre es folgerichtig
gewesen, selbst den Ersatz ausgesprungener Teile der Einfassungslinien
wegen der richtigen Beurteilung anderer, neu auftauchender Exemplare
zu vermeiden. Nachgeholfen im Strichgefüge wurde nach Geisbergs
eigener Angabe bisher nur bei dem Blatte XIV 10. Das Mißliche bei
solchen Eingriffen ist, daß man, da der Hinweis darauf natürlich nur
allgemein gehalten sein kann, nicht weiß, wie weit die Nachhilfe geht. Eine
unklare Vorstellung vom Originale wäre mir immer noch Heber als eine
möglicherweise falsche. Ich konnte mich von der außerordentlichen Ge-
schicklichkeit überzeugen, mit der die Kunstanstalt F. Bruckmann in
München auf Wunsch des Herausgebers die Bemalung verschwinden zu
machen sucht. In Ansehung der zeichnerischen Leistung, die der Schnitt
darstellt, geschieht das sicher mit Fug. In dieser liegt aber, mindestens
beim Volksbilderbogen, das Wesen des Erzeugnisses gar nicht beschlossen.
Am Kalb von Freiburg XXI 40 zum Beispiel ist die entfernte Bemalung
ein so wesentlicher Bestandteil des Ganzen, daß der Schnitt allein nur
als Vorrichtung dazu erscheint. Es empföhle sich, solche Blätter einfach
wegzulassen.
Es ist selbstverständlich, daß der Antrieb zu dem umfassenden
Werke, mit dem Geisberg die Wissenschaft und die Nation gleichermaßen
beschenkt, von den außerordentlichen künstlerischen Werten der Blätter
Dürers und der wenigen, die an ihn heranreichen, ausging. Diese Blätter
werden dem Kunstfreund daran die Hauptsache bleiben; in besseren
Wiedergaben und solcher Masscnhaftigkeit sind sie ihm nie in die Hände
gegeben worden. Wer aber, mehr geschichtlich eingestellt, für das Werden
und Wachsen des Kunstzweiges, für die Tektonik des überwältigenden
Gcbirgsstockes, dessen Gipfel Dürers Namen trägt, ein besonderes Inter-
esse hat, der wird zunächst am Seltenen, Neuen, Niegesehenen haften
bleiben. Von nürnbergischen Arbeiten dieser Art werden uns als Blätter
Springink lees das bisher unbekannte Wappen eines StephanusRosinus
(I 39) und das Bildnis eines H S D geboten. Gegen das erste verhalte ich
mich zweifelnd —so weich quellende Formen standen dem Springinklee
nicht zu Gebote—, die Zuteilung des zweiten erwidere ich später in an-
derem Zusammenhange mit einem Gegenvorschlage. Als neue Arbeiten
Sebald Behams erfreuen der Sturz des Papsttums (X 6), die illustrierte
Priamel XVII 8, eine Reihe von bisher unter anderen Namen gehenden
Wappen und vor allem die Tapetenteile der Wolfenbüttelcr Sammlung in
Lief. V, VIII, XIV und XL. Darüber, ob auch, wie Geisberg will, II 7 dazu-
gehört, bin ich mir nicht völlig im klaren. Das Blatt erinnert mich sehr an
die Art des Birgittenmeisters, zu dem Sebald ja Beziehungen hatte. Der
Baumentwurzeier in Berlin ist doch geradezu ein in der Art der Vischer
gedachter Entwurf für einen Guß. Ist Sebalds heiligem Christoph XIII 4 der
Autor wortwörtlich von der Nase abzulesen, so verweist, ganz abgesehen
von der Tatsache, daß der nach meiner Meinung vom Birgitten meiner ge-
zeichnete Dürerschnitt B. 103 die Vorlage für den Christoph Sebalds ge-
liefert hatte, das Beiwerk dieses Schnittes zeichnerisch mindestens auf das
Vorbild, wenn nicht auf die Hand des älteren Meisters. Auf das von mir
diesem und seinem Kreise zugeteilte, von Geisberg bisher gebrachte Werk
gehe ich nicht ein. Sehr empfehlend für Fl ettner ist die Bereicherung, die
seine Vorlagenrcihe durch Bekanntmachung des Tinten- und des Salzfasses
III 27 und IV 25 erfährt. Unter den Blättern Schäufeleins wird das
Wolfegger Kartenspiel (XV) am ungewohntesten erscheinen. Geisberg be-
merkt ausdrücklich, daß es sich mit dem ehemals Lannaschen nicht decke.
Das aber ist das bessere: alle Schäufeleinschen Blätter darin haben, wie
mich meine Aufnahmen darnach erkennen lassen, als Originale die Vor-
lagen für das wolfeggischc Exemplar geboten. Neu sind hier die Asse und
die Damen, die alle, doch auch wohl nur kopienweise vermittelt, von
Woensam von Worms herrühren. Dann fehlen in Wolfegg die beiden mit
- 70 -