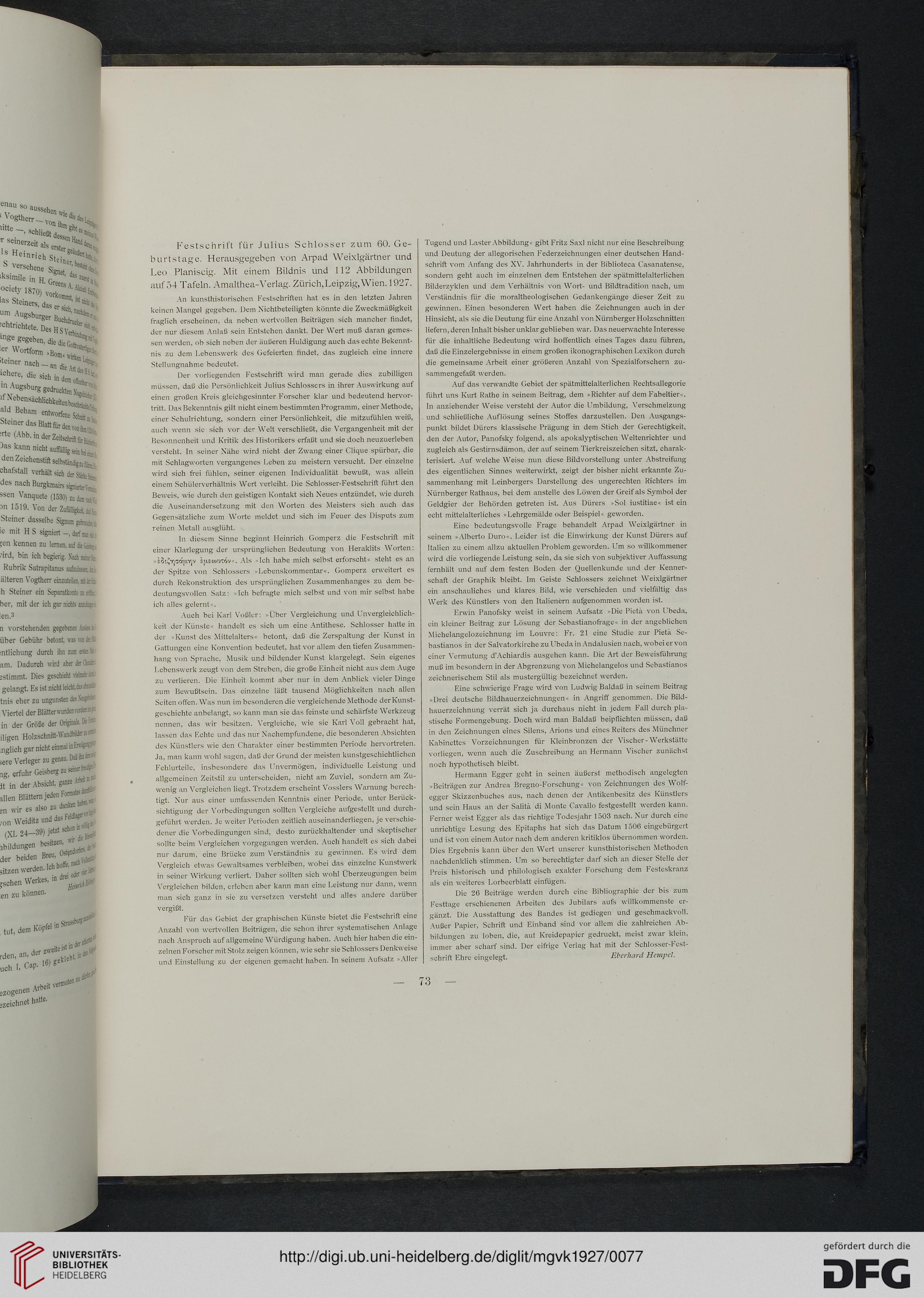enaUs" aussehen ■
»tte """«gibt
*1
S.Ve^hene SiJ?**%
ksimile
gegeben. dieii *^:
Stil bij j.
dBehamenhvorfeneS[b^.
asB,attfijrdent ^
Jas kann nicht a "
den Zeichenstin
=hafstall verhält sich der Sfefe.
des nach BurglcmairssijrierteV..^
5sen Vanquete (1530t zu dm^
>n 1519. Von der ZaBfc^
Steiner dasselbe Sign™ ph^T
mit HS signiert -,djifu,s
in kennen zu lernen, auf die GsiK
rd, bin ich begierig. Xict wl
Rubrik Satrapitanus aufzolaseii:;
älteren \'ogtherr einzuteilen, «fe
Steiner ein Separatkonto rs ri
ir, mit der ich gar nichts «mfe
n.3
vorstehenden gegebenen Assis:
jber Gebühr betont, was von de ■-
ntlichung durch ihn zum est Ii
im. Dadurch wird aber dir Ort
stimmt. Dies geschiebt rieb*-'
gelangt. Es ist nicht leichtdasitri
:nis eher zu Ungunsten des .VeigtK
iertel der BlätterminienvordetM
der Größe der Originale. Kf
gen Holzschnitt-WandbilJercrr-
'lich gar nicht einmal inEr«äps?
'e Verleger zu genau. Datbfc«
. erfuhr Geisberg zu
in der Absicht, ganze-W«^'
len Blättern jeden Fort***"
„•ir es also zu danken
nWeiditzunddasF«*»«*
(XL 24-39) j*t^»*l
bildungen besitzen, ^
^iden Breu, 0^
ien werden.
Ich hoffe,
zu können.
,t, dem KuPfel
lgenen An»«1
lehnet hatte.
Festschrift für Julius Schlosser zum 60. Ge-
burtstage. Herausgegeben von Arpad Weixlgärtner und
Leo Ptaniscig. Mit einem Bildnis und 112 Abbildungen
auf 54 Tafeln. Amalthea-Yetiag. Zürich,Leipzig,Wien. 1927.
An kunslhistorischen Kestschritten hat es in den letzten Jahren
keinen Mangel gegeben. Dem Nichtbeteiligten könnte die Zweckmäßigkeit
fraglich erscheinen, da neben wertvollen Beiträgen sich mancher rindet,
der nur diesem Anlaß sein Entstehen dankt. Der Wert muß daran gemes-
sen werden, ob sicli neben der äußeren Huldigung auch das echte Bekennt-
nis zu dem Lebenswerk des Gefeierten rindet, das zugleich eine innere
Stellungnahme bedeutet.
Der vorliegenden Festschrift wird man gerade dies zubilligen
müssen, daß die Persönlichkeit Julius Schlossers in ihrer Auswirkung auf
einen großen Kreis gleichgcsinnter Korscher klar und bedeutend hervor-
tritt. Das Bekenntnis gilt nicht einem bestimmten Programm, einer Methode,
einer Schulrichtung, sondern einer Persönlichkeit, die mitzufühlen weiß,
auch wenn sie sich vor der Welt verschließt, die Vergangenheit mit der
Besonnenheit und Kritik des Historikers erfaßt und sie doch neuzuerleben
versieht. In seiner Nähe wird nicht der Zwang einer Clique spürbar, die
mit Schlagworlen vergangenes Leben zu meistern versucht. Der einzelne
wird sich frei fühlen, seiner eigenen Individualität bewußt, was allein
einem Schülerverhältnis Wert verleiht. Die Schlosser-Festschrift führt den
Beweis, wie durch den geistigen Kontakt sich Neues entzündet, wie durch
die Auseinandersetzung mit den Worten des Meisters sich auch das
Gegensätzliche zum Worte meldet und sich im Feuer des Disputs zum
reinen Metall ausglüht.
In diesem Sinne beginnt Heinrich Gomperz die Festschrift mit
einer Klarlegung der ursprünglichen Bedeutung von Heraklits Worten:
;ot*Y|3Ct|jLYjv i^Liuy'izövt. Als »Ich habe mich selbst erforscht« steht es an
der Spitze von Schlossers »Lebenskommentar«. Gomperz erweitert es
durch Rekonstruktion des ursprünglichen Zusammenhanges zu dem be-
deutungsvollen Satz: Ich befragte mich selbst und von mir selbst habe
ich alles gelernt .
Auch bei Karl Voßlcr: >Cbcr Yergleichung und L'nvergleichlich-
keit der Künste- handelt es sich um eine Antithese. Schlosser hatte in
der «Kunst des Mittelalters« betont, daß die Zerspaltung der Kunst in
Gattungen eine Konvention bedeutet, hat vor allem den tiefen Zusammen-
hang von Sprache. Musik und bildender Kunst klargelegt. Sein eigenes
Lebenswerk zeugt von dem Streben, die große Einheit nicht aus dem Auge
zu verlieren. Die Einheit kommt aber nur in dem Anblick vieler Dinge
zum Bewußtsein. Das einzelne läßt tausend Möglichkeiten nach allen
Seiten offen. Was nun im besonderen die vergleichende Methode der Kunst-
geschichte anbelangt, so kann man sie das feinste und schärfste Werkzeug
nennen, das wir besitzen. Vergleiche, wie sie Karl Voll gebracht hat,
lassen das Echte und das nur Nachempfundene, die besonderen Absichten
des Künstlers wie den Charakter einer bestimmten Periode hervortreten.
Ja. man kann wohl sagen, daß der Grund der meisten kunstgeschichtlichen
Fehlurteile, insbesondere das Unvermögen, individuelle Leistung und
allgemeinen Zeitstil zu unterscheiden, nicht am Zuviel, sondern am Zu-
wenig an Vergleichen liegt. Trotzdem erscheint Vosslers Warnung berech-
tigt. Nur aus einer umfassenden Kenntnis einer Periode, unter Berück-
sichtigung der Vorbedingungen sollten Vergleiche aufgestellt und durch-
geführt werden. Je weiter Perioden zeitlich auseinanderliegen, je verschie-
dener die Vorbedingungen sind, desto zurückhaltender und skeptischer
sollte beim Vergleichen vorgegangen werden. Auch handelt es sich dabei
nur darum, eine Brücke zum Verständnis zu gewinnen. Es wird dem
Vergleich etwas Gewaltsames verbleiben, wobei das einzelne Kunstwerk
in seiner Wirkung verliert. Daher sollten sich wohl Überzeugungen beim
Vergleichen bilden, erleben aber kann man eine Leistung nur dann, wenn
man sich ganz in sie zu versetzen versteht und alles andere darüber
vergißt.
Für das Gebiet der graphischen Künste bietet die Festschrift eine
Anzahl von wertvollen Beiträgen, die schon ihrer systematischen Anlage
nach Anspruch auf allgemeine Würdigung haben. Auch hier haben die ein-
zelnen Forscher mit Stolz zeigen können, wie sehr sie Schlossers Denkweise
und Einstellung zu der eigenen gemacht haben. In seinem Aufsatz »Aller
Tugend und Laster Abbildung ^ gibt Fritz Saxl nicht nur eine Besehreibung
und Deutung der allegorischen Federzeichnungen einer deutschen Hand-
schrift vom Anfang des XV. Jahrhunderts in der Biblioteca Casanatense,
sondern geht auch im einzelnen dem Entstehen der spätmittelalterlichen
Bilderzyklen und dem Verhältnis von Wort- und Bildtradition nach, um
Verständnis für die moraltheologischen Gedankengänge dieser Zeit zu
gewinnen. Einen besonderen Wert haben die Zeichnungen auch in der
Hinsicht, als sie die Deutung für eine Anzahl von Nürnberger Holzschnitten
liefern, deren Inhalt bisher unklar geblieben war. Das neuerwachte Interesse
für die inhaltliche Bedeutung wird hoffentlich eines Tages dazu fuhren,
daß die Einzelergebnisse in einem großen ikonographischen Lexikon durch
die gemeinsame Arbeit einer größeren Anzahl von Spezialforschem zu-
sammengefaßt werden.
Auf das verwandte Gebiet der spätmittelalterlichen Rechtsallegoric
führt uns Kurt Käthe in seinem Beitrag, dem >Richter auf dem Fabeltier-.
In anziehender Weise versteht der Autor die Umbildung, Verschmelzung
und schließliche Auflösung seines Stoffes darzustellen. Den Ausgangs-
punkt bildet Dürers klassische Prägung in dem Stich der Gerechtigkeit,
den der Autor, Panofsky folgend, als apokalyptischen Weltenrichter und
zugleich als Gestirnsdämon, der auf seinem Tierkreiszeichen sitzt, charak-
terisiert. Auf welche Weise nun diese Bildvorstellung unter Abstreifung
des eigentlichen Sinnes weiterwirkt, zeigt der bisher nicht erkannte Zu-
sammenhang mit Leinbcrgers Darstellung des ungerechten Richters im
Nürnberger Rathaus, bei dem anstelle des Löwen der Greif als Symbol der
Geldgier der Behörden getreten ist. Aus Dürers »Sol iustitiae« ist ein
echt mittelalterliches >Lehrgemälde oder Beispiel- geworden.
Eine bedeutungsvolle Frage behandelt Arpad Weixlgärtner in
seinem »Alberto Duro«. Leider ist die Einwirkung der Kunst Dürers auf
Italien zu einem allzu aktuellen Problem geworden. Um so willkommener
wird die vorliegende Leistung sein, da sie sich von subjektiver Auffassung
fernhält und auf dem festen Boden der Quellenkunde und der Kenner-
schaft der Graphik bleibt. Im Geiste Schlossers zeichnet Weixlgärtner
ein anschauliches und klares Bild, wie verschieden und vielfältig das
Werk des Künstlers von den Italienern aufgenommen worden ist.
Erwin Panofsky weist in seinem Aufsatz »Die Pietä von Ubeda,
ein kleiner Beitrag zur Lösung der Sebastianofrage« in der angeblichen
Michelangelozeichnung im Louvre: Fr. 21 eine Studie zur Pietä Se-
bastianos in der Salvatorische zu Ubeda in Andalusien nach, wobei er von
einer Vermutung d'Achiardis ausgehen kann. Die Art der Beweisführung
muß im besondern in der Abgrenzung von Michelangelos und Sebastianos
zeichnerischem Stil als mustergültig bezeichnet werden.
Eine schwierige Frage wird von Ludwig Baldaß in seinem Beitrag
■ Drei deutsche Bildhauerzeichnungen« in Angriff genommen. Die Bild-
hauerzeichnung verrät sich ja durchaus nicht in jedem Fall durch pla-
stische Formengebung. Doch wird man Baldaß beipflichten müssen, daß
in den Zeichnungen eines SÜens, Arions und eines Reiters des Münchner
Kabinettcs Vorzeichnungen für Kleinbronzen der Vischer- Werkstätte
vorliegen, wenn auch die Zuschreihung an Hermann Vischel* zunächst
noch hypothetisch bleibt.
Hermann Egger geht in seinen äußerst methodisch angelegten
»Beiträgen zur Andrea Bregno-Forschung« von Zeichnungen des Wolf-
egger Skizzenbuches aus, nach denen der Antikenbesitz des Künstlers
und sein Haus an der Salitä di Monte Cavallo festgestellt werden kann.
Ferner weist Egger als das richtige Todesjahr 1503 nach. Nur durch eine
unrichtige Lesung des Epitaphs hat sich das Datum 1506 eingebürgert
und ist von einem Autor nach dem anderen kritiklos übernommen worden.
Dies Ergebnis kann über den Wert unserer kunsthistorischen Methoden
nachdenklich stimmen. Um so berechtigter darf sich an dieser Stelle der
Preis historisch und philologisch exakter Forschung dem Festeskranz
als ein weiteres Lorbeerblatt einfügen.
Die 26 Beiträge werden durch eine Bibliographie der bis zum
Festtage erschienenen Arbeiten des Jubilars aufs willkommenste er-
gänzt. Die Ausstattung des Bandes ist gediegen und geschmackvoll.
Außer Papier. Schrift und Einband sind vor allem die zahlreichen Ab-
bildungen zu loben, die, aut Kreidepapier gedruckt, meist zwar klein,
immer aber scharf sind. Der eifrige Verlag hat mit der Schlosser-Fest-
schrift Ehre eingelegt. Eberhard Hanpcl.
73
»tte """«gibt
*1
S.Ve^hene SiJ?**%
ksimile
gegeben. dieii *^:
Stil bij j.
dBehamenhvorfeneS[b^.
asB,attfijrdent ^
Jas kann nicht a "
den Zeichenstin
=hafstall verhält sich der Sfefe.
des nach BurglcmairssijrierteV..^
5sen Vanquete (1530t zu dm^
>n 1519. Von der ZaBfc^
Steiner dasselbe Sign™ ph^T
mit HS signiert -,djifu,s
in kennen zu lernen, auf die GsiK
rd, bin ich begierig. Xict wl
Rubrik Satrapitanus aufzolaseii:;
älteren \'ogtherr einzuteilen, «fe
Steiner ein Separatkonto rs ri
ir, mit der ich gar nichts «mfe
n.3
vorstehenden gegebenen Assis:
jber Gebühr betont, was von de ■-
ntlichung durch ihn zum est Ii
im. Dadurch wird aber dir Ort
stimmt. Dies geschiebt rieb*-'
gelangt. Es ist nicht leichtdasitri
:nis eher zu Ungunsten des .VeigtK
iertel der BlätterminienvordetM
der Größe der Originale. Kf
gen Holzschnitt-WandbilJercrr-
'lich gar nicht einmal inEr«äps?
'e Verleger zu genau. Datbfc«
. erfuhr Geisberg zu
in der Absicht, ganze-W«^'
len Blättern jeden Fort***"
„•ir es also zu danken
nWeiditzunddasF«*»«*
(XL 24-39) j*t^»*l
bildungen besitzen, ^
^iden Breu, 0^
ien werden.
Ich hoffe,
zu können.
,t, dem KuPfel
lgenen An»«1
lehnet hatte.
Festschrift für Julius Schlosser zum 60. Ge-
burtstage. Herausgegeben von Arpad Weixlgärtner und
Leo Ptaniscig. Mit einem Bildnis und 112 Abbildungen
auf 54 Tafeln. Amalthea-Yetiag. Zürich,Leipzig,Wien. 1927.
An kunslhistorischen Kestschritten hat es in den letzten Jahren
keinen Mangel gegeben. Dem Nichtbeteiligten könnte die Zweckmäßigkeit
fraglich erscheinen, da neben wertvollen Beiträgen sich mancher rindet,
der nur diesem Anlaß sein Entstehen dankt. Der Wert muß daran gemes-
sen werden, ob sicli neben der äußeren Huldigung auch das echte Bekennt-
nis zu dem Lebenswerk des Gefeierten rindet, das zugleich eine innere
Stellungnahme bedeutet.
Der vorliegenden Festschrift wird man gerade dies zubilligen
müssen, daß die Persönlichkeit Julius Schlossers in ihrer Auswirkung auf
einen großen Kreis gleichgcsinnter Korscher klar und bedeutend hervor-
tritt. Das Bekenntnis gilt nicht einem bestimmten Programm, einer Methode,
einer Schulrichtung, sondern einer Persönlichkeit, die mitzufühlen weiß,
auch wenn sie sich vor der Welt verschließt, die Vergangenheit mit der
Besonnenheit und Kritik des Historikers erfaßt und sie doch neuzuerleben
versieht. In seiner Nähe wird nicht der Zwang einer Clique spürbar, die
mit Schlagworlen vergangenes Leben zu meistern versucht. Der einzelne
wird sich frei fühlen, seiner eigenen Individualität bewußt, was allein
einem Schülerverhältnis Wert verleiht. Die Schlosser-Festschrift führt den
Beweis, wie durch den geistigen Kontakt sich Neues entzündet, wie durch
die Auseinandersetzung mit den Worten des Meisters sich auch das
Gegensätzliche zum Worte meldet und sich im Feuer des Disputs zum
reinen Metall ausglüht.
In diesem Sinne beginnt Heinrich Gomperz die Festschrift mit
einer Klarlegung der ursprünglichen Bedeutung von Heraklits Worten:
;ot*Y|3Ct|jLYjv i^Liuy'izövt. Als »Ich habe mich selbst erforscht« steht es an
der Spitze von Schlossers »Lebenskommentar«. Gomperz erweitert es
durch Rekonstruktion des ursprünglichen Zusammenhanges zu dem be-
deutungsvollen Satz: Ich befragte mich selbst und von mir selbst habe
ich alles gelernt .
Auch bei Karl Voßlcr: >Cbcr Yergleichung und L'nvergleichlich-
keit der Künste- handelt es sich um eine Antithese. Schlosser hatte in
der «Kunst des Mittelalters« betont, daß die Zerspaltung der Kunst in
Gattungen eine Konvention bedeutet, hat vor allem den tiefen Zusammen-
hang von Sprache. Musik und bildender Kunst klargelegt. Sein eigenes
Lebenswerk zeugt von dem Streben, die große Einheit nicht aus dem Auge
zu verlieren. Die Einheit kommt aber nur in dem Anblick vieler Dinge
zum Bewußtsein. Das einzelne läßt tausend Möglichkeiten nach allen
Seiten offen. Was nun im besonderen die vergleichende Methode der Kunst-
geschichte anbelangt, so kann man sie das feinste und schärfste Werkzeug
nennen, das wir besitzen. Vergleiche, wie sie Karl Voll gebracht hat,
lassen das Echte und das nur Nachempfundene, die besonderen Absichten
des Künstlers wie den Charakter einer bestimmten Periode hervortreten.
Ja. man kann wohl sagen, daß der Grund der meisten kunstgeschichtlichen
Fehlurteile, insbesondere das Unvermögen, individuelle Leistung und
allgemeinen Zeitstil zu unterscheiden, nicht am Zuviel, sondern am Zu-
wenig an Vergleichen liegt. Trotzdem erscheint Vosslers Warnung berech-
tigt. Nur aus einer umfassenden Kenntnis einer Periode, unter Berück-
sichtigung der Vorbedingungen sollten Vergleiche aufgestellt und durch-
geführt werden. Je weiter Perioden zeitlich auseinanderliegen, je verschie-
dener die Vorbedingungen sind, desto zurückhaltender und skeptischer
sollte beim Vergleichen vorgegangen werden. Auch handelt es sich dabei
nur darum, eine Brücke zum Verständnis zu gewinnen. Es wird dem
Vergleich etwas Gewaltsames verbleiben, wobei das einzelne Kunstwerk
in seiner Wirkung verliert. Daher sollten sich wohl Überzeugungen beim
Vergleichen bilden, erleben aber kann man eine Leistung nur dann, wenn
man sich ganz in sie zu versetzen versteht und alles andere darüber
vergißt.
Für das Gebiet der graphischen Künste bietet die Festschrift eine
Anzahl von wertvollen Beiträgen, die schon ihrer systematischen Anlage
nach Anspruch auf allgemeine Würdigung haben. Auch hier haben die ein-
zelnen Forscher mit Stolz zeigen können, wie sehr sie Schlossers Denkweise
und Einstellung zu der eigenen gemacht haben. In seinem Aufsatz »Aller
Tugend und Laster Abbildung ^ gibt Fritz Saxl nicht nur eine Besehreibung
und Deutung der allegorischen Federzeichnungen einer deutschen Hand-
schrift vom Anfang des XV. Jahrhunderts in der Biblioteca Casanatense,
sondern geht auch im einzelnen dem Entstehen der spätmittelalterlichen
Bilderzyklen und dem Verhältnis von Wort- und Bildtradition nach, um
Verständnis für die moraltheologischen Gedankengänge dieser Zeit zu
gewinnen. Einen besonderen Wert haben die Zeichnungen auch in der
Hinsicht, als sie die Deutung für eine Anzahl von Nürnberger Holzschnitten
liefern, deren Inhalt bisher unklar geblieben war. Das neuerwachte Interesse
für die inhaltliche Bedeutung wird hoffentlich eines Tages dazu fuhren,
daß die Einzelergebnisse in einem großen ikonographischen Lexikon durch
die gemeinsame Arbeit einer größeren Anzahl von Spezialforschem zu-
sammengefaßt werden.
Auf das verwandte Gebiet der spätmittelalterlichen Rechtsallegoric
führt uns Kurt Käthe in seinem Beitrag, dem >Richter auf dem Fabeltier-.
In anziehender Weise versteht der Autor die Umbildung, Verschmelzung
und schließliche Auflösung seines Stoffes darzustellen. Den Ausgangs-
punkt bildet Dürers klassische Prägung in dem Stich der Gerechtigkeit,
den der Autor, Panofsky folgend, als apokalyptischen Weltenrichter und
zugleich als Gestirnsdämon, der auf seinem Tierkreiszeichen sitzt, charak-
terisiert. Auf welche Weise nun diese Bildvorstellung unter Abstreifung
des eigentlichen Sinnes weiterwirkt, zeigt der bisher nicht erkannte Zu-
sammenhang mit Leinbcrgers Darstellung des ungerechten Richters im
Nürnberger Rathaus, bei dem anstelle des Löwen der Greif als Symbol der
Geldgier der Behörden getreten ist. Aus Dürers »Sol iustitiae« ist ein
echt mittelalterliches >Lehrgemälde oder Beispiel- geworden.
Eine bedeutungsvolle Frage behandelt Arpad Weixlgärtner in
seinem »Alberto Duro«. Leider ist die Einwirkung der Kunst Dürers auf
Italien zu einem allzu aktuellen Problem geworden. Um so willkommener
wird die vorliegende Leistung sein, da sie sich von subjektiver Auffassung
fernhält und auf dem festen Boden der Quellenkunde und der Kenner-
schaft der Graphik bleibt. Im Geiste Schlossers zeichnet Weixlgärtner
ein anschauliches und klares Bild, wie verschieden und vielfältig das
Werk des Künstlers von den Italienern aufgenommen worden ist.
Erwin Panofsky weist in seinem Aufsatz »Die Pietä von Ubeda,
ein kleiner Beitrag zur Lösung der Sebastianofrage« in der angeblichen
Michelangelozeichnung im Louvre: Fr. 21 eine Studie zur Pietä Se-
bastianos in der Salvatorische zu Ubeda in Andalusien nach, wobei er von
einer Vermutung d'Achiardis ausgehen kann. Die Art der Beweisführung
muß im besondern in der Abgrenzung von Michelangelos und Sebastianos
zeichnerischem Stil als mustergültig bezeichnet werden.
Eine schwierige Frage wird von Ludwig Baldaß in seinem Beitrag
■ Drei deutsche Bildhauerzeichnungen« in Angriff genommen. Die Bild-
hauerzeichnung verrät sich ja durchaus nicht in jedem Fall durch pla-
stische Formengebung. Doch wird man Baldaß beipflichten müssen, daß
in den Zeichnungen eines SÜens, Arions und eines Reiters des Münchner
Kabinettcs Vorzeichnungen für Kleinbronzen der Vischer- Werkstätte
vorliegen, wenn auch die Zuschreihung an Hermann Vischel* zunächst
noch hypothetisch bleibt.
Hermann Egger geht in seinen äußerst methodisch angelegten
»Beiträgen zur Andrea Bregno-Forschung« von Zeichnungen des Wolf-
egger Skizzenbuches aus, nach denen der Antikenbesitz des Künstlers
und sein Haus an der Salitä di Monte Cavallo festgestellt werden kann.
Ferner weist Egger als das richtige Todesjahr 1503 nach. Nur durch eine
unrichtige Lesung des Epitaphs hat sich das Datum 1506 eingebürgert
und ist von einem Autor nach dem anderen kritiklos übernommen worden.
Dies Ergebnis kann über den Wert unserer kunsthistorischen Methoden
nachdenklich stimmen. Um so berechtigter darf sich an dieser Stelle der
Preis historisch und philologisch exakter Forschung dem Festeskranz
als ein weiteres Lorbeerblatt einfügen.
Die 26 Beiträge werden durch eine Bibliographie der bis zum
Festtage erschienenen Arbeiten des Jubilars aufs willkommenste er-
gänzt. Die Ausstattung des Bandes ist gediegen und geschmackvoll.
Außer Papier. Schrift und Einband sind vor allem die zahlreichen Ab-
bildungen zu loben, die, aut Kreidepapier gedruckt, meist zwar klein,
immer aber scharf sind. Der eifrige Verlag hat mit der Schlosser-Fest-
schrift Ehre eingelegt. Eberhard Hanpcl.
73