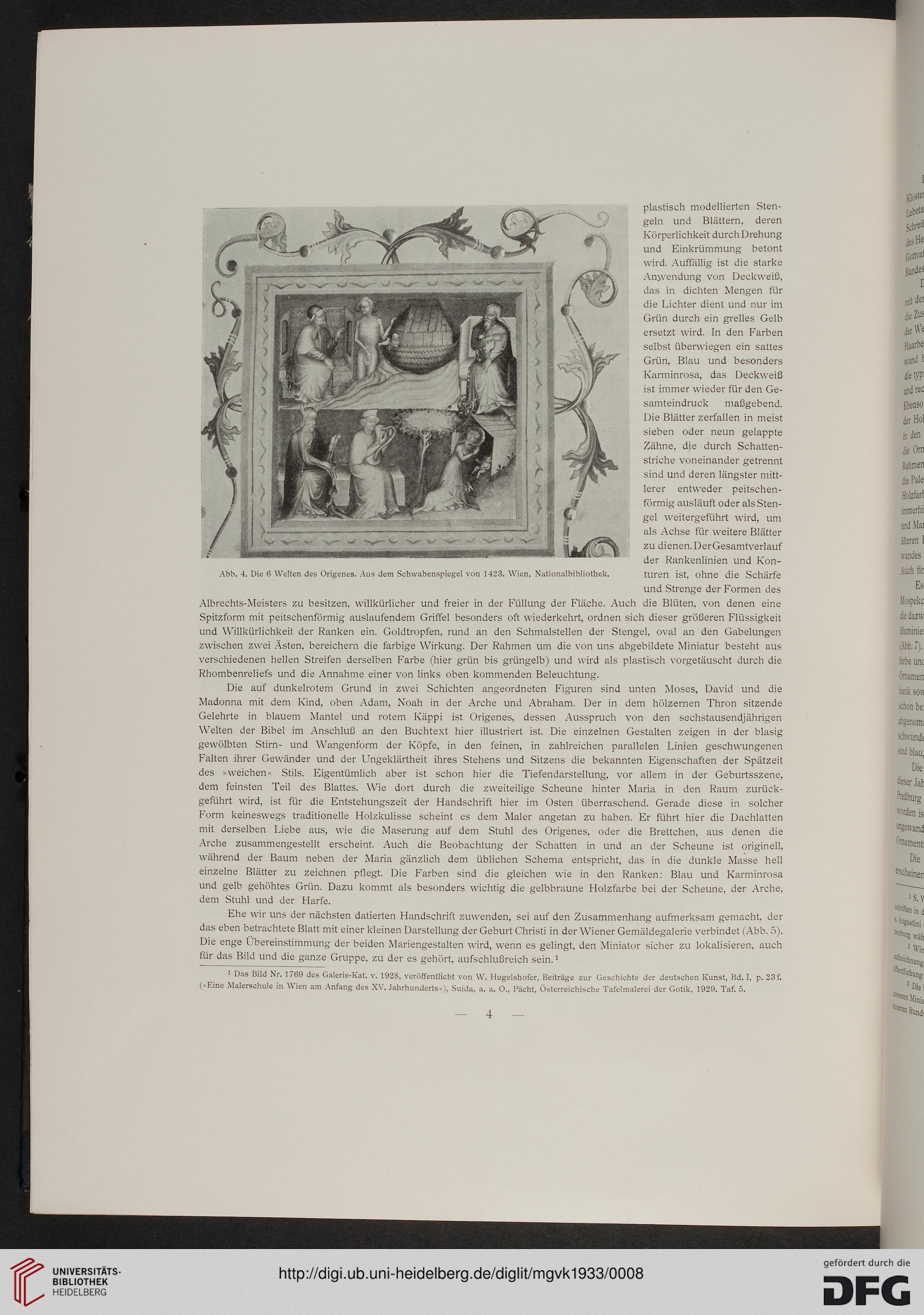Abb. 4. Die 6 Welten des Origenes. Aus dem Schwabenspiegel von 1423. Wien, Nationalbibliothek.
plastisch modellierten Sten-
geln und Blättern, deren
Körperlichkeit durch Drehung
und Einkrümmung betont
wird. Auffällig ist die starke
Anwendung von Deckweiß,
das in dichten Mengen für
die Lichter dient und nur im
Grün durch ein grelles Gelb
ersetzt wird. In den Farben
selbst überwiegen ein sattes
Grün, Blau und besonders
Karminrosa, das Deckweiß
ist immer wieder für den Ge-
samteindruck maßgebend.
Die Blätter zerfallen in meist
sieben oder neun gelappte
Zähne, die durch Schatten-
striche voneinander getrennt
sind und deren längster mitt-
lerer entweder peitschen-
förmig ausläuft oder als Sten-
gel weitergeführt wird, um
als Achse für weitere Blätter
zu dienen.DerGesamtverlauf
der Rankenlinien und Kon-
turen ist, ohne die Schärfe
und Strenge der Formen des
Albrechts-Meisters zu besitzen, willkürlicher und freier in der Füllung der Fläche. Auch die Blüten, von denen eine
Spitzform mit peitschenförmig auslaufendem Griffel besonders oft wiederkehrt, ordnen sich dieser größeren Flüssigkeit
und Willkürlichkeit der Ranken ein. Goldtropfen, rund an den Schmalstellen der Stengel, oval an den Gabelungen
zwischen zwei Asten, bereichern die farbige Wirkung. Der Rahmen um die von uns abgebildete Miniatur besteht aus
verschiedenen hellen Streifen derselben Farbe (hier grün bis grüngelb) und wird als plastisch vorgetäuscht durch die
Rhombenreliefs und die Annahme einer von links oben kommenden Beleuchtung.
Die auf dunkelrotem Grund in zwei Schichten angeordneten Figuren sind unten Moses, David und die
Madonna mit dem Kind, oben Adam, Noah in der Arche und Abraham. Der in dem hölzernen Thron sitzende
Gelehrte in blauem Mantel und rotem Käppi ist Origenes, dessen Ausspruch von den sechstausendjährigen
Welten der Bibel im Anschluß an den Buchtext hier illustriert ist. Die einzelnen Gestalten zeigen in der blasig
gewölbten Stirn- und Wangenform der Köpfe, in den feinen, in zahlreichen parallelen Linien geschwungenen
Falten ihrer Gewänder und der Ungeklärtheit ihres Stehens und Sitzens die bekannten Eigenschaften der Spätzeit
des »weichen« Stils. Eigentümlich aber ist schon hier die Tiefendarstellung, vor allem in der Geburtsszene,
dem feinsten Teil des Blattes. Wie dort durch die zweiteilige Scheune hinter Maria in den Raum zurück-
geführt wird, ist für die Entstehungszeit der Handschrift hier im Osten überraschend. Gerade diese in solcher
Form keineswegs traditionelle Holzkulisse scheint es dem Maler angetan zu haben. Er führt hier die Dachlatten
mit derselben Liebe aus, wie die Maserung auf dem Stuhl des Origenes, oder die Brettchen, aus denen die
Arche zusammengestellt erscheint. Auch die Beobachtung der Schatten in und an der Scheune ist originell,
während der Baum neben der Maria gänzlich dem üblichen Schema entspricht, das in die dunkle Masse hell
einzelne Blätter zu zeichnen pflegt. Die Farben sind die gleichen wie in den Ranken: Blau und Karminrosa
und gelb gehöhtes Grün. Dazu kommt als besonders wichtig die gelbbraune Holzfarbe bei der Scheune, der Arche,
dem Stuhl und der Harfe.
Ehe wir uns der nächsten datierten Handschrift zuwenden, sei auf den Zusammenhang aufmerksam gemacht, der
das eben betrachtete Blatt mit einer kleinen Darstellung der Geburt Christi in der Wiener Gemäldegalerie verbindet (Abb. 5).
Die enge Übereinstimmung der beiden Mariengestalten wird, wenn es gelingt, den Miniator sicher zu lokalisieren, auch
für das Bild und die ganze Gruppe, zu der es gehört, aufschlußreich sein.1
1 Das Bild Nr. 1769 des Galerie-Kat. v. 1928, veröffentlicht von W. Hugelshofer, Beiträge zur Geschichte der deutschen Kunst, Bd. I, p. 23 f.
(•Eine Malerschule in Wien am Anfang des XV. Jahrhunderts«), Suida, a. a. 0., Pacht, Österreichische Tafelmalerei der Gotik, 1929. Taf. 5.
plastisch modellierten Sten-
geln und Blättern, deren
Körperlichkeit durch Drehung
und Einkrümmung betont
wird. Auffällig ist die starke
Anwendung von Deckweiß,
das in dichten Mengen für
die Lichter dient und nur im
Grün durch ein grelles Gelb
ersetzt wird. In den Farben
selbst überwiegen ein sattes
Grün, Blau und besonders
Karminrosa, das Deckweiß
ist immer wieder für den Ge-
samteindruck maßgebend.
Die Blätter zerfallen in meist
sieben oder neun gelappte
Zähne, die durch Schatten-
striche voneinander getrennt
sind und deren längster mitt-
lerer entweder peitschen-
förmig ausläuft oder als Sten-
gel weitergeführt wird, um
als Achse für weitere Blätter
zu dienen.DerGesamtverlauf
der Rankenlinien und Kon-
turen ist, ohne die Schärfe
und Strenge der Formen des
Albrechts-Meisters zu besitzen, willkürlicher und freier in der Füllung der Fläche. Auch die Blüten, von denen eine
Spitzform mit peitschenförmig auslaufendem Griffel besonders oft wiederkehrt, ordnen sich dieser größeren Flüssigkeit
und Willkürlichkeit der Ranken ein. Goldtropfen, rund an den Schmalstellen der Stengel, oval an den Gabelungen
zwischen zwei Asten, bereichern die farbige Wirkung. Der Rahmen um die von uns abgebildete Miniatur besteht aus
verschiedenen hellen Streifen derselben Farbe (hier grün bis grüngelb) und wird als plastisch vorgetäuscht durch die
Rhombenreliefs und die Annahme einer von links oben kommenden Beleuchtung.
Die auf dunkelrotem Grund in zwei Schichten angeordneten Figuren sind unten Moses, David und die
Madonna mit dem Kind, oben Adam, Noah in der Arche und Abraham. Der in dem hölzernen Thron sitzende
Gelehrte in blauem Mantel und rotem Käppi ist Origenes, dessen Ausspruch von den sechstausendjährigen
Welten der Bibel im Anschluß an den Buchtext hier illustriert ist. Die einzelnen Gestalten zeigen in der blasig
gewölbten Stirn- und Wangenform der Köpfe, in den feinen, in zahlreichen parallelen Linien geschwungenen
Falten ihrer Gewänder und der Ungeklärtheit ihres Stehens und Sitzens die bekannten Eigenschaften der Spätzeit
des »weichen« Stils. Eigentümlich aber ist schon hier die Tiefendarstellung, vor allem in der Geburtsszene,
dem feinsten Teil des Blattes. Wie dort durch die zweiteilige Scheune hinter Maria in den Raum zurück-
geführt wird, ist für die Entstehungszeit der Handschrift hier im Osten überraschend. Gerade diese in solcher
Form keineswegs traditionelle Holzkulisse scheint es dem Maler angetan zu haben. Er führt hier die Dachlatten
mit derselben Liebe aus, wie die Maserung auf dem Stuhl des Origenes, oder die Brettchen, aus denen die
Arche zusammengestellt erscheint. Auch die Beobachtung der Schatten in und an der Scheune ist originell,
während der Baum neben der Maria gänzlich dem üblichen Schema entspricht, das in die dunkle Masse hell
einzelne Blätter zu zeichnen pflegt. Die Farben sind die gleichen wie in den Ranken: Blau und Karminrosa
und gelb gehöhtes Grün. Dazu kommt als besonders wichtig die gelbbraune Holzfarbe bei der Scheune, der Arche,
dem Stuhl und der Harfe.
Ehe wir uns der nächsten datierten Handschrift zuwenden, sei auf den Zusammenhang aufmerksam gemacht, der
das eben betrachtete Blatt mit einer kleinen Darstellung der Geburt Christi in der Wiener Gemäldegalerie verbindet (Abb. 5).
Die enge Übereinstimmung der beiden Mariengestalten wird, wenn es gelingt, den Miniator sicher zu lokalisieren, auch
für das Bild und die ganze Gruppe, zu der es gehört, aufschlußreich sein.1
1 Das Bild Nr. 1769 des Galerie-Kat. v. 1928, veröffentlicht von W. Hugelshofer, Beiträge zur Geschichte der deutschen Kunst, Bd. I, p. 23 f.
(•Eine Malerschule in Wien am Anfang des XV. Jahrhunderts«), Suida, a. a. 0., Pacht, Österreichische Tafelmalerei der Gotik, 1929. Taf. 5.