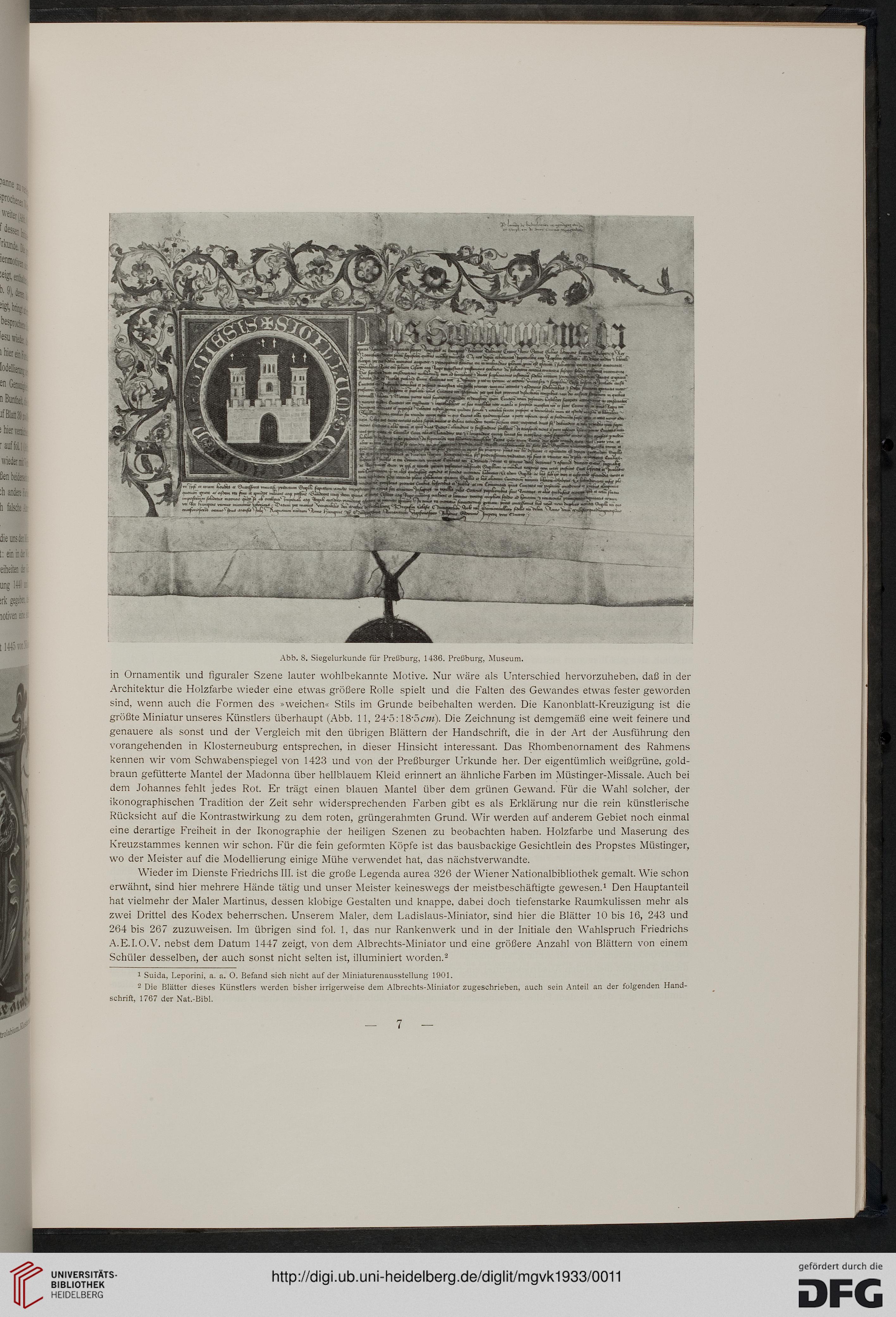-Hfi-—- c--r-TS- f-^<^r~— «^i-c-^-rt. ._tZfr.ai.tlxr
** t-«r«~ ■ ■ i*. T. — •
W Ii >^M« -T .»Twin. ^ ^1 ■ ■NBj fr, fli
Abb. 8. Siegelurkunde für Preliburg, 1436. Prellburg, Museum.
in Ornamentik und figuraler Szene lauter wohlbekannte Motive. Nur wäre als Unterschied hervorzuheben, daß in der
Architektur die Holzfarbe wieder eine etwas größere Rolle spielt und die Falten des Gewandes etwas fester geworden
sind, wenn auch die Formen des »weichen« Stils im Grunde beibehalten werden. Die Kanonblatt-Kreuzigung ist die
größte Miniatur unseres Künstlers überhaupt (Abb. 11, 24'5:18'5cm). Die Zeichnung ist demgemäß eine weit feinere und
genauere als sonst und der Vergleich mit den übrigen Blättern der Handschrift, die in der Art der Ausführung den
vorangehenden in Klosterneuburg entsprechen, in dieser Hinsicht interessant. Das Rhombenornament des Rahmens
kennen wir vom Schwabenspiegel von 1423 und von der Preßburger Urkunde her. Der eigentümlich weißgrüne, gold-
braun gefütterte Mantel der Madonna über hellblauem Kleid erinnert an ähnliche Farben im Müstinger-Missale. Auch bei
dem Johannes fehlt jedes Rot. Er trägt einen blauen Mantel über dem grünen Gewand. Für die Wahl solcher, der
ikonographischen Tradition der Zeit sehr widersprechenden Farben gibt es als Erklärung nur die rein künstlerische
Rücksicht auf die Kontrastwirkung zu dem roten, grüngerahmten Grund. Wir werden auf anderem Gebiet noch einmal
eine derartige Freiheit in der Ikonographie der heiligen Szenen zu beobachten haben. Holzfarbe und Maserung des
Kreuzstammes kennen wir schon. Für die fein geformten Köpfe ist das bausbackige Gesichtlein des Propstes Müstinger,
wo der Meister auf die Modellierung einige Mühe verwendet hat, das nächstverwandte.
Wieder im Dienste Friedrichs III. ist die große Legenda aurea 326 der Wiener Nationalbibliothek gemalt. Wie schon
erwähnt, sind hier mehrere Hände tätig und unser Meister keineswegs der meistbeschäftigte gewesen.1 Den Hauptanteil
hat vielmehr der Maler Martinus, dessen klobige Gestalten und knappe, dabei doch tiefenstarke Raumkulissen mehr als
zwei Drittel des Kodex beherrschen. Unserem Maler, dem Ladislaus-Miniator, sind hier die Blätter 10 bis 16, 243 und
264 bis 267 zuzuweisen. Im übrigen sind fol. 1, das nur Rankenwerk und in der Initiale den Wahlspruch Friedrichs
A.E.I.O.V. nebst dem Datum 1447 zeigt, von dem Albrechts-Miniator und eine größere Anzahl von Blättern von einem
Schüler desselben, der auch sonst nicht selten ist, illuminiert worden.2
1 Suida, Leporini, a. a. O. Befand sich nicht auf der Miniaturenausstellung 1901.
2 Die Blätter dieses Künstlers werden bisher irrigerweise dem Albrechts-Miniator zugeschrieben, auch sein Anteil an der folgenden Hand-
schrift, 1767 der Xat.-Bibl.
— 7 —
** t-«r«~ ■ ■ i*. T. — •
W Ii >^M« -T .»Twin. ^ ^1 ■ ■NBj fr, fli
Abb. 8. Siegelurkunde für Preliburg, 1436. Prellburg, Museum.
in Ornamentik und figuraler Szene lauter wohlbekannte Motive. Nur wäre als Unterschied hervorzuheben, daß in der
Architektur die Holzfarbe wieder eine etwas größere Rolle spielt und die Falten des Gewandes etwas fester geworden
sind, wenn auch die Formen des »weichen« Stils im Grunde beibehalten werden. Die Kanonblatt-Kreuzigung ist die
größte Miniatur unseres Künstlers überhaupt (Abb. 11, 24'5:18'5cm). Die Zeichnung ist demgemäß eine weit feinere und
genauere als sonst und der Vergleich mit den übrigen Blättern der Handschrift, die in der Art der Ausführung den
vorangehenden in Klosterneuburg entsprechen, in dieser Hinsicht interessant. Das Rhombenornament des Rahmens
kennen wir vom Schwabenspiegel von 1423 und von der Preßburger Urkunde her. Der eigentümlich weißgrüne, gold-
braun gefütterte Mantel der Madonna über hellblauem Kleid erinnert an ähnliche Farben im Müstinger-Missale. Auch bei
dem Johannes fehlt jedes Rot. Er trägt einen blauen Mantel über dem grünen Gewand. Für die Wahl solcher, der
ikonographischen Tradition der Zeit sehr widersprechenden Farben gibt es als Erklärung nur die rein künstlerische
Rücksicht auf die Kontrastwirkung zu dem roten, grüngerahmten Grund. Wir werden auf anderem Gebiet noch einmal
eine derartige Freiheit in der Ikonographie der heiligen Szenen zu beobachten haben. Holzfarbe und Maserung des
Kreuzstammes kennen wir schon. Für die fein geformten Köpfe ist das bausbackige Gesichtlein des Propstes Müstinger,
wo der Meister auf die Modellierung einige Mühe verwendet hat, das nächstverwandte.
Wieder im Dienste Friedrichs III. ist die große Legenda aurea 326 der Wiener Nationalbibliothek gemalt. Wie schon
erwähnt, sind hier mehrere Hände tätig und unser Meister keineswegs der meistbeschäftigte gewesen.1 Den Hauptanteil
hat vielmehr der Maler Martinus, dessen klobige Gestalten und knappe, dabei doch tiefenstarke Raumkulissen mehr als
zwei Drittel des Kodex beherrschen. Unserem Maler, dem Ladislaus-Miniator, sind hier die Blätter 10 bis 16, 243 und
264 bis 267 zuzuweisen. Im übrigen sind fol. 1, das nur Rankenwerk und in der Initiale den Wahlspruch Friedrichs
A.E.I.O.V. nebst dem Datum 1447 zeigt, von dem Albrechts-Miniator und eine größere Anzahl von Blättern von einem
Schüler desselben, der auch sonst nicht selten ist, illuminiert worden.2
1 Suida, Leporini, a. a. O. Befand sich nicht auf der Miniaturenausstellung 1901.
2 Die Blätter dieses Künstlers werden bisher irrigerweise dem Albrechts-Miniator zugeschrieben, auch sein Anteil an der folgenden Hand-
schrift, 1767 der Xat.-Bibl.
— 7 —