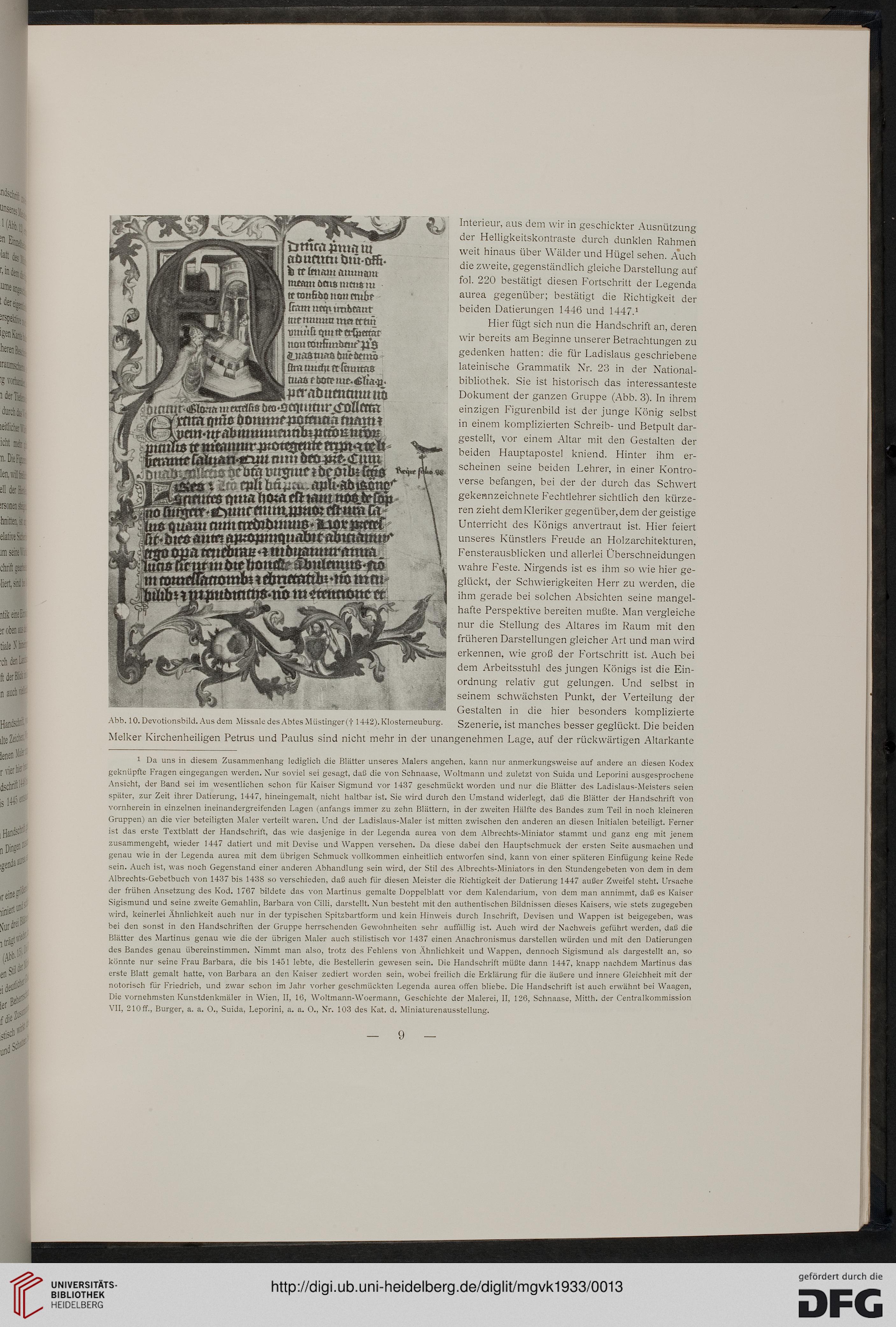tmtriifcmiitu
(löumtxttjiöoffi-
tr fatiui! ftittntam
ttttmti öni»nmi»tu
trtonfiboimii mibf
Jmmnnptmbrant
mrmuutamftttttn
umittinitrtt-erfocfKtr
tum rotrfitn&titr'^iö
$_m*8taine bttt&miö
Bmimditttfijmcis
tiMiiftotritir.<6lta-}i.
r «ßlorm in «rrtß» 5ro-Ö01litnir(jDÄCltil
jrtim nitre öommfflqönaa fumtt?
fctlaiUMQtttmm öttuttfigrmu
Interieur, aus dem wir in geschickter Ausnützung
der Helligkeitskontraste durch dunklen Rahmen
weit hinaus über Wälder und Hügel sehen. Auch
die zweite, gegenständlich gleiche Darstellung auf
fol. 220 bestätigt diesen Fortschritt der Legenda
aurea gegenüber; bestätigt die Richtigkeit der
beiden Datierungen 1446 und 1447.1
Hier fügt sich nun die Handschrift an, deren
wir bereits am Beginne unserer Betrachtungen zu
gedenken hatten: die für Ladislaus geschriebene
lateinische Grammatik Nr. 23 in der National-
bibliothek. Sie ist historisch das interessanteste
Dokument der ganzen Gruppe (Abb. 3). In ihrem
einzigen Figurenbild ist der junge König selbst
in einem komplizierten Schreib- und Betpult dar-
gestellt, vor einem Altar mit den Gestalten der
beiden Hauptapostel kniend. Hinter ihm er-
scheinen seine beiden Lehrer, in einer Kontro-
verse befangen, bei der der durch das Schwert
gekennzeichnete Fechtlehrer sichtlich den kürze-
ren zieht dem Kleriker gegenüber, dem der geistige
Unterricht des Königs anvertraut ist. Hier feiert
unseres Künstlers Freude an Holzarchitekturen,
Fensterausblicken und allerlei Überschneidungen
wahre Feste. Nirgends ist es ihm so wie hier ge-
glückt, der Schwierigkeiten Herr zu werden, die
ihm gerade bei solchen Absichten seine mangel-
hafte Perspektive bereiten mußte. Man vergleiche
nur die Stellung des Altares im Raum mit den
früheren Darstellungen gleicher Art und man wird
erkennen, wie groß der Fortschritt ist. Auch bei
dem Arbeitsstuhl des jungen Königs ist die Ein-
ordnung relativ gut gelungen. Und selbst in
seinem schwächsten Punkt, der Verteilung der
Gestalten in die hier besonders komplizierte
Abb. 10. Devotionsbild. Aus dem Missale des Abtes Müstfagerfl-1442). Klosterneuburg. Szenerie, ist manches besser geglückt. Die beiden
Melker Kirchenheiligen Petrus und Paulus sind nicht mehr in der unangenehmen Lage, auf der rückwärtigen Altarkante
$ öjitmt nun ntinönmiß - fcio t jKftrf
1 Da uns in diesem Zusammenhang lediglicli die Blatter unseres Malers angehen, kann nur anmerkungsweise auf andere an diesen Kodex
geknüpfte Fragen eingegangen werden. Nur soviel sei gesagt, daß die von Schnaase, Woltmann und zuletzt von Suida und Leporini ausgesprochene
Ansicht, der Band sei im wesentlichen schon für Kaiser Sigmund vor 1437 geschmückt worden und nur die Blätter des Ladislaus-Meisters seien
später, zur Zeit ihrer Datierung, 1447, hineingemalt, nicht haltbar ist. Sie wird durch den Umstand widerlegt, daß die Blätter der Handschrift von
vornherein in einzelnen ineinandergreifenden Lagen (anfangs immer zu zehn Blättern, in der zweiten Hälfte des Bandes zum Teil in noch kleineren
Gruppen) an die vier beteiligten Maler verteilt waren. Und der Ladislaus-Maler ist mitten zwischen den anderen an diesen Initialen beteiligt. Ferner
ist das erste Textblatt der Handschrift, das wie dasjenige in der Legenda aurea von dem Albrechts-Miniator stammt und ganz eng mit jenem
zusammengeht, wieder 1447 datiert und mit Devise und Wappen versehen. Da diese dabei den Hauptschmuck der ersten Seite ausmachen und
genau wie in der Legenda aurea mit dem übrigen Schmuck vollkommen einheitlich entworfen sind, kann von einer späteren Einfügung keine Rede
sein. Auch ist, was noch Gegenstand einer anderen Abhandlung sein wird, der Stil des Albrechts-Miniators in den Stundengebeten von dem in dem
Albrechts-Gebetbuch von 1437 bis 1438 so verschieden, daß auch für diesen Meister die Richtigkeit der Datierung 1447 außer Zweifel steht. Ursache
der frühen Ansetzung des Kod. 1767 bildete das von Martinus gemalte Doppelblatt vor dem Kalendarium, von dem man annimmt, daß es Kaiser
Sigismund und seine zweite Gemahlin, Barbara von Cilli, darstellt. Nun besteht mit den authentischen Bildnissen dieses Kaisers, wie stets zugegeben
wird, keinerlei Ähnlichkeit auch nur in der typischen Spitzbartform und kein Hinweis durch Inschrift, Devisen und Wappen ist beigegeben, was
bei den sonst in den Handschriften der Gruppe herrschenden Gewohnheiten sehr auffällig ist. Auch wird der Nachweis geführt werden, daß die
Blätter des Martinus genau wie die der übrigen Maler auch stilistisch vor 1437 einen Anachronismus darstellen würden und mit den Datierungen
des Bandes genau übereinstimmen. Nimmt man also, trotz des Fehlens von Ähnlichkeit und Wappen, dennoch Sigismund als dargestellt an. so
könnte nur seine Frau Barbara, die bis 1451 lebte, die Bestellerin gewesen sein. Die Handschrift müßte dann 1447, knapp nachdem Martinus das
erste Blatt gemalt hatte, von Barbara an den Kaiser zediert worden sein, wobei freilich die Erklärung für die äußere und innere Gleichheit mit der
notorisch für Friedrich, und zwar schon im Jahr vorher geschmückten Legenda aurea offen bliebe. Die Handschrift ist auch erwähnt bei Waagen,
Die vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien, II, 16, Woltmann-Woermann, Geschichte der Malerei, II, 126, Schnaase, Mitth. der Centraikommission
VII, 210 ff., Burger, a. a. O., Suida, Leporini, a. a. 0., Nr. 103 des Kat. d. Miniaturenausstellung.
— 9 —
(löumtxttjiöoffi-
tr fatiui! ftittntam
ttttmti öni»nmi»tu
trtonfiboimii mibf
Jmmnnptmbrant
mrmuutamftttttn
umittinitrtt-erfocfKtr
tum rotrfitn&titr'^iö
$_m*8taine bttt&miö
Bmimditttfijmcis
tiMiiftotritir.<6lta-}i.
r «ßlorm in «rrtß» 5ro-Ö01litnir(jDÄCltil
jrtim nitre öommfflqönaa fumtt?
fctlaiUMQtttmm öttuttfigrmu
Interieur, aus dem wir in geschickter Ausnützung
der Helligkeitskontraste durch dunklen Rahmen
weit hinaus über Wälder und Hügel sehen. Auch
die zweite, gegenständlich gleiche Darstellung auf
fol. 220 bestätigt diesen Fortschritt der Legenda
aurea gegenüber; bestätigt die Richtigkeit der
beiden Datierungen 1446 und 1447.1
Hier fügt sich nun die Handschrift an, deren
wir bereits am Beginne unserer Betrachtungen zu
gedenken hatten: die für Ladislaus geschriebene
lateinische Grammatik Nr. 23 in der National-
bibliothek. Sie ist historisch das interessanteste
Dokument der ganzen Gruppe (Abb. 3). In ihrem
einzigen Figurenbild ist der junge König selbst
in einem komplizierten Schreib- und Betpult dar-
gestellt, vor einem Altar mit den Gestalten der
beiden Hauptapostel kniend. Hinter ihm er-
scheinen seine beiden Lehrer, in einer Kontro-
verse befangen, bei der der durch das Schwert
gekennzeichnete Fechtlehrer sichtlich den kürze-
ren zieht dem Kleriker gegenüber, dem der geistige
Unterricht des Königs anvertraut ist. Hier feiert
unseres Künstlers Freude an Holzarchitekturen,
Fensterausblicken und allerlei Überschneidungen
wahre Feste. Nirgends ist es ihm so wie hier ge-
glückt, der Schwierigkeiten Herr zu werden, die
ihm gerade bei solchen Absichten seine mangel-
hafte Perspektive bereiten mußte. Man vergleiche
nur die Stellung des Altares im Raum mit den
früheren Darstellungen gleicher Art und man wird
erkennen, wie groß der Fortschritt ist. Auch bei
dem Arbeitsstuhl des jungen Königs ist die Ein-
ordnung relativ gut gelungen. Und selbst in
seinem schwächsten Punkt, der Verteilung der
Gestalten in die hier besonders komplizierte
Abb. 10. Devotionsbild. Aus dem Missale des Abtes Müstfagerfl-1442). Klosterneuburg. Szenerie, ist manches besser geglückt. Die beiden
Melker Kirchenheiligen Petrus und Paulus sind nicht mehr in der unangenehmen Lage, auf der rückwärtigen Altarkante
$ öjitmt nun ntinönmiß - fcio t jKftrf
1 Da uns in diesem Zusammenhang lediglicli die Blatter unseres Malers angehen, kann nur anmerkungsweise auf andere an diesen Kodex
geknüpfte Fragen eingegangen werden. Nur soviel sei gesagt, daß die von Schnaase, Woltmann und zuletzt von Suida und Leporini ausgesprochene
Ansicht, der Band sei im wesentlichen schon für Kaiser Sigmund vor 1437 geschmückt worden und nur die Blätter des Ladislaus-Meisters seien
später, zur Zeit ihrer Datierung, 1447, hineingemalt, nicht haltbar ist. Sie wird durch den Umstand widerlegt, daß die Blätter der Handschrift von
vornherein in einzelnen ineinandergreifenden Lagen (anfangs immer zu zehn Blättern, in der zweiten Hälfte des Bandes zum Teil in noch kleineren
Gruppen) an die vier beteiligten Maler verteilt waren. Und der Ladislaus-Maler ist mitten zwischen den anderen an diesen Initialen beteiligt. Ferner
ist das erste Textblatt der Handschrift, das wie dasjenige in der Legenda aurea von dem Albrechts-Miniator stammt und ganz eng mit jenem
zusammengeht, wieder 1447 datiert und mit Devise und Wappen versehen. Da diese dabei den Hauptschmuck der ersten Seite ausmachen und
genau wie in der Legenda aurea mit dem übrigen Schmuck vollkommen einheitlich entworfen sind, kann von einer späteren Einfügung keine Rede
sein. Auch ist, was noch Gegenstand einer anderen Abhandlung sein wird, der Stil des Albrechts-Miniators in den Stundengebeten von dem in dem
Albrechts-Gebetbuch von 1437 bis 1438 so verschieden, daß auch für diesen Meister die Richtigkeit der Datierung 1447 außer Zweifel steht. Ursache
der frühen Ansetzung des Kod. 1767 bildete das von Martinus gemalte Doppelblatt vor dem Kalendarium, von dem man annimmt, daß es Kaiser
Sigismund und seine zweite Gemahlin, Barbara von Cilli, darstellt. Nun besteht mit den authentischen Bildnissen dieses Kaisers, wie stets zugegeben
wird, keinerlei Ähnlichkeit auch nur in der typischen Spitzbartform und kein Hinweis durch Inschrift, Devisen und Wappen ist beigegeben, was
bei den sonst in den Handschriften der Gruppe herrschenden Gewohnheiten sehr auffällig ist. Auch wird der Nachweis geführt werden, daß die
Blätter des Martinus genau wie die der übrigen Maler auch stilistisch vor 1437 einen Anachronismus darstellen würden und mit den Datierungen
des Bandes genau übereinstimmen. Nimmt man also, trotz des Fehlens von Ähnlichkeit und Wappen, dennoch Sigismund als dargestellt an. so
könnte nur seine Frau Barbara, die bis 1451 lebte, die Bestellerin gewesen sein. Die Handschrift müßte dann 1447, knapp nachdem Martinus das
erste Blatt gemalt hatte, von Barbara an den Kaiser zediert worden sein, wobei freilich die Erklärung für die äußere und innere Gleichheit mit der
notorisch für Friedrich, und zwar schon im Jahr vorher geschmückten Legenda aurea offen bliebe. Die Handschrift ist auch erwähnt bei Waagen,
Die vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien, II, 16, Woltmann-Woermann, Geschichte der Malerei, II, 126, Schnaase, Mitth. der Centraikommission
VII, 210 ff., Burger, a. a. O., Suida, Leporini, a. a. 0., Nr. 103 des Kat. d. Miniaturenausstellung.
— 9 —