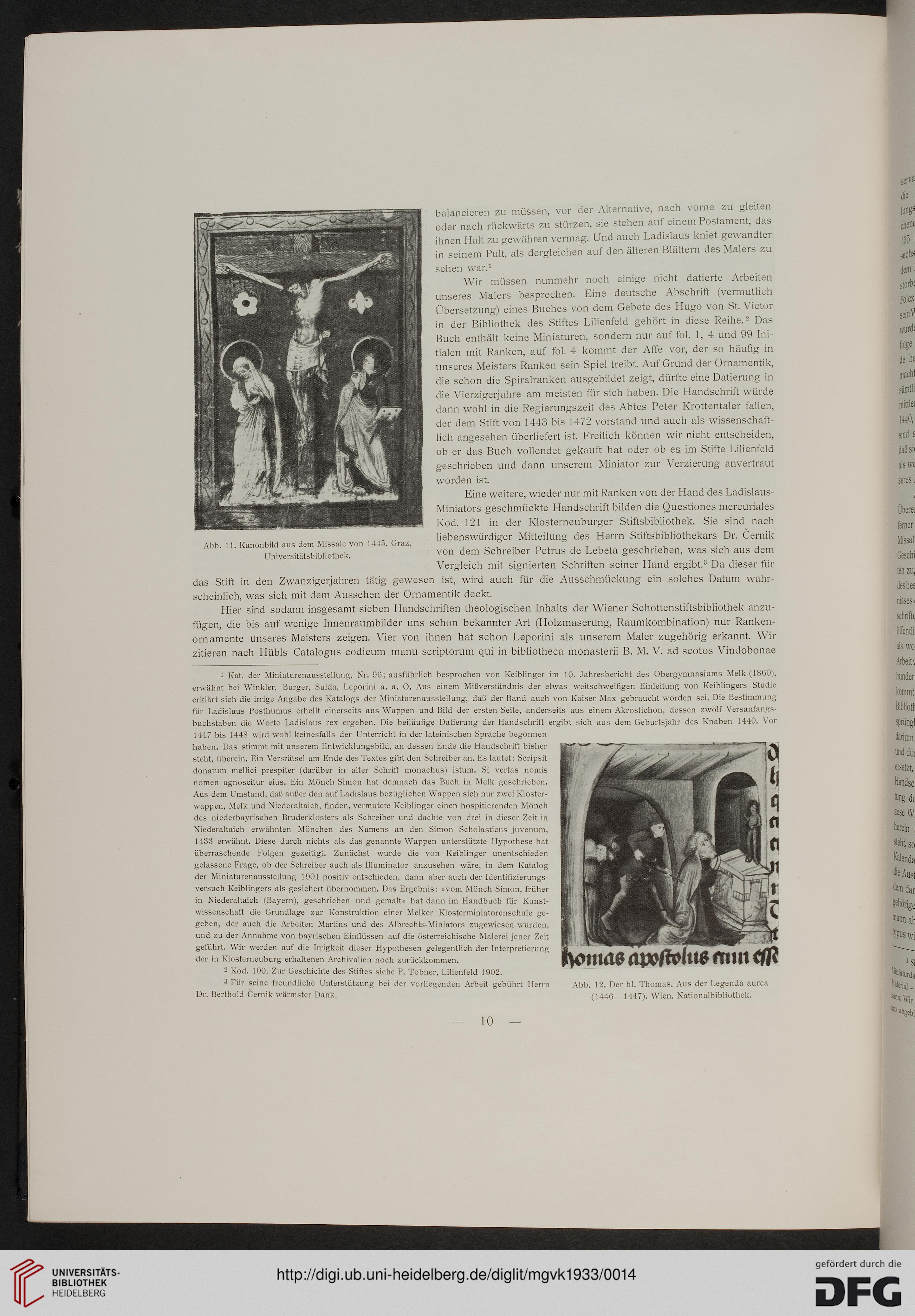balancieren zu müssen, vor der Alternative, nach vorne zu gleiten
oder nach rückwärts zu stürzen, sie stehen auf einem Postament, das
ihnen Halt zu gewähren vermag. Und auch Ladislaus kniet gewandter
in seinem Pult, als dergleichen auf den älteren Blättern des Malers zu
sehen war.1
Wir müssen nunmehr noch einige nicht datierte Arbeiten
unseres Malers besprechen. Eine deutsche Abschrift (vermutlich
Übersetzung) eines Buches von dem Gebete des Hugo von St. Victor
in der Bibliothek des Stiftes Lilienfeld gehört in diese Reihe.2 Das
Buch enthält keine Miniaturen, sondern nur auf fol. 1, 4 und 99 Ini-
tialen mit Ranken, auf fol. 4 kommt der Affe vor, der so häufig in
unseres Meisters Ranken sein Spiel treibt. Auf Grund der Ornamentik,
die schon die Spiralranken ausgebildet zeigt, dürfte eine Datierung in
die Vierzigerjahre am meisten für sich haben. Die Handschrift würde
dann wohl in die Regierungszeit des Abtes Peter Krottentaler fallen,
der dem Stift von 1443 bis 1472 vorstand und auch als wissenschaft-
lich angesehen überliefert ist. Freilich können wir nicht entscheiden,
ob er das Buch vollendet gekauft hat oder ob es im Stifte Lilienfeld
geschrieben und dann unserem Miniator zur Verzierung anvertraut
worden ist.
Eine weitere, wieder nur mit Ranken von der Hand des Ladislaus-
Miniators geschmückte Handschrift bilden die Questiones mercuriales
Kod. 121 in der Klosterneuburger Stiftsbibliothek. Sie sind nach
liebenswürdiger Mitteilung des Herrn Stiftsbibliothekars Dr. Cernik
von dem Schreiber Petrus de Lebeta geschrieben, was sich aus dem
Vergleich mit signierten Schriften seiner Hand ergibt.3 Da dieser für
das Stift in den Zwanzigerjahren tätig gewesen ist, wird auch für die Ausschmückung ein solches Datum wahr-
scheinlich, was sich mit dem Aussehen der Ornamentik deckt.
Hier sind sodann insgesamt sieben Handschriften theologischen Inhalts der Wiener Schottenstiftsbibliothek anzu-
fügen, die bis auf wenige Innenraumbilder uns schon bekannter Art (Holzmaserung, Raumkombination) nur Ranken-
ornamente unseres Meisters zeigen. Vier von ihnen hat schon Leporini als unserem Maler zugehörig erkannt. Wir
zitieren nach Hübls Catalogus codicum manu scriptorum qui in bibliotheca monasterii B. M. V. ad scotos Yindobonae
Abb. 11. Kanonbild aus dem Missale von 144ö. Graz,
Universitätsbibliothek.
1 Kat. der Miniaturenausstellung, Nr. 96; ausführlich besprochen von Keiblinger im 10. Jahresbericht des Obergymnasiums Melk (18G0),
erwähnt bei Winkler. Bürger, Suida, Leporini a. a. O. Aus einem Mißverständnis der etwas weitschweifigen Einleitung von Keiblingers Studie
erklärt sich die irrige Angabe des Katalogs der Miniaturenausstellung, daU der Hand auch von Kaiser Max gebraucht worden sei. Die Bestimmung
für Ladislaus Posthumus erhellt einerseits aus Wappen und Bild der ersten Seite, anderseits aus einem Akrostichon, dessen zwölf Versanfangs-
buchstaben die Worte Ladislaus rex ergeben. Die beiläufige Datierung der Handschrift ergibt sich aus dem Geburtsjahr des Knaben 1440. Vor
1447 bis 144S wird wohl keinesfalls der Unterricht in der lateinischen Sprache begonnen
haben. Das stimmt mit unserem Entwicklungsbild, an dessen Ende die Handschrift bisher
steht, überein. Ein Versrätsel am Ende des Textes gibt den Schreiber an. Es lautet: Scripsit
donatum mellici prespiter (darüber in alter Schrift monachus) istum. Si vertas nomis
nomer agnoscitur eius. Ein Mönch Simon hat demnach das Buch in Melk geschrieben.
Aus dem Umstand, daU außer den auf Ladislaus bezüglichen Wappen sich nur zwei Kloster-
wappen, Melk und Niederaltaich, finden, vermutete Keiblinger einen hospitierenden Mönch
des niederbayrischen Bruderklosters als Schreiber und dachte von drei in dieser Zeit in
Niederaltaich erwähnten München des Namens an den Simon Scholasticus juvenum,
1433 erwähnt. Diese durch nichts als das genannte Wappen unterstützte Hypothese hat
überraschende Folgen gezeitigt. Zunächst wurde die von Keiblinger unentschieden
gelassene Frage, ob der Schreiber auch als Illuminator anzusehen wäre, in dem Katalog
der Miniaturenausstellung 1901 positiv entschieden, dann aber auch der Identifizierungs-
versuch Keiblingers als gesichert übernommen. Das Ergebnis: .vom Mönch Simon, früher
in Niederaltaich (Bayern), geschrieben und gemalt« hat dann im Handbuch für Kunst-
wissenschaft die Grundlage zur Konstruktion einer Melker Klosterminiatorenschule ge-
geben, der auch die Arbeiten Martins und des Albrechts-Miniators zugewiesen wurden,
und zu der Annahme von bayrischen Einflüssen auf die österreichische Malerei jener Zeit
geführt. Wir werden auf die Irrigkeit dieser Hypothesen gelegentlich der Interpretierung
der in Klosterneuburg erhaltenen Archivalien noch zurückkommen.
- Kod. 100. Zur Geschichte des Stiftes siehe P. Tobner, Lilienfeld 1002.
3 Für seine freundliche Unterstützung bei der vorliegenden Arbeit gebührt Herrn Abb. 12. Der hl. Thomas. Aus der Legenda aurea
Dr. Berthold Cernik wärmster Dank. (1446_1447). Wien. Nationalbibliothek.
10 —
oder nach rückwärts zu stürzen, sie stehen auf einem Postament, das
ihnen Halt zu gewähren vermag. Und auch Ladislaus kniet gewandter
in seinem Pult, als dergleichen auf den älteren Blättern des Malers zu
sehen war.1
Wir müssen nunmehr noch einige nicht datierte Arbeiten
unseres Malers besprechen. Eine deutsche Abschrift (vermutlich
Übersetzung) eines Buches von dem Gebete des Hugo von St. Victor
in der Bibliothek des Stiftes Lilienfeld gehört in diese Reihe.2 Das
Buch enthält keine Miniaturen, sondern nur auf fol. 1, 4 und 99 Ini-
tialen mit Ranken, auf fol. 4 kommt der Affe vor, der so häufig in
unseres Meisters Ranken sein Spiel treibt. Auf Grund der Ornamentik,
die schon die Spiralranken ausgebildet zeigt, dürfte eine Datierung in
die Vierzigerjahre am meisten für sich haben. Die Handschrift würde
dann wohl in die Regierungszeit des Abtes Peter Krottentaler fallen,
der dem Stift von 1443 bis 1472 vorstand und auch als wissenschaft-
lich angesehen überliefert ist. Freilich können wir nicht entscheiden,
ob er das Buch vollendet gekauft hat oder ob es im Stifte Lilienfeld
geschrieben und dann unserem Miniator zur Verzierung anvertraut
worden ist.
Eine weitere, wieder nur mit Ranken von der Hand des Ladislaus-
Miniators geschmückte Handschrift bilden die Questiones mercuriales
Kod. 121 in der Klosterneuburger Stiftsbibliothek. Sie sind nach
liebenswürdiger Mitteilung des Herrn Stiftsbibliothekars Dr. Cernik
von dem Schreiber Petrus de Lebeta geschrieben, was sich aus dem
Vergleich mit signierten Schriften seiner Hand ergibt.3 Da dieser für
das Stift in den Zwanzigerjahren tätig gewesen ist, wird auch für die Ausschmückung ein solches Datum wahr-
scheinlich, was sich mit dem Aussehen der Ornamentik deckt.
Hier sind sodann insgesamt sieben Handschriften theologischen Inhalts der Wiener Schottenstiftsbibliothek anzu-
fügen, die bis auf wenige Innenraumbilder uns schon bekannter Art (Holzmaserung, Raumkombination) nur Ranken-
ornamente unseres Meisters zeigen. Vier von ihnen hat schon Leporini als unserem Maler zugehörig erkannt. Wir
zitieren nach Hübls Catalogus codicum manu scriptorum qui in bibliotheca monasterii B. M. V. ad scotos Yindobonae
Abb. 11. Kanonbild aus dem Missale von 144ö. Graz,
Universitätsbibliothek.
1 Kat. der Miniaturenausstellung, Nr. 96; ausführlich besprochen von Keiblinger im 10. Jahresbericht des Obergymnasiums Melk (18G0),
erwähnt bei Winkler. Bürger, Suida, Leporini a. a. O. Aus einem Mißverständnis der etwas weitschweifigen Einleitung von Keiblingers Studie
erklärt sich die irrige Angabe des Katalogs der Miniaturenausstellung, daU der Hand auch von Kaiser Max gebraucht worden sei. Die Bestimmung
für Ladislaus Posthumus erhellt einerseits aus Wappen und Bild der ersten Seite, anderseits aus einem Akrostichon, dessen zwölf Versanfangs-
buchstaben die Worte Ladislaus rex ergeben. Die beiläufige Datierung der Handschrift ergibt sich aus dem Geburtsjahr des Knaben 1440. Vor
1447 bis 144S wird wohl keinesfalls der Unterricht in der lateinischen Sprache begonnen
haben. Das stimmt mit unserem Entwicklungsbild, an dessen Ende die Handschrift bisher
steht, überein. Ein Versrätsel am Ende des Textes gibt den Schreiber an. Es lautet: Scripsit
donatum mellici prespiter (darüber in alter Schrift monachus) istum. Si vertas nomis
nomer agnoscitur eius. Ein Mönch Simon hat demnach das Buch in Melk geschrieben.
Aus dem Umstand, daU außer den auf Ladislaus bezüglichen Wappen sich nur zwei Kloster-
wappen, Melk und Niederaltaich, finden, vermutete Keiblinger einen hospitierenden Mönch
des niederbayrischen Bruderklosters als Schreiber und dachte von drei in dieser Zeit in
Niederaltaich erwähnten München des Namens an den Simon Scholasticus juvenum,
1433 erwähnt. Diese durch nichts als das genannte Wappen unterstützte Hypothese hat
überraschende Folgen gezeitigt. Zunächst wurde die von Keiblinger unentschieden
gelassene Frage, ob der Schreiber auch als Illuminator anzusehen wäre, in dem Katalog
der Miniaturenausstellung 1901 positiv entschieden, dann aber auch der Identifizierungs-
versuch Keiblingers als gesichert übernommen. Das Ergebnis: .vom Mönch Simon, früher
in Niederaltaich (Bayern), geschrieben und gemalt« hat dann im Handbuch für Kunst-
wissenschaft die Grundlage zur Konstruktion einer Melker Klosterminiatorenschule ge-
geben, der auch die Arbeiten Martins und des Albrechts-Miniators zugewiesen wurden,
und zu der Annahme von bayrischen Einflüssen auf die österreichische Malerei jener Zeit
geführt. Wir werden auf die Irrigkeit dieser Hypothesen gelegentlich der Interpretierung
der in Klosterneuburg erhaltenen Archivalien noch zurückkommen.
- Kod. 100. Zur Geschichte des Stiftes siehe P. Tobner, Lilienfeld 1002.
3 Für seine freundliche Unterstützung bei der vorliegenden Arbeit gebührt Herrn Abb. 12. Der hl. Thomas. Aus der Legenda aurea
Dr. Berthold Cernik wärmster Dank. (1446_1447). Wien. Nationalbibliothek.
10 —