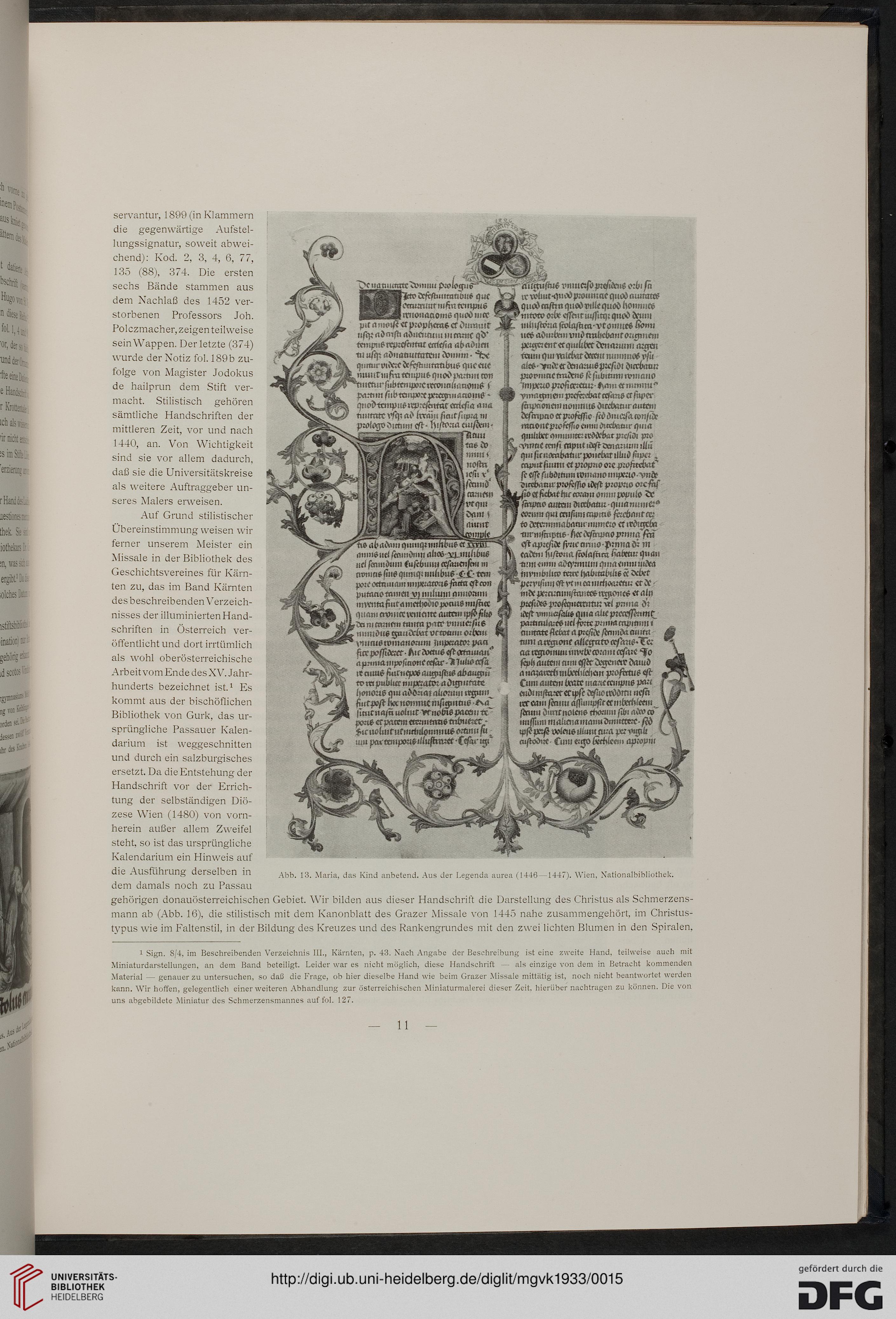lÖOri) lET:
«iget
J
utatctoiimii pw/oyiff*^
■JefpCcfWbuimtiBii» (fut
ccniaimrtiifiiifcirtjme
mtonaaome qtioo mit
pit (i im«i/i er ptophaa* er Ctaraut r
tif(^n9nifbndiiciuutiiiii(mitcqc>*
m ii/ip adutttimtirtttii dtmnm • •5fc<
qiimirtn^Stft/huifiititMiS fliicetie
^iiuiiriiifiTKtiiipu^OiioOi.Hirtiiittoti
**iii«iir(!i!)toiij»rcmoitn(irtnomC ('
tmimtc vf(jt no (reimt {icutfiipia m
»JMrtiinicfV-hi/W.iawi/Kiii'
Tltuu
iiiiiii (
iicfh-s
ic/i: v'(
fttuui'
tatntm
[i \X7Jlvt<l'u
|5nm)
muht
_gm«lc_
- ..^itÄiiii mimqtmihkitf etxmiF
mimend finiiiOimt iilt« üj_mili6u6
tifi fcnmiNim fu/cbmiii (C/haeii^tti m
mnnn6 fmeqpmtqt 1111/10116 ton
p«i'ortmiMmmipK<itPn*fnitoqiTam
Uumnctnnmi v) iinliiiin mmwiini
mvetit« fiiita merltoi'iepetute mtßuc
Oiinm m»ii(Cvniicint airtti» ip/o/tto
fXa ni ranioti roitra puif t'iiuie/ii6
. mim0ti6^!iA'birtur«>timiO:bcw
' \nmi0u>maiio:imi impaatvtpaa^
fite poffieaet-Air axnte cwniuitit
(tprmi<xtiipc|üiOTif«fer-TlTu/«'nfä_
it mute /mrttep* «ttmffci? abfltumT
wmptwtomipfoiÖK fiOttpiiMtc
(tottotte <)iu aftenat rtlimiiiii ltguin^
fiufpsft bx Kommt m/igmme *\<T
llmttmpjuomttWnobiepiwoiitt7
pe*t* erptuem «tmimne fiTfeiifter-
<iinioltnritrmrtiiloniiiiu6(».tuiii/M.
um parttmpsaNwjhtuer 'C^äi'up*
servantur, 1899 (in Klammern
die gegenwärtige Aufstel-
lungssignatur, soweit abwei-
chend): Kod. 2, 3, 4, 6, 77,
135 (88), 374. Die ersten
sechs Bände stammen aus
dem Nachlaß des 1452 ver-
storbenen Professors Joh.
Polczmacher,zeigen teilweise
sein Wappen. Der letzte (374)
wurde der Notiz fol. 189 b zu- C
folge von Magister Jodokus
de hailprun dem Stift ver-
macht. Stilistisch gehören
sämtliche Handschriften der
mittleren Zeit, vor und nach
1440, an. Von Wichtigkeit
sind sie vor allem dadurch,
daß sie die Universitätskreise
als weitere Auftraggeber un-
seres Malers erweisen.
Auf Grund stilistischer
Übereinstimmung weisen wir
ferner unserem Meister ein
Missale in der Bibliothek des
Geschichtsvereines für Kärn-
ten zu, das im Band Kärnten
des beschreibenden Verzeich-
nisses der illuminierten Hand-
schriften in Österreich ver-
öffentlicht und dort irrtümlich
als wohl oberösterreichische
Arbeit vom Ende des XV. Jahr-
hunderts bezeichnet ist.1 Es
kommt aus der bischöflichen
Bibliothek von Gurk, das ur-
sprüngliche Passauer Kalen-
darium ist weggeschnitten
und durch ein salzburgisches
ersetzt. Da die Entstehung der
Handschrift vor der Errich-
tung der selbständigen Diö-
zese Wien (1480) von vorn-
herein außer allem Zweifel
steht, so ist das ursprüngliche
Kalendarium ein Hinweis auf
die Ausführung derselben in Abb 13 MarU) das Kind anbetend. Aus der Legenda aurea (1446 -1447). Wien. Xationalbibliothck.
dem damals noch zu Passau
gehörigen donauösterreichischen Gebiet. Wir bilden aus dieser Handschrift die Darstellung des Christus als Schmerzens-
mann ab (Abb. 16), die stilistisch mit dem Kanonblatt des Grazer Missale von 1445 nahe zusammengehört, im Christus-
typus wie im Faltenstil, in der Bildung des Kreuzes und des Rankengrundes mit den zwei lichten Blumen in den Spiralen,
aitcrtiftu* vimtct/i>pt«/idcu6 e:ii/n
qtipJtmrm quoc wllcquoo hemme«
mwro o;ix vfTnirui/fitq: queo antiii
mlu/twia (rotn/hm- vt omuti Sonn
tiefe aöuUmiMtflnttiebmif(«inmfiii
petgttcnretmuu(*tä*imNiim~<i»jtn
taiiu t)w rölfWiMw nimm»» vfu
(iic*'Tniie<r9eti(ttut6y:e/i0i Surfxin;:
pwpiimcfrajtne (} |iiUirom tvmailP
Iniptuo pjofioKCOK- ls«m «nimmt'*
-vmntjmem pxfkebat afan» er fiipcr
fmpnonemnommievttrrfwmi auttni
afmpno ctptoföjic fcodmaf&tonlibc
mnonrpiofrffi» cnnii dttdmtur ijnia
qiiiubrroimmitctcWbatputfoi pio
-Tinnctcnfi rnptttiiqfi'OBifUUttiiiUit
ijiii funsrnbatm-pmicbatiUtiifiipa i
rapittfutmi et ptopjio ojc pioftttbat"
fi tlft fiiWilum loimiiip mipKio-viidf
vuvtximipwfefHo tiVfl pwvno oie-fhf
^ü>Ctficfartf(nrKvamoiinnpr>i)iilo Sc
Imme- autau $usbtttwc)utammit:*
eonim i)ut tnt/imi mpme faebnntte
to {Bcanmaoamnmmeis er irftrjcte
■mrmfmpt& kKl'cftmiaopitmq fia
fftaptefiX (iwnniiopmnaö: »Ii
e«ösn lii/hKiit fietafixca Rabtau 9«a«i
timi eintii actymiiitii qina emtu nuVa
fmniBiliro trat Ivipitoluiie« Mivf
'pfrvifimie/ntmeitiiiriioftjetji; et Dt ■
tu?« pwa;tiiiii/?tuitt« tttpcnic* et nln
pteftCti piofiqtiemttui wi pr.ma d;
atftvmuefaUi qiiia aUeptetci7«imr
pmtimJa:e«iit'fiRtep.'iiiHttnpiti;mt
miiffittActoaprc/?6t/friiniVta<iirit
tum nttmont rtil«raroa/im^-Te;
aattyioinuiimvttüi'aJtnmtt^Me fo
fflilt duttiii tum «ffJf Ittjotfir txuuo
a im wrerii mUtWeiiem ptoftmi? <(t
Cum autau Ixatt maaettiiipue pntt
aii»iiti|?tiareru)fe JefiictrJomi nefä
itrtum jtauu aflUuipfir etinlicrfifceiii^
l&uiu Simmolcn» rtwimi fU» nixo tö~
mßxm mdliciiaiiMiiuömitttttc- f}&
tpßpsfi wtaieüiuw auA paTigiit
mfiroJi« Cum e:tto 6Mc«m aptepm
1 Sign. 8/4, im Beschreibenden Verzeichnis OL, Kärnten, p. -43. Nach Angabe der Beschreibung ist eine zweite Hand, teilweise auch mit
Miniaturdarstellungen, an dem Band beteiligt. Leider war es nicht möglich, diese Handschrift — als einzige von dem in Betracht kommenden
Material — genauer zu untersuchen, so daß die Frage, ob hier dieselbe Hand wie beim Grazer Missale mittätig ist, noch nicht beantwortet werden
kann. Wir hoffen, gelegentlich einerweiteren Abhandlung zur österreichischen Miniaturmalerei dieser Zeit, hierüber nachtragen zu können. Die von
uns abgebildete Miniatur des Schmerzensmannes auf fol. 127.
— 11 —
«iget
J
utatctoiimii pw/oyiff*^
■JefpCcfWbuimtiBii» (fut
ccniaimrtiifiiifcirtjme
mtonaaome qtioo mit
pit (i im«i/i er ptophaa* er Ctaraut r
tif(^n9nifbndiiciuutiiiii(mitcqc>*
m ii/ip adutttimtirtttii dtmnm • •5fc<
qiimirtn^Stft/huifiititMiS fliicetie
^iiuiiriiifiTKtiiipu^OiioOi.Hirtiiittoti
**iii«iir(!i!)toiij»rcmoitn(irtnomC ('
tmimtc vf(jt no (reimt {icutfiipia m
»JMrtiinicfV-hi/W.iawi/Kiii'
Tltuu
iiiiiii (
iicfh-s
ic/i: v'(
fttuui'
tatntm
[i \X7Jlvt<l'u
|5nm)
muht
_gm«lc_
- ..^itÄiiii mimqtmihkitf etxmiF
mimend finiiiOimt iilt« üj_mili6u6
tifi fcnmiNim fu/cbmiii (C/haeii^tti m
mnnn6 fmeqpmtqt 1111/10116 ton
p«i'ortmiMmmipK<itPn*fnitoqiTam
Uumnctnnmi v) iinliiiin mmwiini
mvetit« fiiita merltoi'iepetute mtßuc
Oiinm m»ii(Cvniicint airtti» ip/o/tto
fXa ni ranioti roitra puif t'iiuie/ii6
. mim0ti6^!iA'birtur«>timiO:bcw
' \nmi0u>maiio:imi impaatvtpaa^
fite poffieaet-Air axnte cwniuitit
(tprmi<xtiipc|üiOTif«fer-TlTu/«'nfä_
it mute /mrttep* «ttmffci? abfltumT
wmptwtomipfoiÖK fiOttpiiMtc
(tottotte <)iu aftenat rtlimiiiii ltguin^
fiufpsft bx Kommt m/igmme *\<T
llmttmpjuomttWnobiepiwoiitt7
pe*t* erptuem «tmimne fiTfeiifter-
<iinioltnritrmrtiiloniiiiu6(».tuiii/M.
um parttmpsaNwjhtuer 'C^äi'up*
servantur, 1899 (in Klammern
die gegenwärtige Aufstel-
lungssignatur, soweit abwei-
chend): Kod. 2, 3, 4, 6, 77,
135 (88), 374. Die ersten
sechs Bände stammen aus
dem Nachlaß des 1452 ver-
storbenen Professors Joh.
Polczmacher,zeigen teilweise
sein Wappen. Der letzte (374)
wurde der Notiz fol. 189 b zu- C
folge von Magister Jodokus
de hailprun dem Stift ver-
macht. Stilistisch gehören
sämtliche Handschriften der
mittleren Zeit, vor und nach
1440, an. Von Wichtigkeit
sind sie vor allem dadurch,
daß sie die Universitätskreise
als weitere Auftraggeber un-
seres Malers erweisen.
Auf Grund stilistischer
Übereinstimmung weisen wir
ferner unserem Meister ein
Missale in der Bibliothek des
Geschichtsvereines für Kärn-
ten zu, das im Band Kärnten
des beschreibenden Verzeich-
nisses der illuminierten Hand-
schriften in Österreich ver-
öffentlicht und dort irrtümlich
als wohl oberösterreichische
Arbeit vom Ende des XV. Jahr-
hunderts bezeichnet ist.1 Es
kommt aus der bischöflichen
Bibliothek von Gurk, das ur-
sprüngliche Passauer Kalen-
darium ist weggeschnitten
und durch ein salzburgisches
ersetzt. Da die Entstehung der
Handschrift vor der Errich-
tung der selbständigen Diö-
zese Wien (1480) von vorn-
herein außer allem Zweifel
steht, so ist das ursprüngliche
Kalendarium ein Hinweis auf
die Ausführung derselben in Abb 13 MarU) das Kind anbetend. Aus der Legenda aurea (1446 -1447). Wien. Xationalbibliothck.
dem damals noch zu Passau
gehörigen donauösterreichischen Gebiet. Wir bilden aus dieser Handschrift die Darstellung des Christus als Schmerzens-
mann ab (Abb. 16), die stilistisch mit dem Kanonblatt des Grazer Missale von 1445 nahe zusammengehört, im Christus-
typus wie im Faltenstil, in der Bildung des Kreuzes und des Rankengrundes mit den zwei lichten Blumen in den Spiralen,
aitcrtiftu* vimtct/i>pt«/idcu6 e:ii/n
qtipJtmrm quoc wllcquoo hemme«
mwro o;ix vfTnirui/fitq: queo antiii
mlu/twia (rotn/hm- vt omuti Sonn
tiefe aöuUmiMtflnttiebmif(«inmfiii
petgttcnretmuu(*tä*imNiim~<i»jtn
taiiu t)w rölfWiMw nimm»» vfu
(iic*'Tniie<r9eti(ttut6y:e/i0i Surfxin;:
pwpiimcfrajtne (} |iiUirom tvmailP
Iniptuo pjofioKCOK- ls«m «nimmt'*
-vmntjmem pxfkebat afan» er fiipcr
fmpnonemnommievttrrfwmi auttni
afmpno ctptoföjic fcodmaf&tonlibc
mnonrpiofrffi» cnnii dttdmtur ijnia
qiiiubrroimmitctcWbatputfoi pio
-Tinnctcnfi rnptttiiqfi'OBifUUttiiiUit
ijiii funsrnbatm-pmicbatiUtiifiipa i
rapittfutmi et ptopjio ojc pioftttbat"
fi tlft fiiWilum loimiiip mipKio-viidf
vuvtximipwfefHo tiVfl pwvno oie-fhf
^ü>Ctficfartf(nrKvamoiinnpr>i)iilo Sc
Imme- autau $usbtttwc)utammit:*
eonim i)ut tnt/imi mpme faebnntte
to {Bcanmaoamnmmeis er irftrjcte
■mrmfmpt& kKl'cftmiaopitmq fia
fftaptefiX (iwnniiopmnaö: »Ii
e«ösn lii/hKiit fietafixca Rabtau 9«a«i
timi eintii actymiiitii qina emtu nuVa
fmniBiliro trat Ivipitoluiie« Mivf
'pfrvifimie/ntmeitiiiriioftjetji; et Dt ■
tu?« pwa;tiiiii/?tuitt« tttpcnic* et nln
pteftCti piofiqtiemttui wi pr.ma d;
atftvmuefaUi qiiia aUeptetci7«imr
pmtimJa:e«iit'fiRtep.'iiiHttnpiti;mt
miiffittActoaprc/?6t/friiniVta<iirit
tum nttmont rtil«raroa/im^-Te;
aattyioinuiimvttüi'aJtnmtt^Me fo
fflilt duttiii tum «ffJf Ittjotfir txuuo
a im wrerii mUtWeiiem ptoftmi? <(t
Cum autau Ixatt maaettiiipue pntt
aii»iiti|?tiareru)fe JefiictrJomi nefä
itrtum jtauu aflUuipfir etinlicrfifceiii^
l&uiu Simmolcn» rtwimi fU» nixo tö~
mßxm mdliciiaiiMiiuömitttttc- f}&
tpßpsfi wtaieüiuw auA paTigiit
mfiroJi« Cum e:tto 6Mc«m aptepm
1 Sign. 8/4, im Beschreibenden Verzeichnis OL, Kärnten, p. -43. Nach Angabe der Beschreibung ist eine zweite Hand, teilweise auch mit
Miniaturdarstellungen, an dem Band beteiligt. Leider war es nicht möglich, diese Handschrift — als einzige von dem in Betracht kommenden
Material — genauer zu untersuchen, so daß die Frage, ob hier dieselbe Hand wie beim Grazer Missale mittätig ist, noch nicht beantwortet werden
kann. Wir hoffen, gelegentlich einerweiteren Abhandlung zur österreichischen Miniaturmalerei dieser Zeit, hierüber nachtragen zu können. Die von
uns abgebildete Miniatur des Schmerzensmannes auf fol. 127.
— 11 —