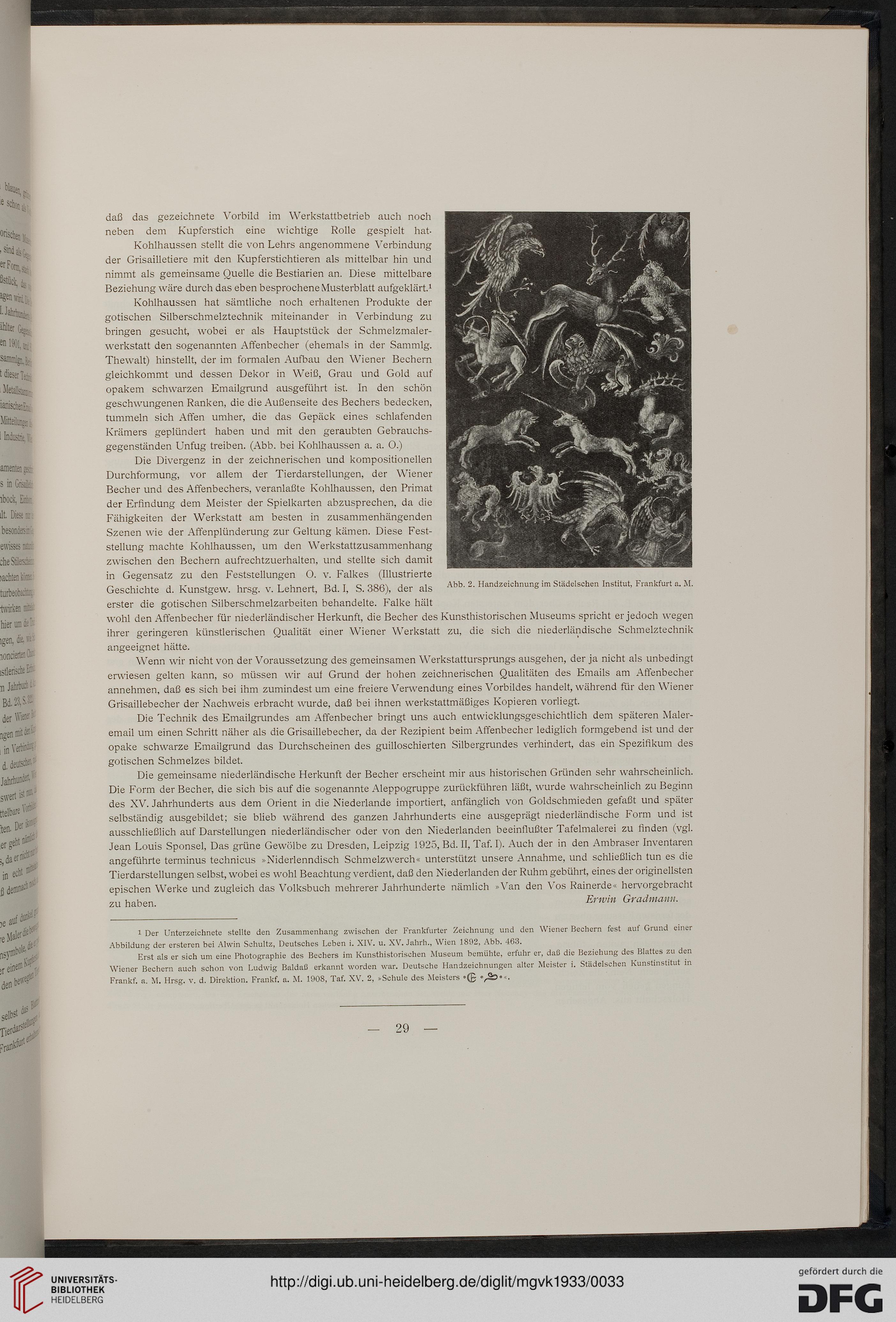daß das gezeichnete Vorbild im Werkstattbetrieb auch noch
neben dem Kupferstich eine wichtige Rolle gespielt hat-
Kohlhaussen stellt die von Lehrs angenommene Verbindung
der Grisailletiere mit den Kupferstichtieren als mittelbar hin und
nimmt als gemeinsame Quelle die Bestiarien an. Diese mittelbare
Beziehung wäre durch das eben besprochene Musterblatt aufgeklärt.1
Kohlhaussen hat sämtliche noch erhaltenen Produkte der
gotischen Silberschmelztechnik miteinander in Verbindung zu
bringen gesucht, wobei er als Hauptstück der Schmelzmaler-
werkstatt den sogenannten Affenbecher (ehemals in der Sammig.
Thewalt) hinstellt, der im formalen Aufbau den Wiener Bechern
gleichkommt und dessen Dekor in Weiß, Grau und Gold auf
opakem schwarzen Emailgrund ausgeführt ist. In den schön
geschwungenen Ranken, die die Außenseite des Bechers bedecken,
tummeln sich Affen umher, die das Gepäck eines schlafenden
Krämers geplündert haben und mit den geraubten Gebrauchs-
gegenständen Unfug treiben. (Abb. bei Kohlhaussen a. a. O.)
Die Divergenz in der zeichnerischen und kompositionellen
Durchformung, vor allem der Tierdarstellungen, der Wiener
Becher und des Affenbechers, veranlaßte Kohlhaussen, den Primat
der Erfindung dem Meister der Spielkarten abzusprechen, da die
Fähigkeiten der Werkstatt am besten in zusammenhängenden
Szenen wie der Affenplünderung zur Geltung kämen. Diese Fest-
stellung machte Kohlhaussen, um den Werkstattzusammenhang
zwischen den Bechern aufrechtzuerhalten, und stellte sich damit
in Gegensatz zu den Feststellungen O. v. Falkes (Illustrierte
Geschichte d. Kunstgew. hrsg. v. Lehnert, Bd. I, S. 386), der als
erster die gotischen Silberschmelzarbeiten behandelte. B'alke hält
wohl den Affenbecher für niederländischer Herkunft, die Becher des Kunsthistorischen Museums spricht er jedoch wegen
ihrer geringeren künstlerischen Qualität einer Wiener Werkstatt zu, die sich die niederländische Schmelztechnik
angeeignet hätte.
Wenn wir nicht von der Voraussetzung des gemeinsamen Werkstattursprungs ausgehen, der ja nicht als unbedingt
erwiesen gelten kann, so müssen wir auf Grund der hohen zeichnerischen Qualitäten des Emails am Affenbecher
annehmen, daß es sich bei ihm zumindest um eine freiere Verwendung eines Vorbildes handelt, während für den Wiener
Grisaillebecher der Nachweis erbracht wurde, daß bei ihnen werkstattmäßiges Kopieren vorliegt.
Die Technik des Emailgrundes am Affenbecher bringt uns auch entwicklungsgeschichtlich dem späteren Maler-
email um einen Schritt näher als die Grisaillebecher, da der Rezipient beim Affenbecher lediglich formgebend ist und der
opake schwarze Emailgrund das Durchscheinen des guilloschierten Silbergrundes verhindert, das ein Speziflkum des
gotischen Schmelzes bildet.
Die gemeinsame niederländische Herkunft der Becher erscheint mir aus historischen Gründen sehr wahrscheinlich.
Die Form der Becher, die sich bis auf die sogenannte Aleppogruppe zurückführen läßt, wurde wahrscheinlich zu Beginn
des XV. Jahrhunderts aus dem Orient in die Niederlande importiert, anfänglich von Goldschmieden gefaßt und später
selbständig ausgebildet; sie blieb während des ganzen Jahrhunderts eine ausgeprägt niederländische Form und ist
ausschließlich auf Darstellungen niederländischer oder von den Niederlanden beeinflußter Tafelmalerei zu linden (vgl.
Jean Louis Sponsel, Das grüne Gewölbe zu Dresden, Leipzig 1925, Bd. II, Taf. I). Auch der in den Ambraser Inventaren
angeführte terminus technicus »Niderlenndisch Schmelzwerch« unterstützt unsere Annahme, und schließlich tun es die
Tierdarstellungen selbst, wobei es wohl Beachtung verdient, daß den Niederlanden der Ruhm gebührt, eines der originellsten
epischen Werke und zugleich das Volksbuch mehrerer Jahrhunderte nämlich »Van den Vos Rainerde« hervorgebracht
zu haben. Erwin Gradmann.
Abb. 2. Handzeichnung im Städtischen Institut, Frankfurt a. M.
1 Der Unterzeichnete stellte den Zusammenhang zwischen der Frankfurter Zeichnung und den Wiener Bechern fest auf Grund einer
Abbildung der ersteren bei Alwin Schultz, Deutsches Leben i. XIV. u. XV. Jahrh., Wien 1802, Abb. 463.
Erst als er sich um eine Photographie des Bechers im Kunsthistorischen Museum bemühte, erfuhr er, daß die Beziehung des Blattes zu den
Wiener Bechern auch schon von Ludwig Baldaü erkannt worden war. Deutsche Handzeichnungen alter Meister i. Städtischen Kunstinstitut in
Frankf. a. M. Hrsg. v. d. Direktion. Frankf. a. M. 1908, Taf. XV. 2, >Schule des Meisters • (£ 'pS' .
<0
— 29 —
neben dem Kupferstich eine wichtige Rolle gespielt hat-
Kohlhaussen stellt die von Lehrs angenommene Verbindung
der Grisailletiere mit den Kupferstichtieren als mittelbar hin und
nimmt als gemeinsame Quelle die Bestiarien an. Diese mittelbare
Beziehung wäre durch das eben besprochene Musterblatt aufgeklärt.1
Kohlhaussen hat sämtliche noch erhaltenen Produkte der
gotischen Silberschmelztechnik miteinander in Verbindung zu
bringen gesucht, wobei er als Hauptstück der Schmelzmaler-
werkstatt den sogenannten Affenbecher (ehemals in der Sammig.
Thewalt) hinstellt, der im formalen Aufbau den Wiener Bechern
gleichkommt und dessen Dekor in Weiß, Grau und Gold auf
opakem schwarzen Emailgrund ausgeführt ist. In den schön
geschwungenen Ranken, die die Außenseite des Bechers bedecken,
tummeln sich Affen umher, die das Gepäck eines schlafenden
Krämers geplündert haben und mit den geraubten Gebrauchs-
gegenständen Unfug treiben. (Abb. bei Kohlhaussen a. a. O.)
Die Divergenz in der zeichnerischen und kompositionellen
Durchformung, vor allem der Tierdarstellungen, der Wiener
Becher und des Affenbechers, veranlaßte Kohlhaussen, den Primat
der Erfindung dem Meister der Spielkarten abzusprechen, da die
Fähigkeiten der Werkstatt am besten in zusammenhängenden
Szenen wie der Affenplünderung zur Geltung kämen. Diese Fest-
stellung machte Kohlhaussen, um den Werkstattzusammenhang
zwischen den Bechern aufrechtzuerhalten, und stellte sich damit
in Gegensatz zu den Feststellungen O. v. Falkes (Illustrierte
Geschichte d. Kunstgew. hrsg. v. Lehnert, Bd. I, S. 386), der als
erster die gotischen Silberschmelzarbeiten behandelte. B'alke hält
wohl den Affenbecher für niederländischer Herkunft, die Becher des Kunsthistorischen Museums spricht er jedoch wegen
ihrer geringeren künstlerischen Qualität einer Wiener Werkstatt zu, die sich die niederländische Schmelztechnik
angeeignet hätte.
Wenn wir nicht von der Voraussetzung des gemeinsamen Werkstattursprungs ausgehen, der ja nicht als unbedingt
erwiesen gelten kann, so müssen wir auf Grund der hohen zeichnerischen Qualitäten des Emails am Affenbecher
annehmen, daß es sich bei ihm zumindest um eine freiere Verwendung eines Vorbildes handelt, während für den Wiener
Grisaillebecher der Nachweis erbracht wurde, daß bei ihnen werkstattmäßiges Kopieren vorliegt.
Die Technik des Emailgrundes am Affenbecher bringt uns auch entwicklungsgeschichtlich dem späteren Maler-
email um einen Schritt näher als die Grisaillebecher, da der Rezipient beim Affenbecher lediglich formgebend ist und der
opake schwarze Emailgrund das Durchscheinen des guilloschierten Silbergrundes verhindert, das ein Speziflkum des
gotischen Schmelzes bildet.
Die gemeinsame niederländische Herkunft der Becher erscheint mir aus historischen Gründen sehr wahrscheinlich.
Die Form der Becher, die sich bis auf die sogenannte Aleppogruppe zurückführen läßt, wurde wahrscheinlich zu Beginn
des XV. Jahrhunderts aus dem Orient in die Niederlande importiert, anfänglich von Goldschmieden gefaßt und später
selbständig ausgebildet; sie blieb während des ganzen Jahrhunderts eine ausgeprägt niederländische Form und ist
ausschließlich auf Darstellungen niederländischer oder von den Niederlanden beeinflußter Tafelmalerei zu linden (vgl.
Jean Louis Sponsel, Das grüne Gewölbe zu Dresden, Leipzig 1925, Bd. II, Taf. I). Auch der in den Ambraser Inventaren
angeführte terminus technicus »Niderlenndisch Schmelzwerch« unterstützt unsere Annahme, und schließlich tun es die
Tierdarstellungen selbst, wobei es wohl Beachtung verdient, daß den Niederlanden der Ruhm gebührt, eines der originellsten
epischen Werke und zugleich das Volksbuch mehrerer Jahrhunderte nämlich »Van den Vos Rainerde« hervorgebracht
zu haben. Erwin Gradmann.
Abb. 2. Handzeichnung im Städtischen Institut, Frankfurt a. M.
1 Der Unterzeichnete stellte den Zusammenhang zwischen der Frankfurter Zeichnung und den Wiener Bechern fest auf Grund einer
Abbildung der ersteren bei Alwin Schultz, Deutsches Leben i. XIV. u. XV. Jahrh., Wien 1802, Abb. 463.
Erst als er sich um eine Photographie des Bechers im Kunsthistorischen Museum bemühte, erfuhr er, daß die Beziehung des Blattes zu den
Wiener Bechern auch schon von Ludwig Baldaü erkannt worden war. Deutsche Handzeichnungen alter Meister i. Städtischen Kunstinstitut in
Frankf. a. M. Hrsg. v. d. Direktion. Frankf. a. M. 1908, Taf. XV. 2, >Schule des Meisters • (£ 'pS' .
<0
— 29 —