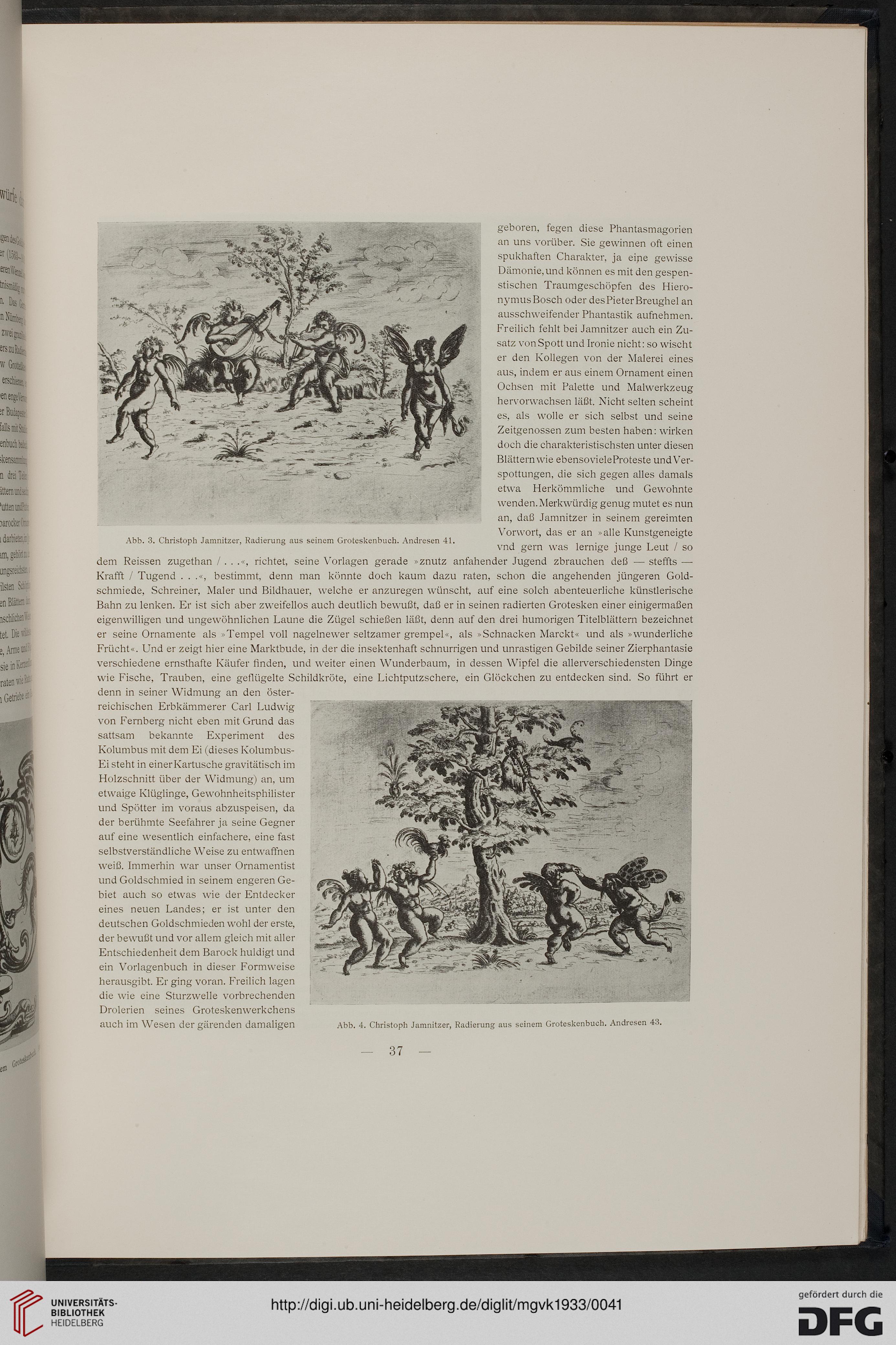Abb. 3. Christoph Jamnitzer, Radierung aus seinem Groteskenbuch. Andresen 41.
geboren, fegen diese Phantasmagorien
an uns vorüber. Sie gewinnen oft einen
spukhaften Charakter, ja eine gewisse
Dämonie, und können es mit den gespen-
stischen Traumgeschöpfen des Hiero-
nymus Bosch oder desPieterBreughel an
ausschweifender Phantastik aufnehmen.
Freilich fehlt bei Jamnitzer auch ein Zu-
satz von Spott und Ironie nicht: so wischt
er den Kollegen von der Malerei eines
aus, indem er aus einem Ornament einen
Ochsen mit Palette und Malwerkzeug
hervorwachsen läßt. Nicht selten scheint
es, als wolle er sich selbst und seine
Zeitgenossen zum besten haben: wirken
doch die charakteristischsten unter diesen
Blättern wie ebensovieleProteste undVer-
spottungen, die sich gegen alles damals
etwa Herkömmliche und Gewohnte
wenden. Merkwürdig genug mutet es nun
an, daß Jamnitzer in seinem gereimten
Vorwort, das er an »alle Kunstgeneigte
vnd gern was lernige junge Leut / so
dem Reissen zugethan /...«, richtet, seine Vorlagen gerade »znutz anfallender Jugend zbrauchen deß — steffts —
Krafft / Tugend . . .«, bestimmt, denn man könnte doch kaum dazu raten, schon die angehenden jüngeren Gold-
schmiede, Schreiner, Maler und Bildhauer, welche er anzuregen wünscht, auf eine solch abenteuerliche künstlerische
Bahn zu lenken. Er ist sich aber zweifellos auch deutlich bewußt, daß er in seinen radierten Grotesken einer einigermaßen
eigenwilligen und ungewöhnlichen Laune die Zügel schießen läßt, denn auf den drei humorigen Titelblättern bezeichnet
er seine Ornamente als »Tempel voll nagelnewer seltzamer grempel«, als »Schnacken Marckt« und als »wunderliche
Frücht«. Und er zeigt hier eine Marktbude, in der die insektenhaft schnurrigen und unrastigen Gebilde seiner Zierphantasie
verschiedene ernsthafte Käufer finden, und weiter einen Wunderbaum, in dessen Wipfel die allerverschiedensten Dinge
wie Fische, Trauben, eine geflügelte Schildkröte, eine Lichtputzschere, ein Glöckchen zu entdecken sind. So führt er
denn in seiner Widmung an den öster-
reichischen Erbkämmerer Carl Ludwig
von Fernberg nicht eben mit Grund das
sattsam bekannte Experiment des
Kolumbus mit dem Ei (dieses Kolumbus-
Ei steht in einer Kartusche gravitätisch im
Holzschnitt über der Widmung) an, um
etwaige Klüglinge, Gewohnheitsphilister
und Spötter im voraus abzuspeisen, da
der berühmte Seefahrer ja seine Gegner
auf eine wesentlich einfachere, eine fast
selbstverständliche Weise zu entwaffnen
weiß. Immerhin war unser Ornamentist
und Goldschmied in seinem engeren Ge-
biet auch so etwas wie der Entdecker
eines neuen Landes; er ist unter den
deutschen Goldschmieden wohl der erste,
der bewußt und vor allem gleich mit aller
Entschiedenheit dem Barock huldigt und
ein Vorlagenbuch in dieser Formweise
herausgibt. Er ging voran. Freilich lagen
die wie eine Sturzwelle vorbrechenden
Drolerien seines Groteskenwerkchens
auch im Wesen der gärenden damaligen
Abb. 4. Christoph Jamnitzer, Radierung aus seinem Groteskenbuch. Andresen 43.
37
geboren, fegen diese Phantasmagorien
an uns vorüber. Sie gewinnen oft einen
spukhaften Charakter, ja eine gewisse
Dämonie, und können es mit den gespen-
stischen Traumgeschöpfen des Hiero-
nymus Bosch oder desPieterBreughel an
ausschweifender Phantastik aufnehmen.
Freilich fehlt bei Jamnitzer auch ein Zu-
satz von Spott und Ironie nicht: so wischt
er den Kollegen von der Malerei eines
aus, indem er aus einem Ornament einen
Ochsen mit Palette und Malwerkzeug
hervorwachsen läßt. Nicht selten scheint
es, als wolle er sich selbst und seine
Zeitgenossen zum besten haben: wirken
doch die charakteristischsten unter diesen
Blättern wie ebensovieleProteste undVer-
spottungen, die sich gegen alles damals
etwa Herkömmliche und Gewohnte
wenden. Merkwürdig genug mutet es nun
an, daß Jamnitzer in seinem gereimten
Vorwort, das er an »alle Kunstgeneigte
vnd gern was lernige junge Leut / so
dem Reissen zugethan /...«, richtet, seine Vorlagen gerade »znutz anfallender Jugend zbrauchen deß — steffts —
Krafft / Tugend . . .«, bestimmt, denn man könnte doch kaum dazu raten, schon die angehenden jüngeren Gold-
schmiede, Schreiner, Maler und Bildhauer, welche er anzuregen wünscht, auf eine solch abenteuerliche künstlerische
Bahn zu lenken. Er ist sich aber zweifellos auch deutlich bewußt, daß er in seinen radierten Grotesken einer einigermaßen
eigenwilligen und ungewöhnlichen Laune die Zügel schießen läßt, denn auf den drei humorigen Titelblättern bezeichnet
er seine Ornamente als »Tempel voll nagelnewer seltzamer grempel«, als »Schnacken Marckt« und als »wunderliche
Frücht«. Und er zeigt hier eine Marktbude, in der die insektenhaft schnurrigen und unrastigen Gebilde seiner Zierphantasie
verschiedene ernsthafte Käufer finden, und weiter einen Wunderbaum, in dessen Wipfel die allerverschiedensten Dinge
wie Fische, Trauben, eine geflügelte Schildkröte, eine Lichtputzschere, ein Glöckchen zu entdecken sind. So führt er
denn in seiner Widmung an den öster-
reichischen Erbkämmerer Carl Ludwig
von Fernberg nicht eben mit Grund das
sattsam bekannte Experiment des
Kolumbus mit dem Ei (dieses Kolumbus-
Ei steht in einer Kartusche gravitätisch im
Holzschnitt über der Widmung) an, um
etwaige Klüglinge, Gewohnheitsphilister
und Spötter im voraus abzuspeisen, da
der berühmte Seefahrer ja seine Gegner
auf eine wesentlich einfachere, eine fast
selbstverständliche Weise zu entwaffnen
weiß. Immerhin war unser Ornamentist
und Goldschmied in seinem engeren Ge-
biet auch so etwas wie der Entdecker
eines neuen Landes; er ist unter den
deutschen Goldschmieden wohl der erste,
der bewußt und vor allem gleich mit aller
Entschiedenheit dem Barock huldigt und
ein Vorlagenbuch in dieser Formweise
herausgibt. Er ging voran. Freilich lagen
die wie eine Sturzwelle vorbrechenden
Drolerien seines Groteskenwerkchens
auch im Wesen der gärenden damaligen
Abb. 4. Christoph Jamnitzer, Radierung aus seinem Groteskenbuch. Andresen 43.
37