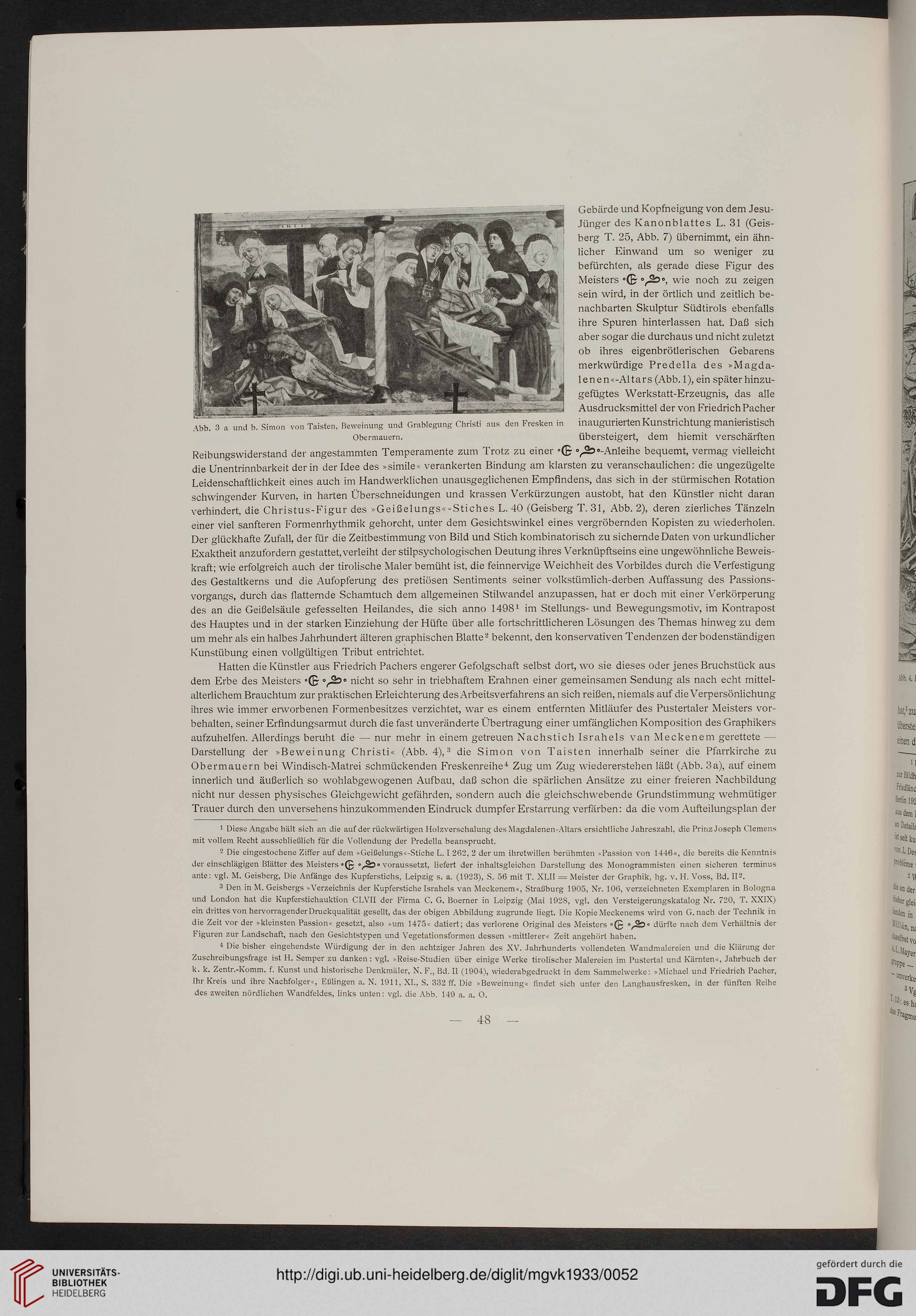Abb
Aß-
ling Christi aus
Gebärde und Kopfneigung von dem Jesu-
Jünger des Kanonblattes L. 31 (Geis-
berg T. 25, Abb. 7) übernimmt, ein ähn-
licher Einwand um so weniger zu
befürchten, als gerade diese Figur des
Meisters •(£ °^>°, wie noch zu zeigen
sein wird, in der örtlich und zeitlich be-
nachbarten Skulptur Südtirols ebenfalls
ihre Spuren hinterlassen hat. Daß sich
aber sogar die durchaus und nicht zuletzt
ob ihres eigenbrötlerischen Gebarens
merkwürdige Predella des »Magda-
lenen«-Altars (Abb. 1), ein später hinzu-
gefügtes Werkstatt-Erzeugnis, das alle
Ausdrucksmittel der von Friedrich Pacher
inaugurierten Kunstrichtung manieristisch
übersteigert, dem hiemit verschärften
den Fresken in
Obermauern.
Reibungswiderstand der angestammten Temperamente zum Trotz zu einer •(£ »-Anleihe bequemt, vermag vielleicht
die Unentrinnbarkeit der in der Idee des »simile« verankerten Bindung am klarsten zu veranschaulichen: die ungezügelte
Leidenschaftlichkeit eines auch im Handwerklichen unausgeglichenen Empfindens, das sich in der stürmischen Rotation
schwingender Kurven, in harten Überschneidungen und krassen Verkürzungen austobt, hat den Künstler nicht daran
verhindert, die Christus-Figur des »Geißelungs«-Stiches L. 40 (Geisberg T. 31, Abb. 2), deren zierliches Tänzeln
einer viel sanfteren Formenrhythmik gehorcht, unter dem Gesichtswinkel eines vergröbernden Kopisten zu wiederholen.
Der glückhafte Zufall, der für die Zeitbestimmung von Bild und Stich kombinatorisch zu sichernde Daten von urkundlicher
Exaktheit anzufordern gestattet, verleiht der stilpsychologischen Deutung ihres Verknüpftseins eine ungewöhnliche Beweis-
kraft; wie erfolgreich auch der tirolische Maler bemüht ist, die feinnervige Weichheit des Vorbildes durch die Verfestigung
des Gestaltkerns und die Aufopferung des pretiösen Sentiments seiner volkstümlich-derben Auffassung des Passions-
vorgangs, durch das flatternde Schamtuch dem allgemeinen Stilwandel anzupassen, hat er doch mit einer Verkörperung
des an die Geißelsäule gefesselten Heilandes, die sich anno 14981 im Stellungs- und Bewegungsmotiv, im Kontrapost
des Hauptes und in der starken Einziehung der Hüfte über alle fortschrittlicheren Lösungen des Themas hinweg zu dem
um mehr als ein halbes Jahrhundert älteren graphischen Blatte'2 bekennt, den konservativen Tendenzen der bodenständigen
Kunstübung einen vollgültigen Tribut entrichtet.
Hatten die Künstler aus Friedrich Pachers engerer Gefolgschaft selbst dort, wo sie dieses oder jenes Bruchstück aus
dem Erbe des Meisters °(£ ■^5i nicht so sehr in triebhaftem Erahnen einer gemeinsamen Sendung als nach echt mittel-
alterlichem Brauchtum zur praktischen Erleichterung des Arbeitsverfahrens an sich reißen, niemals auf dieVerpersönlichung
ihres wie immer erworbenen Formenbesitzes verzichtet, war es einem entfernten Mitläufer des Pustertaler Meisters vor-
behalten, seiner Erfindungsarmut durch die fast unveränderte Übertragung einer umfänglichen Komposition des Graphikers
aufzuhelfen. Allerdings beruht die — nur mehr in einem getreuen Nachstich Israhels van Meckenem gerettete —
Darstellung der »Beweinung Christi« (Abb. 4),3 die Simon von Taisten innerhalb seiner die Pfarrkirche zu
Obermauern bei Windisch-Matrei schmückenden Freskenreihe4 Zug um Zug wiedererstehen läßt (Abb. 3a), auf einem
innerlich und äußerlich so wohlabgewogenen Aufbau, daß schon die spärlichen Ansätze zu einer freieren Nachbildung
nicht nur dessen physisches Gleichgewicht gefährden, sondern auch die gleichschwebende Grundstimmung wehmütiger
Trauer durch den unversehens hinzukommenden Eindruck dumpfer Erstarrung verfärben: da die vom Aufteilungsplan der
1 Diese Angabe hält sieh an die auf der rückwärtigen Holzversehulung des Magdalenen-Altars ersichtliche Jahreszahl, die Prinz Joseph Clemens
mit vollem Recht ausschließlich für die Vollendung der Predella beansprucht.
2 Die eingestochene Ziffer auf dem »Geißelungs«-Stiche L. I 262, 2 der um ihretwillen berühmten »Passion von 1446«, die bereits die Kenntnis
der einschlägigen Iilätter des Meisters •(£ °^SO' voraussetzt, liefert der inhaltsgleichcn Darstellung des Monogrammisten einen sicheren terminus
ante : vgl. M. Geisberg, Die Anfänge des Kupferstichs, Leipzig s. a. (1023), S. 56 mit T. XLII = Meister der Graphik, hg. v. H. Voss, Bd. 112.
3 Den in M. Geisbergs »Verzeichnis der Kupferstiche Israhels van Meckenem«, Straßburg 1905, Nr. 100, verzeichneten Exemplaren in Bologna
und London hat die Kupferstichauktion CLVII der Firma C. G. Boerner in Leipzig (Mai 1928, vgl. den Versteigerungskatalog Nr. 720, T. XXIX)
ein drittes von hervorragender Druckqualität gesellt, das der obigen Abbildung zugrunde liegt. Die Kopie Meckenems wird von G. nach der Technik in
die Zeit vor der »kleinsten Passion« gesetzt, also »um 1475« datiert; das verlorene Original des Meisters °(£ °,Ä5" dürfte nach dem Verhältnis der
Figuren zur Landschaft, nach den Gesichtstypen und Vegetationsformen dessen »mittlerer« Zeit angehört haben.
* Die bisher eingehendste Würdigung der in den achtziger Jahren des XV. Jahrhunderts vollendeten Wandmalereien und die Klärung der
Zuschreibungsfrage ist H. Semper zu danken: vgl. »Reise-Studien Uber einige Werke tirolischer Malereien im Pustertal und Kärnten«, Jahrbuch der
k. k. Zentr.-Komm. f. Kunst und historische Denkmäler, N. F., Bd. II (1904), wiederabgedruckt in dem Sammelwerke: »Michael und Friedrich Pacher,
Ihr Kreis und ihre Nachfolger«, F.ßlingen a. N. 1911, XL, S. 332 ff. Die »Beweinung« findet sich unter den Langhausfresken, in der fünften Reihe
des zweiten nördlichen Wandfeldes, links unten: vgl. die Abb. 149 a. a. O.
IS
I*
<i
— 48 —
Aß-
ling Christi aus
Gebärde und Kopfneigung von dem Jesu-
Jünger des Kanonblattes L. 31 (Geis-
berg T. 25, Abb. 7) übernimmt, ein ähn-
licher Einwand um so weniger zu
befürchten, als gerade diese Figur des
Meisters •(£ °^>°, wie noch zu zeigen
sein wird, in der örtlich und zeitlich be-
nachbarten Skulptur Südtirols ebenfalls
ihre Spuren hinterlassen hat. Daß sich
aber sogar die durchaus und nicht zuletzt
ob ihres eigenbrötlerischen Gebarens
merkwürdige Predella des »Magda-
lenen«-Altars (Abb. 1), ein später hinzu-
gefügtes Werkstatt-Erzeugnis, das alle
Ausdrucksmittel der von Friedrich Pacher
inaugurierten Kunstrichtung manieristisch
übersteigert, dem hiemit verschärften
den Fresken in
Obermauern.
Reibungswiderstand der angestammten Temperamente zum Trotz zu einer •(£ »-Anleihe bequemt, vermag vielleicht
die Unentrinnbarkeit der in der Idee des »simile« verankerten Bindung am klarsten zu veranschaulichen: die ungezügelte
Leidenschaftlichkeit eines auch im Handwerklichen unausgeglichenen Empfindens, das sich in der stürmischen Rotation
schwingender Kurven, in harten Überschneidungen und krassen Verkürzungen austobt, hat den Künstler nicht daran
verhindert, die Christus-Figur des »Geißelungs«-Stiches L. 40 (Geisberg T. 31, Abb. 2), deren zierliches Tänzeln
einer viel sanfteren Formenrhythmik gehorcht, unter dem Gesichtswinkel eines vergröbernden Kopisten zu wiederholen.
Der glückhafte Zufall, der für die Zeitbestimmung von Bild und Stich kombinatorisch zu sichernde Daten von urkundlicher
Exaktheit anzufordern gestattet, verleiht der stilpsychologischen Deutung ihres Verknüpftseins eine ungewöhnliche Beweis-
kraft; wie erfolgreich auch der tirolische Maler bemüht ist, die feinnervige Weichheit des Vorbildes durch die Verfestigung
des Gestaltkerns und die Aufopferung des pretiösen Sentiments seiner volkstümlich-derben Auffassung des Passions-
vorgangs, durch das flatternde Schamtuch dem allgemeinen Stilwandel anzupassen, hat er doch mit einer Verkörperung
des an die Geißelsäule gefesselten Heilandes, die sich anno 14981 im Stellungs- und Bewegungsmotiv, im Kontrapost
des Hauptes und in der starken Einziehung der Hüfte über alle fortschrittlicheren Lösungen des Themas hinweg zu dem
um mehr als ein halbes Jahrhundert älteren graphischen Blatte'2 bekennt, den konservativen Tendenzen der bodenständigen
Kunstübung einen vollgültigen Tribut entrichtet.
Hatten die Künstler aus Friedrich Pachers engerer Gefolgschaft selbst dort, wo sie dieses oder jenes Bruchstück aus
dem Erbe des Meisters °(£ ■^5i nicht so sehr in triebhaftem Erahnen einer gemeinsamen Sendung als nach echt mittel-
alterlichem Brauchtum zur praktischen Erleichterung des Arbeitsverfahrens an sich reißen, niemals auf dieVerpersönlichung
ihres wie immer erworbenen Formenbesitzes verzichtet, war es einem entfernten Mitläufer des Pustertaler Meisters vor-
behalten, seiner Erfindungsarmut durch die fast unveränderte Übertragung einer umfänglichen Komposition des Graphikers
aufzuhelfen. Allerdings beruht die — nur mehr in einem getreuen Nachstich Israhels van Meckenem gerettete —
Darstellung der »Beweinung Christi« (Abb. 4),3 die Simon von Taisten innerhalb seiner die Pfarrkirche zu
Obermauern bei Windisch-Matrei schmückenden Freskenreihe4 Zug um Zug wiedererstehen läßt (Abb. 3a), auf einem
innerlich und äußerlich so wohlabgewogenen Aufbau, daß schon die spärlichen Ansätze zu einer freieren Nachbildung
nicht nur dessen physisches Gleichgewicht gefährden, sondern auch die gleichschwebende Grundstimmung wehmütiger
Trauer durch den unversehens hinzukommenden Eindruck dumpfer Erstarrung verfärben: da die vom Aufteilungsplan der
1 Diese Angabe hält sieh an die auf der rückwärtigen Holzversehulung des Magdalenen-Altars ersichtliche Jahreszahl, die Prinz Joseph Clemens
mit vollem Recht ausschließlich für die Vollendung der Predella beansprucht.
2 Die eingestochene Ziffer auf dem »Geißelungs«-Stiche L. I 262, 2 der um ihretwillen berühmten »Passion von 1446«, die bereits die Kenntnis
der einschlägigen Iilätter des Meisters •(£ °^SO' voraussetzt, liefert der inhaltsgleichcn Darstellung des Monogrammisten einen sicheren terminus
ante : vgl. M. Geisberg, Die Anfänge des Kupferstichs, Leipzig s. a. (1023), S. 56 mit T. XLII = Meister der Graphik, hg. v. H. Voss, Bd. 112.
3 Den in M. Geisbergs »Verzeichnis der Kupferstiche Israhels van Meckenem«, Straßburg 1905, Nr. 100, verzeichneten Exemplaren in Bologna
und London hat die Kupferstichauktion CLVII der Firma C. G. Boerner in Leipzig (Mai 1928, vgl. den Versteigerungskatalog Nr. 720, T. XXIX)
ein drittes von hervorragender Druckqualität gesellt, das der obigen Abbildung zugrunde liegt. Die Kopie Meckenems wird von G. nach der Technik in
die Zeit vor der »kleinsten Passion« gesetzt, also »um 1475« datiert; das verlorene Original des Meisters °(£ °,Ä5" dürfte nach dem Verhältnis der
Figuren zur Landschaft, nach den Gesichtstypen und Vegetationsformen dessen »mittlerer« Zeit angehört haben.
* Die bisher eingehendste Würdigung der in den achtziger Jahren des XV. Jahrhunderts vollendeten Wandmalereien und die Klärung der
Zuschreibungsfrage ist H. Semper zu danken: vgl. »Reise-Studien Uber einige Werke tirolischer Malereien im Pustertal und Kärnten«, Jahrbuch der
k. k. Zentr.-Komm. f. Kunst und historische Denkmäler, N. F., Bd. II (1904), wiederabgedruckt in dem Sammelwerke: »Michael und Friedrich Pacher,
Ihr Kreis und ihre Nachfolger«, F.ßlingen a. N. 1911, XL, S. 332 ff. Die »Beweinung« findet sich unter den Langhausfresken, in der fünften Reihe
des zweiten nördlichen Wandfeldes, links unten: vgl. die Abb. 149 a. a. O.
IS
I*
<i
— 48 —