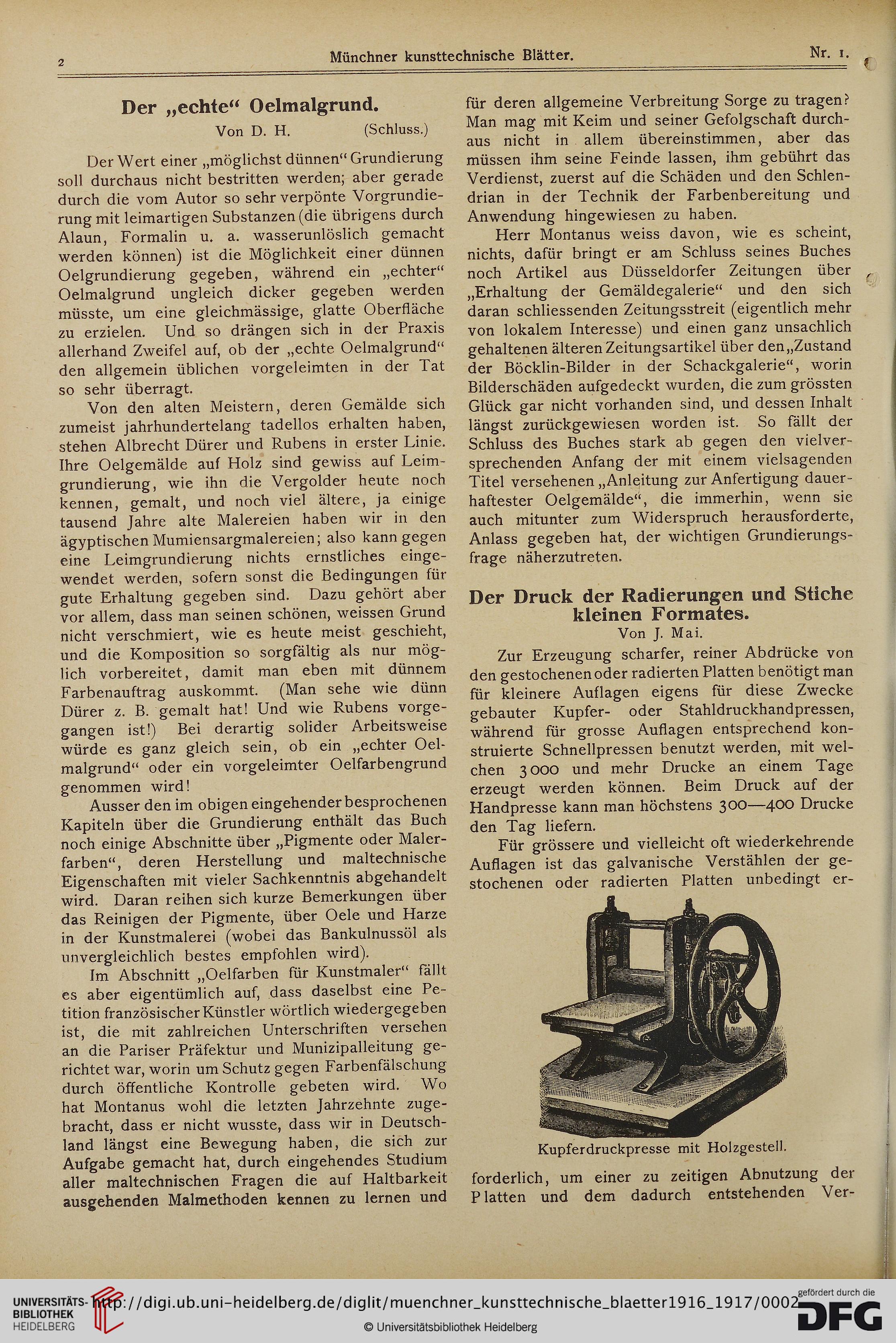2
Münchner kunsttechnische Blätter.
Nr.:.
Der „echte" Oelmalgrund.
VonD. H. (Schluss.)
Der Wert einer „möglichst dünnen" Grundierung
soll durchaus nicht bestritten werden; aber gerade
durch die vom Autor so sehr verpönte Vorgrundie-
rung mit leimartigen Substanzen (die übrigens durch
Alaun, Formalin u. a. wasserunlöslich gemacht
werden können) ist die Möglichkeit einer dünnen
Oelgrundierung gegeben, während ein „echter"
Oelmalgrund ungleich dicker gegeben werden
müsste, um eine gleichmässige, glatte Oberfläche
zu erzielen. Und so drängen sich in der Praxis
allerhand Zweifel auf, ob der „echte. Oelmalgrund"
den allgemein üblichen vorgeleimten in der Tat
so sehr überragt.
Von den alten Meistern, deren Gemälde sich
zumeist jahrhundertelang tadellos erhalten haben,
stehen Albrecht Dürer und Rubens in erster Linie.
Ihre Oelgemälde auf Holz sind gewiss auf Leim-
grundierung, wie ihn die Vergolder heute noch
kennen, gemalt, und noch viel ältere, ja einige
tausend Jahre alte Malereien haben wir in den
ägyptischen Mumiensargmalereien; also kann gegen
eine Leimgrundierung nichts ernstliches einge-
wendet werden, sofern sonst die Bedingungen für
gute Erhaltung gegeben sind. Dazu gehört aber
vor allem, dass man seinen schönen, weissen Grund
nicht verschmiert, wie es heute meist geschieht,
und die Komposition so sorgfältig als nur mög-
lich vorbereitet, damit man eben mit dünnem
Farbenauftrag auskommt. (Man sehe wie dünn
Dürer z. B. gemalt hat! Und wie Rubens vorge-
gangen ist!) Bei derartig solider Arbeitsweise
würde es ganz gleich sein, ob ein „echter Oel-
malgrund" oder ein vorgeleimter Oelfarbengrund
genommen wird!
Ausser den im obigen eingehender besprochenen
Kapiteln über die Grundierung enthält das Buch
noch einige Abschnitte über „Pigmente oder Maler-
farben", deren Herstellung und maltechnische
Eigenschaften mit vieler Sachkenntnis abgehandelt
wird. Daran reihen sich kurze Bemerkungen über
das Reinigen der Pigmente, über Oele und Harze
in der Kunstmalerei (wobei das Bankulnussöl als
unvergleichlich bestes empfohlen wird).
Im Abschnitt „Oelfarben für Kunstmaler" fällt
es aber eigentümlich auf, dass daselbst eine Pe-
tition französischer Künstler wörtlich wiedergegeben
ist, die mit zahlreichen Unterschriften versehen
an die Pariser Präfektur und Munizipalleitung ge-
richtet war, worin um Schutz gegen Farbenfälschung
durch öffentliche Kontrolle gebeten wird. Wo
hat Montanus wohl die letzten Jahrzehnte zuge-
bracht, dass er nicht wusste, dass wir in Deutsch-
land längst eine Bewegung haben, die sich zur
Aufgabe gemacht hat, durch eingehendes Studium
aller maltechnischen Fragen die auf Haltbarkeit
ausgehenden Malmethoden kennen zu lernen und
für deren allgemeine Verbreitung Sorge zu tragen?
Man mag mit Keim und seiner Gefolgschaft durch-
aus nicht in allem übereinstimmen, aber das
müssen ihm seine Feinde lassen, ihm gebührt das
Verdienst, zuerst auf die Schäden und den Schlen-
drian in der Technik der Farbenbereitung und
Anwendung hingewiesen zu haben.
Herr Montanus weiss davon, wie es scheint,
nichts, dafür bringt er am Schluss seines Buches
noch Artikel aus Düsseldorfer Zeitungen über
„Erhaltung der Gemäldegalerie" und den sich
daran schliessenden Zeitungsstreit (eigentlich mehr
von lokalem Interesse) und einen ganz unsachlich
gehaltenen älteren Zeitungsartikel über den„Zustand
der Böcklin-Bilder in der Schackgalerie", worin
Bilderschäden aufgedeckt wurden, die zum grössten
Glück gar nicht vorhanden sind, und dessen Inhalt
längst zurückgewiesen worden ist. So fällt der
Schluss des Buches stark ab gegen den vielver-
sprechenden Anfang der mit einem vielsagenden
Titel versehenen „Anleitung zur Anfertigung dauer-
haftester Oelgemälde", die immerhin, wenn sie
auch mitunter zum Widerspruch herausforderte,
Anlass gegeben hat, der wichtigen Grundierungs-
frage näherzutreten.
Der Druck der Radierungen und Stiche
kleinen Formates.
Von J. Mai.
Zur Erzeugung scharfer, reiner Abdrücke von
den gestochenen oder radierten Platten benötigt man
für kleinere Auflagen eigens für diese Zwecke
gebauter Kupfer- oder Stahldruckhandpressen,
während für grosse Auflagen entsprechend kon-
struierte Schnellpressen benutzt werden, mit wel-
chen 3000 und mehr Drucke an einem Tage
erzeugt werden können. Beim Druck auf der
Handpresse kann man höchstens 300—400 Drucke
den Tag liefern.
Für grössere und vielleicht oft wiederkehrende
Auflagen ist das galvanische Verstählen der ge-
stochenen oder radierten Platten unbedingt er-
Kupferdruckpresse mit Holzgeste!!.
forderlich, um einer zu zeitigen Abnutzung der
Platten und dem dadurch entstehenden Ver-
Münchner kunsttechnische Blätter.
Nr.:.
Der „echte" Oelmalgrund.
VonD. H. (Schluss.)
Der Wert einer „möglichst dünnen" Grundierung
soll durchaus nicht bestritten werden; aber gerade
durch die vom Autor so sehr verpönte Vorgrundie-
rung mit leimartigen Substanzen (die übrigens durch
Alaun, Formalin u. a. wasserunlöslich gemacht
werden können) ist die Möglichkeit einer dünnen
Oelgrundierung gegeben, während ein „echter"
Oelmalgrund ungleich dicker gegeben werden
müsste, um eine gleichmässige, glatte Oberfläche
zu erzielen. Und so drängen sich in der Praxis
allerhand Zweifel auf, ob der „echte. Oelmalgrund"
den allgemein üblichen vorgeleimten in der Tat
so sehr überragt.
Von den alten Meistern, deren Gemälde sich
zumeist jahrhundertelang tadellos erhalten haben,
stehen Albrecht Dürer und Rubens in erster Linie.
Ihre Oelgemälde auf Holz sind gewiss auf Leim-
grundierung, wie ihn die Vergolder heute noch
kennen, gemalt, und noch viel ältere, ja einige
tausend Jahre alte Malereien haben wir in den
ägyptischen Mumiensargmalereien; also kann gegen
eine Leimgrundierung nichts ernstliches einge-
wendet werden, sofern sonst die Bedingungen für
gute Erhaltung gegeben sind. Dazu gehört aber
vor allem, dass man seinen schönen, weissen Grund
nicht verschmiert, wie es heute meist geschieht,
und die Komposition so sorgfältig als nur mög-
lich vorbereitet, damit man eben mit dünnem
Farbenauftrag auskommt. (Man sehe wie dünn
Dürer z. B. gemalt hat! Und wie Rubens vorge-
gangen ist!) Bei derartig solider Arbeitsweise
würde es ganz gleich sein, ob ein „echter Oel-
malgrund" oder ein vorgeleimter Oelfarbengrund
genommen wird!
Ausser den im obigen eingehender besprochenen
Kapiteln über die Grundierung enthält das Buch
noch einige Abschnitte über „Pigmente oder Maler-
farben", deren Herstellung und maltechnische
Eigenschaften mit vieler Sachkenntnis abgehandelt
wird. Daran reihen sich kurze Bemerkungen über
das Reinigen der Pigmente, über Oele und Harze
in der Kunstmalerei (wobei das Bankulnussöl als
unvergleichlich bestes empfohlen wird).
Im Abschnitt „Oelfarben für Kunstmaler" fällt
es aber eigentümlich auf, dass daselbst eine Pe-
tition französischer Künstler wörtlich wiedergegeben
ist, die mit zahlreichen Unterschriften versehen
an die Pariser Präfektur und Munizipalleitung ge-
richtet war, worin um Schutz gegen Farbenfälschung
durch öffentliche Kontrolle gebeten wird. Wo
hat Montanus wohl die letzten Jahrzehnte zuge-
bracht, dass er nicht wusste, dass wir in Deutsch-
land längst eine Bewegung haben, die sich zur
Aufgabe gemacht hat, durch eingehendes Studium
aller maltechnischen Fragen die auf Haltbarkeit
ausgehenden Malmethoden kennen zu lernen und
für deren allgemeine Verbreitung Sorge zu tragen?
Man mag mit Keim und seiner Gefolgschaft durch-
aus nicht in allem übereinstimmen, aber das
müssen ihm seine Feinde lassen, ihm gebührt das
Verdienst, zuerst auf die Schäden und den Schlen-
drian in der Technik der Farbenbereitung und
Anwendung hingewiesen zu haben.
Herr Montanus weiss davon, wie es scheint,
nichts, dafür bringt er am Schluss seines Buches
noch Artikel aus Düsseldorfer Zeitungen über
„Erhaltung der Gemäldegalerie" und den sich
daran schliessenden Zeitungsstreit (eigentlich mehr
von lokalem Interesse) und einen ganz unsachlich
gehaltenen älteren Zeitungsartikel über den„Zustand
der Böcklin-Bilder in der Schackgalerie", worin
Bilderschäden aufgedeckt wurden, die zum grössten
Glück gar nicht vorhanden sind, und dessen Inhalt
längst zurückgewiesen worden ist. So fällt der
Schluss des Buches stark ab gegen den vielver-
sprechenden Anfang der mit einem vielsagenden
Titel versehenen „Anleitung zur Anfertigung dauer-
haftester Oelgemälde", die immerhin, wenn sie
auch mitunter zum Widerspruch herausforderte,
Anlass gegeben hat, der wichtigen Grundierungs-
frage näherzutreten.
Der Druck der Radierungen und Stiche
kleinen Formates.
Von J. Mai.
Zur Erzeugung scharfer, reiner Abdrücke von
den gestochenen oder radierten Platten benötigt man
für kleinere Auflagen eigens für diese Zwecke
gebauter Kupfer- oder Stahldruckhandpressen,
während für grosse Auflagen entsprechend kon-
struierte Schnellpressen benutzt werden, mit wel-
chen 3000 und mehr Drucke an einem Tage
erzeugt werden können. Beim Druck auf der
Handpresse kann man höchstens 300—400 Drucke
den Tag liefern.
Für grössere und vielleicht oft wiederkehrende
Auflagen ist das galvanische Verstählen der ge-
stochenen oder radierten Platten unbedingt er-
Kupferdruckpresse mit Holzgeste!!.
forderlich, um einer zu zeitigen Abnutzung der
Platten und dem dadurch entstehenden Ver-