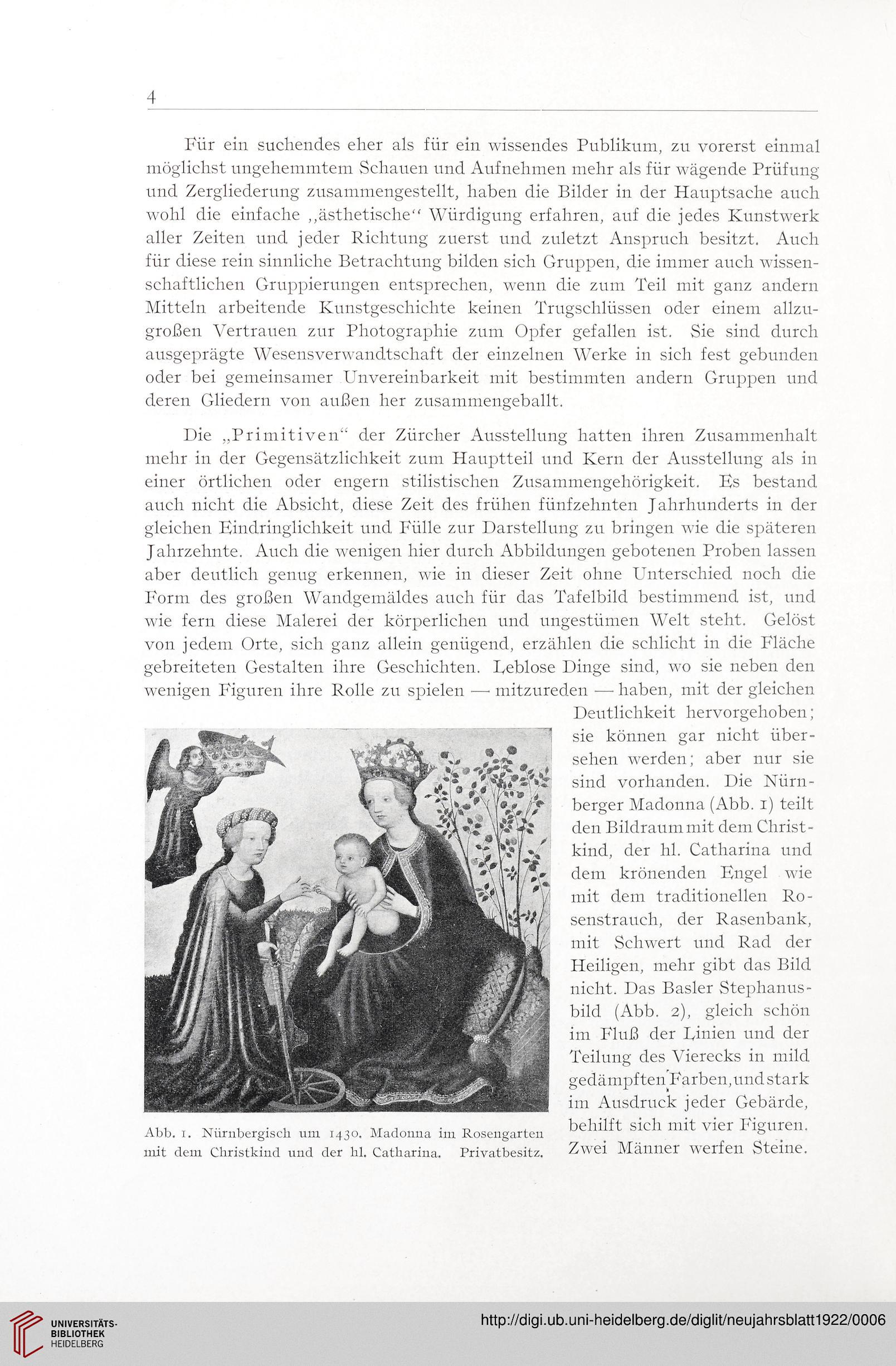4
Für ein suchendes eher als für ein wissendes Publikum, zu vorerst einmal
möglichst ungehemmtem Schauen und Aufnehmen mehr als für wägende Prüfung
und Zergliederung zusammengestellt, haben die Bilder in der Hauptsache auch
wohl die einfache ,,ästhetische“ Würdigung erfahren, auf die jedes Kunstwerk
aller Zeiten und jeder Richtung zuerst und zuletzt Anspruch besitzt. Auch
für diese rein sinnliche Betrachtung bilden sich Gruppen, die immer auch wissen-
schaftlichen Gruppierungen entsprechen, wenn die zum Teil mit ganz andern
Mitteln arbeitende Kunstgeschichte keinen Trugschlüssen oder einem allzu-
großen Vertrauen zur Photographie zum Opfer gefallen ist. Sie sind durch
ausgeprägte Wesensverwandtschaft der einzelnen Werke in sich fest gebunden
oder bei gemeinsamer Unvereinbarkeit mit bestimmten andern Gruppen und
deren Gliedern von außen her zusammengeballt.
Die „Primitiven“ der Zürcher Ausstellung hatten ihren Zusammenhalt
mehr in der Gegensätzlichkeit zum Hauptteil und Kern der Ausstellung als in
einer örtlichen oder engern stilistischen Zusammengehörigkeit. Bs bestand
auch nicht die Absicht, diese Zeit des frühen fünfzehnten Jahrhunderts in der
gleichen Bindringlichkeit und Fülle zur Darstellung zu bringen wie die späteren
Jahrzehnte. Auch die wenigen hier durch Abbildungen gebotenen Proben lassen
aber deutlich genug erkennen, wie in dieser Zeit ohne Unterschied noch die
Form des großen Wandgemäldes auch für das Tafelbild bestimmend ist, und
wie fern diese Malerei der körperlichen und ungestümen Welt steht. Gelöst
von jedem Orte, sich ganz allein genügend, erzählen die schlicht in die Fläche
gebreiteten Gestalten ihre Geschichten. Leblose Dinge sind, wo sie neben den
wenigen Figuren ihre Rolle zu spielen -—- mitzureden — haben, mit der gleichen
Deutlichkeit hervorgehoben;
sie können gar nicht über-
sehen werden; aber nur sie
sind vorhanden. Die Nürn-
berger Madonna (Abb. i) teilt
den Bildraum mit dem Christ-
kind, der hl. Catharina und
dem krönenden Bngel wie
mit dem traditionellen Ro-
senstrauch, der Rasenbank,
mit Schwert und Rad der
Heiligen, mehr gibt das Bild
nicht. Das Basler Stephanus -
bild (Abb. 2), gleich schön
im Fluß der Linien und der
Teilung des Vierecks in mild
gedämpf ten Farben, und stark
im Ausdruck jeder Gebärde,
A1, xt- 1 ■ 1 . • -n j. behilft sich mit vier Figuren.
Abb. 1. Nurnbergisch 11111 1430. Madonna 1111 Rosengarten ö
mit dem Christkind und der hl. Catharina. Privatbesitz. Zwei Männer werfen Steine.
Für ein suchendes eher als für ein wissendes Publikum, zu vorerst einmal
möglichst ungehemmtem Schauen und Aufnehmen mehr als für wägende Prüfung
und Zergliederung zusammengestellt, haben die Bilder in der Hauptsache auch
wohl die einfache ,,ästhetische“ Würdigung erfahren, auf die jedes Kunstwerk
aller Zeiten und jeder Richtung zuerst und zuletzt Anspruch besitzt. Auch
für diese rein sinnliche Betrachtung bilden sich Gruppen, die immer auch wissen-
schaftlichen Gruppierungen entsprechen, wenn die zum Teil mit ganz andern
Mitteln arbeitende Kunstgeschichte keinen Trugschlüssen oder einem allzu-
großen Vertrauen zur Photographie zum Opfer gefallen ist. Sie sind durch
ausgeprägte Wesensverwandtschaft der einzelnen Werke in sich fest gebunden
oder bei gemeinsamer Unvereinbarkeit mit bestimmten andern Gruppen und
deren Gliedern von außen her zusammengeballt.
Die „Primitiven“ der Zürcher Ausstellung hatten ihren Zusammenhalt
mehr in der Gegensätzlichkeit zum Hauptteil und Kern der Ausstellung als in
einer örtlichen oder engern stilistischen Zusammengehörigkeit. Bs bestand
auch nicht die Absicht, diese Zeit des frühen fünfzehnten Jahrhunderts in der
gleichen Bindringlichkeit und Fülle zur Darstellung zu bringen wie die späteren
Jahrzehnte. Auch die wenigen hier durch Abbildungen gebotenen Proben lassen
aber deutlich genug erkennen, wie in dieser Zeit ohne Unterschied noch die
Form des großen Wandgemäldes auch für das Tafelbild bestimmend ist, und
wie fern diese Malerei der körperlichen und ungestümen Welt steht. Gelöst
von jedem Orte, sich ganz allein genügend, erzählen die schlicht in die Fläche
gebreiteten Gestalten ihre Geschichten. Leblose Dinge sind, wo sie neben den
wenigen Figuren ihre Rolle zu spielen -—- mitzureden — haben, mit der gleichen
Deutlichkeit hervorgehoben;
sie können gar nicht über-
sehen werden; aber nur sie
sind vorhanden. Die Nürn-
berger Madonna (Abb. i) teilt
den Bildraum mit dem Christ-
kind, der hl. Catharina und
dem krönenden Bngel wie
mit dem traditionellen Ro-
senstrauch, der Rasenbank,
mit Schwert und Rad der
Heiligen, mehr gibt das Bild
nicht. Das Basler Stephanus -
bild (Abb. 2), gleich schön
im Fluß der Linien und der
Teilung des Vierecks in mild
gedämpf ten Farben, und stark
im Ausdruck jeder Gebärde,
A1, xt- 1 ■ 1 . • -n j. behilft sich mit vier Figuren.
Abb. 1. Nurnbergisch 11111 1430. Madonna 1111 Rosengarten ö
mit dem Christkind und der hl. Catharina. Privatbesitz. Zwei Männer werfen Steine.