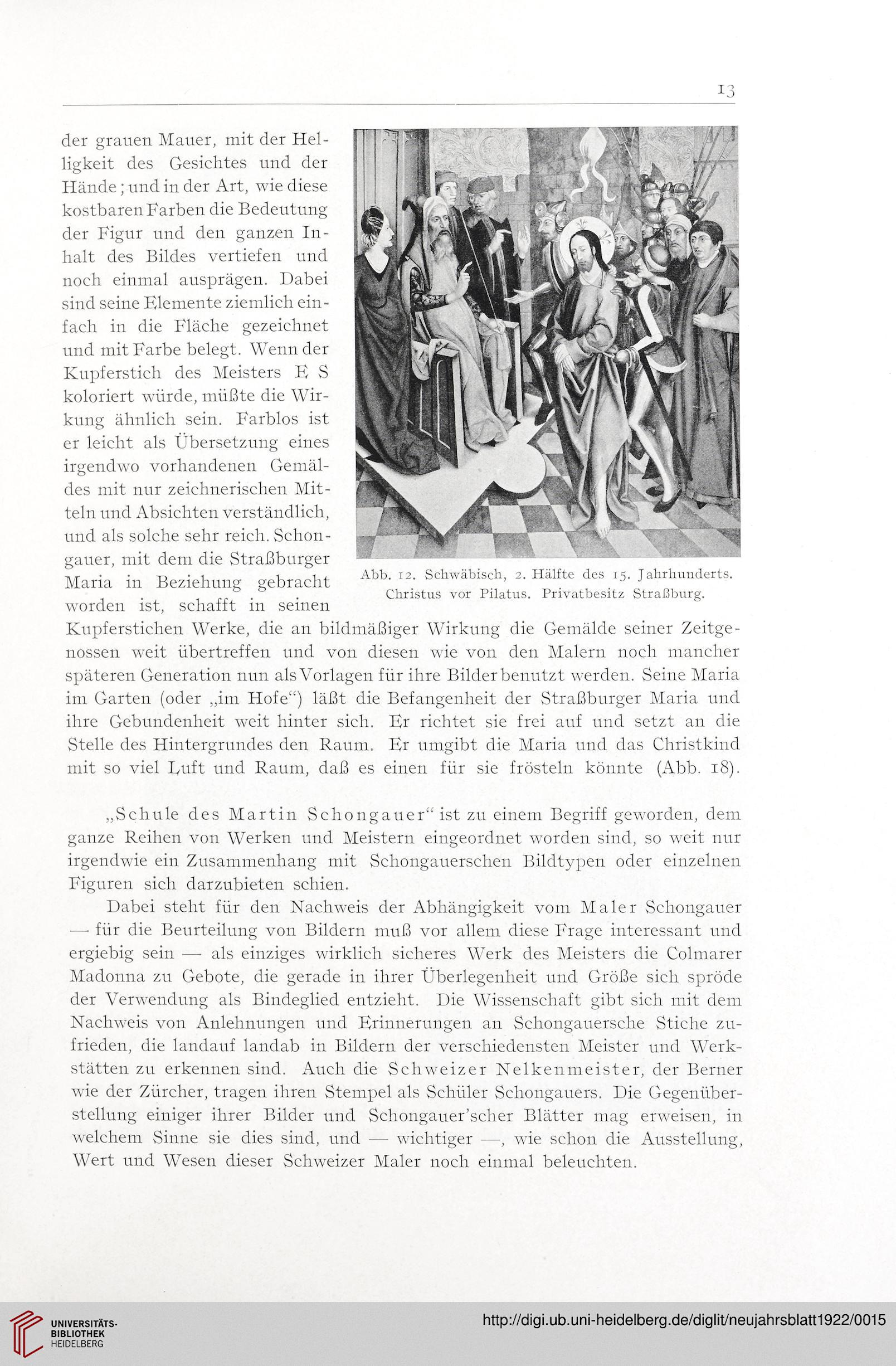der grauen Mauer, mit der Hel¬
ligkeit des Gesichtes und der
Hände; und in der Art, wie diese
kostbaren Farben die Bedeutung
der Figur und den ganzen In¬
halt des Bildes vertiefen und
noch einmal ausprägen. Dabei
sind seine Elemente ziemlich ein¬
fach in die Fläche gezeichnet
und mit Farbe belegt. Wenn der
Kupferstich des Meisters E S
koloriert würde, müßte die Wir¬
kung ähnlich sein. Farblos ist
er leicht als Übersetzung eines
irgendwo vorhandenen Gemäl¬
des mit nur zeichnerischen Mit¬
teln und Absichten verständlich,
und als solche sehr reich. Schon¬
gauer, mit dem die Straßburger
Maria in Beziehung gebracht
worden ist, schafft in seinen
Kupferstichen Werke, die an bildmäßiger Wirkung die Gemälde seiner Zeitge-
nossen weit übertreffen und von diesen wie von den Malern noch mancher
späteren Generation nun als Vorlagen für ihre Bilder benutzt werden. Seine Maria
im Garten (oder „im Hofe“) läßt die Befangenheit der Straßburger Maria und
ihre Gebundenheit weit hinter sich. Br richtet sie frei auf und setzt an die
Stelle des Hintergrundes den Raum, Br umgibt die Maria und das Christkind
mit so viel Ruft und Raum, daß es einen für sie frösteln könnte (Abb. 18).
Abb. 12. Schwäbisch, 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Christus vor Pilatus. Privatbesitz Straßburg.
„Schule des Martin Schongauer“ ist zu einem Begriff geworden, dem
ganze Reihen von Werken und Meistern eingeordnet worden sind, so weit nur
irgendwie ein Zusammenhang mit Schongauerschen Bildtypen oder einzelnen
Figuren sich darzubieten schien.
Dabei steht für den Nachweis der Abhängigkeit vom Maler Schongauer
— für die Beurteilung von Bildern muß vor allem diese Frage interessant und
ergiebig sein — als einziges wirklich sicheres Werk des Meisters die Colmarer
Madonna zu Gebote, die gerade in ihrer Überlegenheit und Größe sich spröde
der Verwendung als Bindeglied entzieht. Die Wissenschaft gibt sich mit dem
Nachweis von Anlehnungen und Erinnerungen an Schongauersche Stiche zu-
frieden, die landauf landab in Bildern der verschiedensten Meister und Werk-
stätten zu erkennen sind. Auch die Schweizer Nelkenmeister, der Berner
wie der Zürcher, tragen ihren Stempel als Schüler Schongauers. Die Gegenüber-
stellung einiger ihrer Bilder und Schongauer’scher Blätter mag erweisen, in
welchem Sinne sie dies sind, und ■— wichtiger —, wie schon die Ausstellung,
Wert und Wesen dieser Schweizer Maler noch einmal beleuchten.
ligkeit des Gesichtes und der
Hände; und in der Art, wie diese
kostbaren Farben die Bedeutung
der Figur und den ganzen In¬
halt des Bildes vertiefen und
noch einmal ausprägen. Dabei
sind seine Elemente ziemlich ein¬
fach in die Fläche gezeichnet
und mit Farbe belegt. Wenn der
Kupferstich des Meisters E S
koloriert würde, müßte die Wir¬
kung ähnlich sein. Farblos ist
er leicht als Übersetzung eines
irgendwo vorhandenen Gemäl¬
des mit nur zeichnerischen Mit¬
teln und Absichten verständlich,
und als solche sehr reich. Schon¬
gauer, mit dem die Straßburger
Maria in Beziehung gebracht
worden ist, schafft in seinen
Kupferstichen Werke, die an bildmäßiger Wirkung die Gemälde seiner Zeitge-
nossen weit übertreffen und von diesen wie von den Malern noch mancher
späteren Generation nun als Vorlagen für ihre Bilder benutzt werden. Seine Maria
im Garten (oder „im Hofe“) läßt die Befangenheit der Straßburger Maria und
ihre Gebundenheit weit hinter sich. Br richtet sie frei auf und setzt an die
Stelle des Hintergrundes den Raum, Br umgibt die Maria und das Christkind
mit so viel Ruft und Raum, daß es einen für sie frösteln könnte (Abb. 18).
Abb. 12. Schwäbisch, 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Christus vor Pilatus. Privatbesitz Straßburg.
„Schule des Martin Schongauer“ ist zu einem Begriff geworden, dem
ganze Reihen von Werken und Meistern eingeordnet worden sind, so weit nur
irgendwie ein Zusammenhang mit Schongauerschen Bildtypen oder einzelnen
Figuren sich darzubieten schien.
Dabei steht für den Nachweis der Abhängigkeit vom Maler Schongauer
— für die Beurteilung von Bildern muß vor allem diese Frage interessant und
ergiebig sein — als einziges wirklich sicheres Werk des Meisters die Colmarer
Madonna zu Gebote, die gerade in ihrer Überlegenheit und Größe sich spröde
der Verwendung als Bindeglied entzieht. Die Wissenschaft gibt sich mit dem
Nachweis von Anlehnungen und Erinnerungen an Schongauersche Stiche zu-
frieden, die landauf landab in Bildern der verschiedensten Meister und Werk-
stätten zu erkennen sind. Auch die Schweizer Nelkenmeister, der Berner
wie der Zürcher, tragen ihren Stempel als Schüler Schongauers. Die Gegenüber-
stellung einiger ihrer Bilder und Schongauer’scher Blätter mag erweisen, in
welchem Sinne sie dies sind, und ■— wichtiger —, wie schon die Ausstellung,
Wert und Wesen dieser Schweizer Maler noch einmal beleuchten.