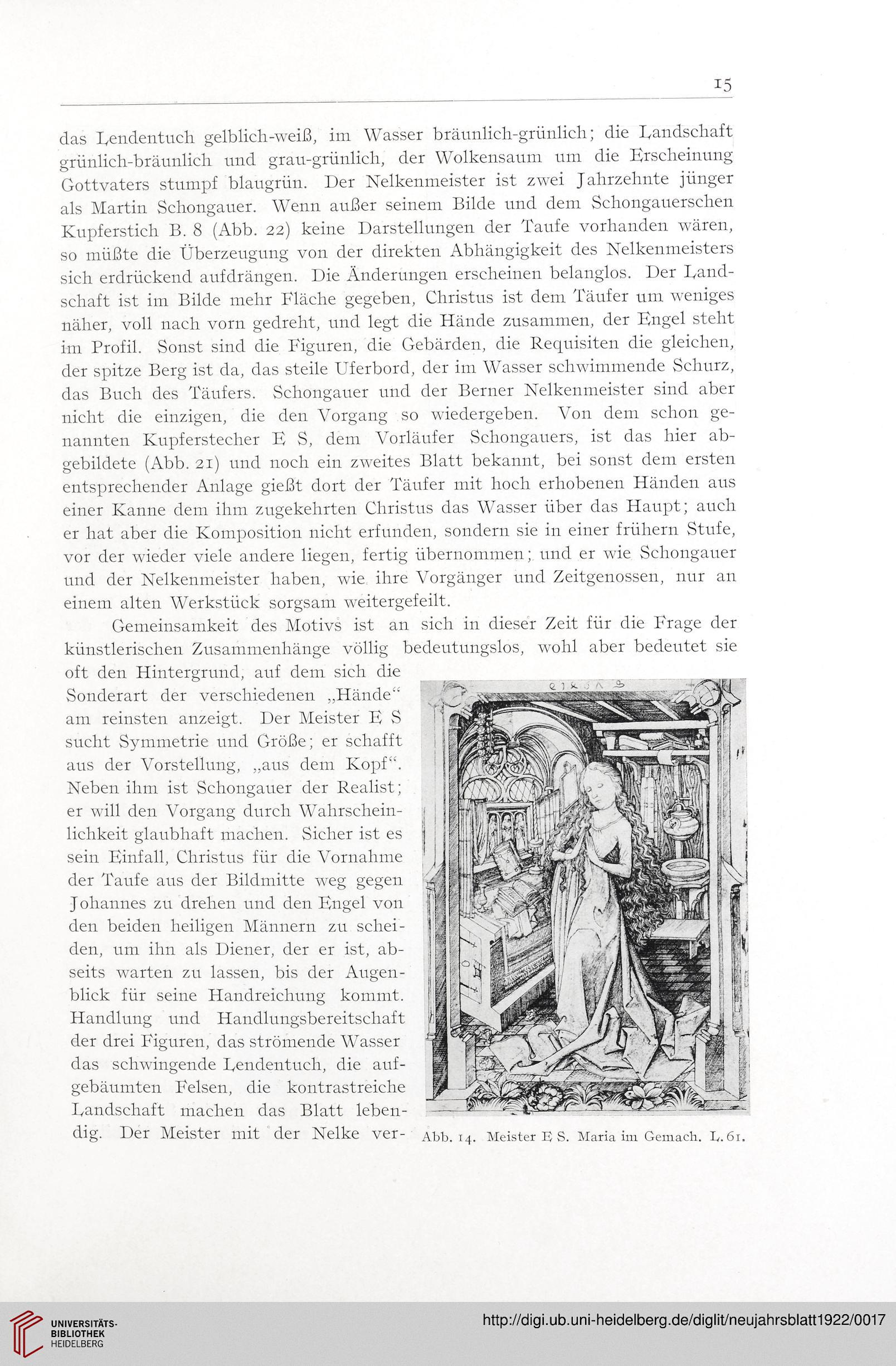i5
das Lendentuch gelblich-weiß, im Wasser bräunlich-grünlich; die Landschaft
grünlich-bräunlich und grau-grünlich, der Wolkensaum um die Erscheinung
Gottvaters stumpf blaugrün. Der Nelkenmeister ist zwei Jahrzehnte jünger
als Martin Schongauer. Wenn außer seinem Bilde und dem Schongauerschen
Kupferstich B. 8 (Abb. 22) keine Darstellungen der Taufe vorhanden wären,
so müßte die Überzeugung von der direkten Abhängigkeit des Nelkenmeisters
sich erdrückend aufdrängen. Die Änderungen erscheinen belanglos. Der Land-
schaft ist im Bilde mehr Fläche gegeben, Christus ist dem Täufer um weniges
näher, voll nach vorn gedreht, und legt die Hände zusammen, der Engel steht
im Profil. Sonst sind die Figuren, die Gebärden, die Requisiten die gleichen,
der spitze Berg ist da, das steile Uferbord, der im Wasser schwimmende Schurz,
das Buch des Täufers. Schongauer und der Berner Nelkenmeister sind aber
nicht die einzigen, die den Vorgang so wiedergeben. Von dem schon ge-
nannten Kupferstecher E S, dem Vorläufer Schongauers, ist das hier ab-
gebildete (Abb. 21) und noch ein zweites Blatt bekannt, bei sonst dem ersten
entsprechender Anlage gießt dort der Täufer mit hoch erhobenen Händen aus
einer Kanne dem ihm zugekehrten Christus das Wasser über das Haupt; auch
er hat aber die Komposition nicht erfunden, sondern sie in einer frühem Stufe,
vor der wieder viele andere liegen, fertig übernommen; und er wie Schongauer
und der Nelkenmeister haben, wie ihre Vorgänger und Zeitgenossen, nur an
einem alten Werkstück sorgsam weitergefeilt.
Gemeinsamkeit des Motivs ist an sich in dieser Zeit für die Frage der
künstlerischen Zusammenhänge völlig bedeutungslos, wohl aber bedeutet sie
oft den Hintergrund, auf dem sich die
Sonderart der verschiedenen „Hände“
am reinsten anzeigt. Der Meister E S
sucht Symmetrie und Größe; er schafft
aus der Vorstellung, „aus dem Kopf“.
Neben ihm ist Schongauer der Realist;
er will den Vorgang durch Wahrschein¬
lichkeit glaubhaft machen. Sicher ist es
sein Einfall, Christus für die Vornahme
der Taufe aus der Bildmitte weg gegen
J ohannes zu drehen und den Engel von
den beiden heiligen Männern zu schei¬
den, um ihn als Diener, der er ist, ab¬
seits warten zu lassen, bis der Augen¬
blick für seine Handreichung kommt.
Handlung und Handlungsbereitschaft
der drei Figuren, das strömende Wasser
das schwingende Lendentuch, die auf¬
gebäumten Felsen, die kontrastreiche
Landschaft machen das Blatt leben-
dig. Der Meister mit der Nelke ver- Abb. 14. Meister E S. Maria im Gemach. K 61.
das Lendentuch gelblich-weiß, im Wasser bräunlich-grünlich; die Landschaft
grünlich-bräunlich und grau-grünlich, der Wolkensaum um die Erscheinung
Gottvaters stumpf blaugrün. Der Nelkenmeister ist zwei Jahrzehnte jünger
als Martin Schongauer. Wenn außer seinem Bilde und dem Schongauerschen
Kupferstich B. 8 (Abb. 22) keine Darstellungen der Taufe vorhanden wären,
so müßte die Überzeugung von der direkten Abhängigkeit des Nelkenmeisters
sich erdrückend aufdrängen. Die Änderungen erscheinen belanglos. Der Land-
schaft ist im Bilde mehr Fläche gegeben, Christus ist dem Täufer um weniges
näher, voll nach vorn gedreht, und legt die Hände zusammen, der Engel steht
im Profil. Sonst sind die Figuren, die Gebärden, die Requisiten die gleichen,
der spitze Berg ist da, das steile Uferbord, der im Wasser schwimmende Schurz,
das Buch des Täufers. Schongauer und der Berner Nelkenmeister sind aber
nicht die einzigen, die den Vorgang so wiedergeben. Von dem schon ge-
nannten Kupferstecher E S, dem Vorläufer Schongauers, ist das hier ab-
gebildete (Abb. 21) und noch ein zweites Blatt bekannt, bei sonst dem ersten
entsprechender Anlage gießt dort der Täufer mit hoch erhobenen Händen aus
einer Kanne dem ihm zugekehrten Christus das Wasser über das Haupt; auch
er hat aber die Komposition nicht erfunden, sondern sie in einer frühem Stufe,
vor der wieder viele andere liegen, fertig übernommen; und er wie Schongauer
und der Nelkenmeister haben, wie ihre Vorgänger und Zeitgenossen, nur an
einem alten Werkstück sorgsam weitergefeilt.
Gemeinsamkeit des Motivs ist an sich in dieser Zeit für die Frage der
künstlerischen Zusammenhänge völlig bedeutungslos, wohl aber bedeutet sie
oft den Hintergrund, auf dem sich die
Sonderart der verschiedenen „Hände“
am reinsten anzeigt. Der Meister E S
sucht Symmetrie und Größe; er schafft
aus der Vorstellung, „aus dem Kopf“.
Neben ihm ist Schongauer der Realist;
er will den Vorgang durch Wahrschein¬
lichkeit glaubhaft machen. Sicher ist es
sein Einfall, Christus für die Vornahme
der Taufe aus der Bildmitte weg gegen
J ohannes zu drehen und den Engel von
den beiden heiligen Männern zu schei¬
den, um ihn als Diener, der er ist, ab¬
seits warten zu lassen, bis der Augen¬
blick für seine Handreichung kommt.
Handlung und Handlungsbereitschaft
der drei Figuren, das strömende Wasser
das schwingende Lendentuch, die auf¬
gebäumten Felsen, die kontrastreiche
Landschaft machen das Blatt leben-
dig. Der Meister mit der Nelke ver- Abb. 14. Meister E S. Maria im Gemach. K 61.