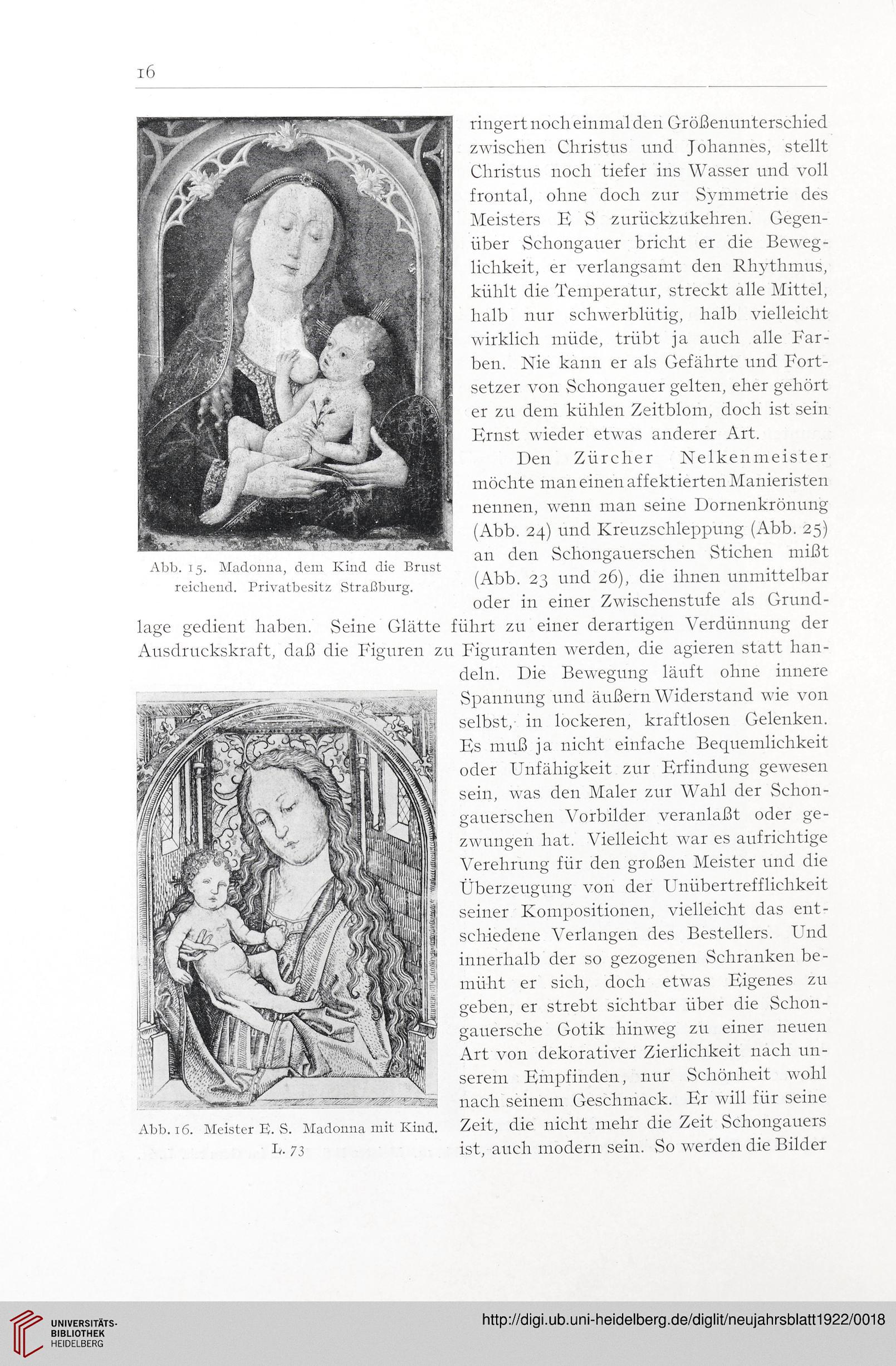ringert noch einmal den Größenunterschied
zwischen Christus und Johannes, stellt
Christus noch tiefer ins Wasser und voll
frontal, ohne doch zur Symmetrie des
Meisters B S zurückzukehren. Gegen-
über Schongauer bricht er die Beweg-
lichkeit, er verlangsamt den Rhythmus,
kühlt die Temperatur, streckt alle Mittel,
halb nur schwerblütig, halb vielleicht
wirklich müde, trübt ja auch alle Far-
ben. Nie kann er als Gefährte und Fort-
setzer von Schongauer gelten, eher gehört
er zu dem kühlen Zeitblom, doch ist sein
Ernst wieder etwas anderer Art.
Den Zürcher Nelkenmeister
möchte man einen affektierten Manieristen
nennen, wenn man seine Dornenkrönung
(Abb. 24) und Kreuzschleppung (Abb. 25)
an den Schongauerschen Stichen mißt
(Abb. 23 und 26), die ihnen unmittelbar
oder in einer Zwischenstufe als Grund-
lage gedient haben. Seine Glätte führt zu einer derartigen Verdünnung der
Ausdruckskraft, daß die Figuren zu Figuranten werden, die agieren statt han¬
deln. Die Bewegung läuft ohne innere
Spannung und äußern Widerstand wie von
selbst, in lockeren, kraftlosen Gelenken.
Bs muß ja nicht einfache Bequemlichkeit
oder Unfähigkeit zur Erfindung gewesen
sein, was den Maler zur Wahl der Schon-
gauerschen Vorbilder veranlaßt oder ge-
zwungen hat. Vielleicht war es aufrichtige
Verehrung für den großen Meister und die
Überzeugung von der Unübertrefflichkeit
seiner Kompositionen, vielleicht das ent-
schiedene Verlangen des Bestellers. Und
innerhalb der so gezogenen Schranken be-
müht er sich, doch etwas Eigenes zu
geben, er strebt sichtbar über die Schon-
gauersche Gotik hinweg zu einer neuen
Art von dekorativer Zierlichkeit nach un-
serem Empfinden, nur Schönheit wohl
nach seinem Geschmack. Er will für seine
Zeit, die nicht mehr die Zeit Schongauers
ist, auch modern sein. So werden die Bilder
Abb. 16. Meister B. S. Madonna mit Kind.
L. 73
Abb. 15. Madonna, dem Kind die Brust
reichend. Privatbesitz Straßburg.
zwischen Christus und Johannes, stellt
Christus noch tiefer ins Wasser und voll
frontal, ohne doch zur Symmetrie des
Meisters B S zurückzukehren. Gegen-
über Schongauer bricht er die Beweg-
lichkeit, er verlangsamt den Rhythmus,
kühlt die Temperatur, streckt alle Mittel,
halb nur schwerblütig, halb vielleicht
wirklich müde, trübt ja auch alle Far-
ben. Nie kann er als Gefährte und Fort-
setzer von Schongauer gelten, eher gehört
er zu dem kühlen Zeitblom, doch ist sein
Ernst wieder etwas anderer Art.
Den Zürcher Nelkenmeister
möchte man einen affektierten Manieristen
nennen, wenn man seine Dornenkrönung
(Abb. 24) und Kreuzschleppung (Abb. 25)
an den Schongauerschen Stichen mißt
(Abb. 23 und 26), die ihnen unmittelbar
oder in einer Zwischenstufe als Grund-
lage gedient haben. Seine Glätte führt zu einer derartigen Verdünnung der
Ausdruckskraft, daß die Figuren zu Figuranten werden, die agieren statt han¬
deln. Die Bewegung läuft ohne innere
Spannung und äußern Widerstand wie von
selbst, in lockeren, kraftlosen Gelenken.
Bs muß ja nicht einfache Bequemlichkeit
oder Unfähigkeit zur Erfindung gewesen
sein, was den Maler zur Wahl der Schon-
gauerschen Vorbilder veranlaßt oder ge-
zwungen hat. Vielleicht war es aufrichtige
Verehrung für den großen Meister und die
Überzeugung von der Unübertrefflichkeit
seiner Kompositionen, vielleicht das ent-
schiedene Verlangen des Bestellers. Und
innerhalb der so gezogenen Schranken be-
müht er sich, doch etwas Eigenes zu
geben, er strebt sichtbar über die Schon-
gauersche Gotik hinweg zu einer neuen
Art von dekorativer Zierlichkeit nach un-
serem Empfinden, nur Schönheit wohl
nach seinem Geschmack. Er will für seine
Zeit, die nicht mehr die Zeit Schongauers
ist, auch modern sein. So werden die Bilder
Abb. 16. Meister B. S. Madonna mit Kind.
L. 73
Abb. 15. Madonna, dem Kind die Brust
reichend. Privatbesitz Straßburg.