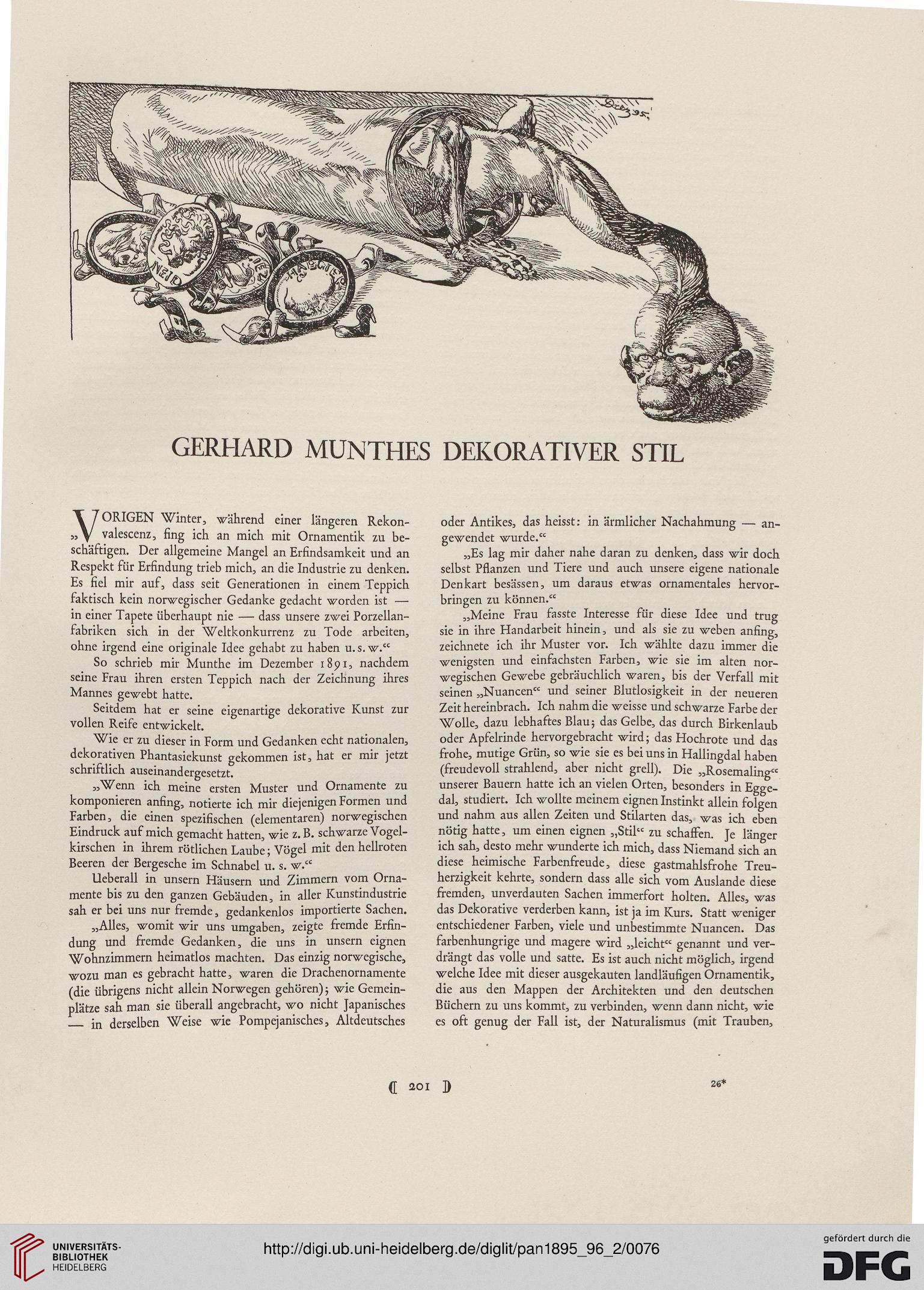GERHARD MUNTHES DEKORATIVER STIL
VORIGEN Winter, während einer längeren Rekon-
yalescenz, fing ich an mich mit Ornamentik zu be-
schäftigen. Der allgemeine Mangel an Erfindsamkeit und an
Respekt für Erfindung trieb mich, an die Industrie zu denken.
Es fiel mir auf, dass seit Generationen in einem Teppich
faktisch kein norwegischer Gedanke gedacht worden ist —
in einer Tapete überhaupt nie — dass unsere zwei Porzellan-
fabriken sich in der Weltkonkurrenz zu Tode arbeiten,
ohne irgend eine originale Idee gehabt zu haben u. s. w."
So schrieb mir Munthe im Dezember 1891, nachdem
seine Frau ihren ersten Teppich nach der Zeichnung ihres
Mannes gewebt hatte.
Seitdem hat er seine eigenartige dekorative Kunst zur
vollen Reife entwickelt.
Wie er zu dieser in Form und Gedanken echt nationalen,
dekorativen Phantasiekunst gekommen ist, hat er mir jetzt
schriftlich auseinandergesetzt.
„Wenn ich meine ersten Muster und Ornamente zu
komponieren anfing, notierte ich mir diejenigen Formen und
Farben, die einen spezifischen (elementaren) norwegischen
Eindruck auf mich gemacht hatten, wie z.B. schwarze Vogel-
kirschen in ihrem rötlichen Laube; Vögel mit den hellroten
Beeren der Bergesche im Schnabel u. s. w."
Ueberall in unsern Häusern und Zimmern vom Orna-
mente bis zu den ganzen Gebäuden, in aller Kunstindustrie
sah er bei uns nur fremde, gedankenlos importierte Sachen.
„Alles, womit wir uns umgaben, zeigte fremde Erfin-
dung und fremde Gedanken, die uns in unsern eignen
Wohnzimmern heimatlos machten. Das einzig norwegische,
wozu man es gebracht hatte, waren die Drachenornamente
(die übrigens nicht allein Norwegen gehören); wie Gemein-
plätze sah man sie überall angebracht, wo nicht Japanisches
__ m derselben Weise wie Pompejanisches, Altdeutsches
oder Antikes, das heisst: in ärmlicher Nachahmung — an-
gewendet wurde."
„Es lag mir daher nahe daran zu denken, dass wir doch
selbst Pflanzen und Tiere und auch unsere eigene nationale
Denkart besässen, um daraus etwas ornamentales hervor-
bringen zu können."
„Meine Frau fasste Interesse für diese Idee und trug
sie in ihre Handarbeit hinein, und als sie zu weben anfing,
zeichnete ich ihr Muster vor. Ich wählte dazu immer die
wenigsten und einfachsten Farben, wie sie im alten nor-
wegischen Gewebe gebräuchlich waren, bis der Verfall mit
seinen „Nuancen" und seiner Blutlosigkeit in der neueren
Zeit hereinbrach. Ich nahm die weisse und schwarze Farbe der
Wolle, dazu lebhaftes Blau; das Gelbe, das durch Birkenlaub
oder Apfelrinde hervorgebracht wird; das Hochrote und das
frohe, mutige Grün, so wie sie es bei uns in Hallingdal haben
(freudevoll strahlend, aber nicht grell). Die „Rosemaling"
unserer Bauern hatte ich an vielen Orten, besonders in Eege-
dal, studiert. Ich wollte meinem eignen Instinkt allein folgen
und nahm aus allen Zeiten und Stilarten das, was ich eben
nötig hatte, um einen eignen „Stil" zu schaffen. Je länger
ich sah, desto mehr wunderte ich mich, dass Niemand sich an
diese heimische Farbenfreude, diese gastmahlsfrohe Treu-
herzigkeit kehrte, sondern dass alle sich vom Auslande diese
fremden, unverdauten Sachen immerfort holten. Alles, was
das Dekorative verderben kann, ist ja im Kurs. Statt weniger
entschiedener Farben, viele und unbestimmte Nuancen. Das
farbenhungrige und magere wird „leicht« genannt und ver-
drängt das volle und satte. Es ist auch nicht möglich, irgend
welche Idee mit dieser ausgekauten landläufigen Ornamentik,
die aus den Mappen der Architekten und den deutschen
Büchern zu uns kommt, zu verbinden, wenn dann nicht, wie
es oft genug der Fall ist, der Naturalismus (mit Trauben,
C 201 J)
26*
VORIGEN Winter, während einer längeren Rekon-
yalescenz, fing ich an mich mit Ornamentik zu be-
schäftigen. Der allgemeine Mangel an Erfindsamkeit und an
Respekt für Erfindung trieb mich, an die Industrie zu denken.
Es fiel mir auf, dass seit Generationen in einem Teppich
faktisch kein norwegischer Gedanke gedacht worden ist —
in einer Tapete überhaupt nie — dass unsere zwei Porzellan-
fabriken sich in der Weltkonkurrenz zu Tode arbeiten,
ohne irgend eine originale Idee gehabt zu haben u. s. w."
So schrieb mir Munthe im Dezember 1891, nachdem
seine Frau ihren ersten Teppich nach der Zeichnung ihres
Mannes gewebt hatte.
Seitdem hat er seine eigenartige dekorative Kunst zur
vollen Reife entwickelt.
Wie er zu dieser in Form und Gedanken echt nationalen,
dekorativen Phantasiekunst gekommen ist, hat er mir jetzt
schriftlich auseinandergesetzt.
„Wenn ich meine ersten Muster und Ornamente zu
komponieren anfing, notierte ich mir diejenigen Formen und
Farben, die einen spezifischen (elementaren) norwegischen
Eindruck auf mich gemacht hatten, wie z.B. schwarze Vogel-
kirschen in ihrem rötlichen Laube; Vögel mit den hellroten
Beeren der Bergesche im Schnabel u. s. w."
Ueberall in unsern Häusern und Zimmern vom Orna-
mente bis zu den ganzen Gebäuden, in aller Kunstindustrie
sah er bei uns nur fremde, gedankenlos importierte Sachen.
„Alles, womit wir uns umgaben, zeigte fremde Erfin-
dung und fremde Gedanken, die uns in unsern eignen
Wohnzimmern heimatlos machten. Das einzig norwegische,
wozu man es gebracht hatte, waren die Drachenornamente
(die übrigens nicht allein Norwegen gehören); wie Gemein-
plätze sah man sie überall angebracht, wo nicht Japanisches
__ m derselben Weise wie Pompejanisches, Altdeutsches
oder Antikes, das heisst: in ärmlicher Nachahmung — an-
gewendet wurde."
„Es lag mir daher nahe daran zu denken, dass wir doch
selbst Pflanzen und Tiere und auch unsere eigene nationale
Denkart besässen, um daraus etwas ornamentales hervor-
bringen zu können."
„Meine Frau fasste Interesse für diese Idee und trug
sie in ihre Handarbeit hinein, und als sie zu weben anfing,
zeichnete ich ihr Muster vor. Ich wählte dazu immer die
wenigsten und einfachsten Farben, wie sie im alten nor-
wegischen Gewebe gebräuchlich waren, bis der Verfall mit
seinen „Nuancen" und seiner Blutlosigkeit in der neueren
Zeit hereinbrach. Ich nahm die weisse und schwarze Farbe der
Wolle, dazu lebhaftes Blau; das Gelbe, das durch Birkenlaub
oder Apfelrinde hervorgebracht wird; das Hochrote und das
frohe, mutige Grün, so wie sie es bei uns in Hallingdal haben
(freudevoll strahlend, aber nicht grell). Die „Rosemaling"
unserer Bauern hatte ich an vielen Orten, besonders in Eege-
dal, studiert. Ich wollte meinem eignen Instinkt allein folgen
und nahm aus allen Zeiten und Stilarten das, was ich eben
nötig hatte, um einen eignen „Stil" zu schaffen. Je länger
ich sah, desto mehr wunderte ich mich, dass Niemand sich an
diese heimische Farbenfreude, diese gastmahlsfrohe Treu-
herzigkeit kehrte, sondern dass alle sich vom Auslande diese
fremden, unverdauten Sachen immerfort holten. Alles, was
das Dekorative verderben kann, ist ja im Kurs. Statt weniger
entschiedener Farben, viele und unbestimmte Nuancen. Das
farbenhungrige und magere wird „leicht« genannt und ver-
drängt das volle und satte. Es ist auch nicht möglich, irgend
welche Idee mit dieser ausgekauten landläufigen Ornamentik,
die aus den Mappen der Architekten und den deutschen
Büchern zu uns kommt, zu verbinden, wenn dann nicht, wie
es oft genug der Fall ist, der Naturalismus (mit Trauben,
C 201 J)
26*