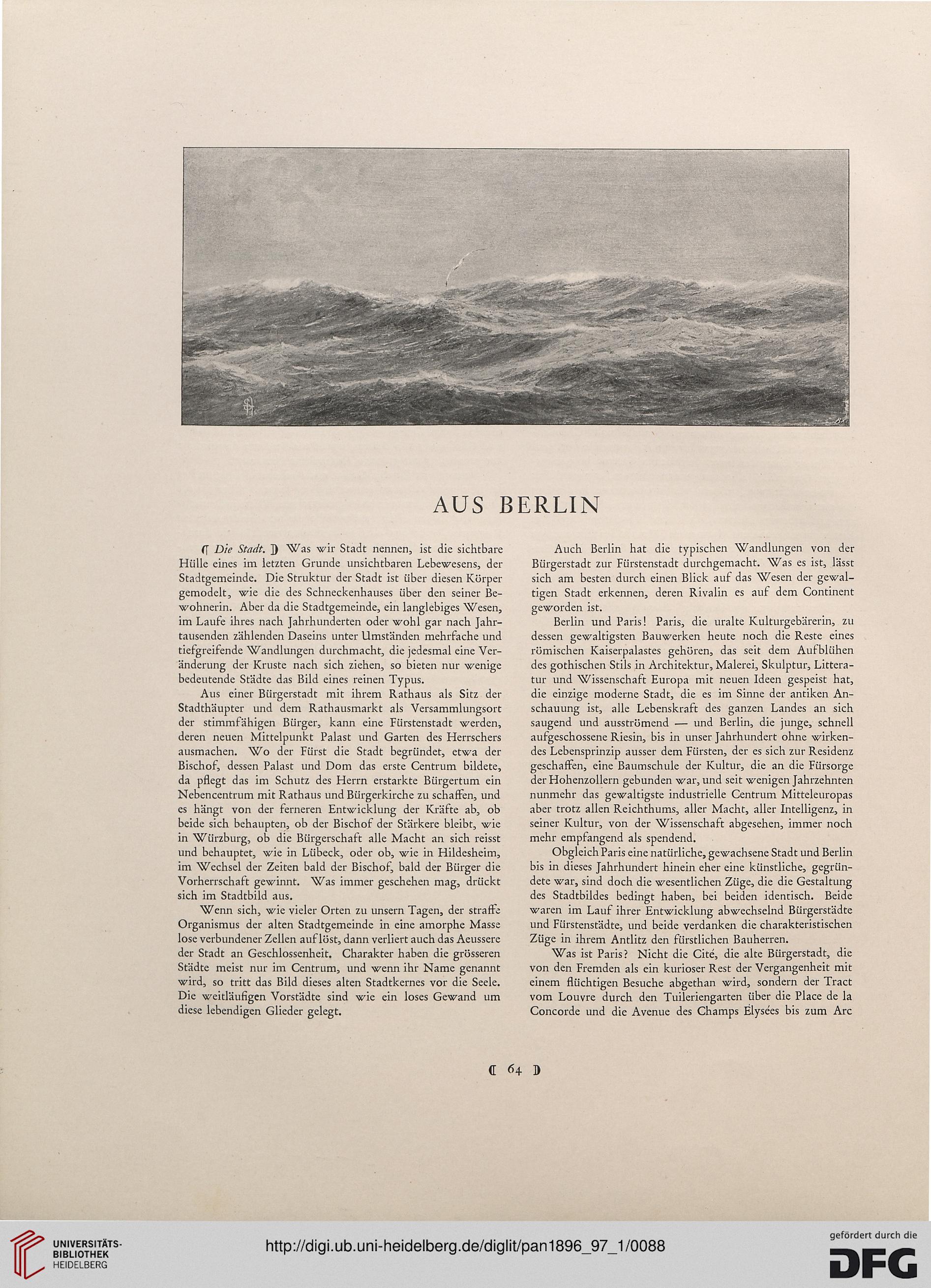AUS BERLIN
(\ Die Stadt. ]) Was wir Stadt nennen, ist die sichtbare
Hülle eines im letzten Grunde unsichtbaren Lebewesens, der
Stadtgemeinde. Die Struktur der Stadt ist über diesen Körper
gemodelt, wie die des Schneckenhauses über den seiner Be-
wohnerin. Aber da die Stadtgemeinde, ein langlebiges Wesen,
im Laufe ihres nach Jahrhunderten oder wohl gar nach Jahr-
tausenden zählenden Daseins unter Umständen mehrfache und
tiefgreifende Wandlungen durchmacht, die jedesmal eine Ver-
änderung der Kruste nach sich ziehen, so bieten nur wenige
bedeutende Städte das Bild eines reinen Typus.
Aus einer Bürgerstadt mit ihrem Rathaus als Sitz der
Stadthäupter und dem Rathausmarkt als Versammlungsort
der stimmfähigen Bürger, kann eine Fürstenstadt werden,
deren neuen Mittelpunkt Palast und Garten des Herrschers
ausmachen. Wo der Fürst die Stadt begründet, etwa der
Bischof, dessen Palast und Dom das erste Centrum bildete,
da pflegt das im Schutz des Herrn erstarkte Bürgertum ein
Nebencentrum mit Rathaus und Bürgerkirche zu schaffen, und
es hängt von der ferneren Entwicklung der Kräfte ab, ob
beide sich behaupten, ob der Bischof der Stärkere bleibt, wie
in Würzburg, ob die Bürgerschaft alle Macht an sich reisst
und behauptet, wie in Lübeck, oder ob, wie in Hildesheim,
im Wechsel der Zeiten bald der Bischof, bald der Bürger die
Vorherrschaft gewinnt. Was immer geschehen mag, drückt
sich im Stadtbild aus.
Wenn sich, wie vieler Orten zu unsern Tagen, der straffe
Organismus der alten Stadtgemeinde in eine amorphe Masse
lose verbundener Zellen auflöst, dann verliert auch das Aeussere
der Stadt an Geschlossenheit. Charakter haben die grösseren
Städte meist nur im Centrum, und wenn ihr Name genannt
wird, so tritt das Bild dieses alten Stadtkernes vor die Seele.
Die weitläufigen Vorstädte sind wie ein loses Gewand um
diese lebendigen Glieder gelegt.
Auch Berlin hat die typischen Wandlungen von der
Bürgerstadt zur Fürstenstadt durchgemacht. Was es ist, lässt
sich am besten durch einen Blick auf das Wesen der gewal-
tigen Stadt erkennen, deren Rivalin es auf dem Continent
geworden ist.
Berlin und Paris! Paris, die uralte Kulturgebärerin, zu
dessen gewaltigsten Bauwerken heute noch die Reste eines
römischen Kaiserpalastes gehören, das seit dem Aufblühen
des gothischen Stils in Architektur, Malerei, Skulptur, Littera-
tur und Wissenschaft Europa mit neuen Ideen gespeist hat,
die einzige moderne Stadt, die es im Sinne der antiken An-
schauung ist, alle Lebenskraft des ganzen Landes an sich
saugend und ausströmend — und Berlin, die junge, schnell
aufgeschossene Riesin, bis in unser Jahrhundert ohne wirken-
des Lebensprinzip ausser dem Fürsten, der es sich zur Residenz
geschaffen, eine Baumschule der Kultur, die an die Fürsorge
der Hohenzollern gebunden war, und seit wenigen Jahrzehnten
nunmehr das gewaltigste industrielle Centrum Mitteleuropas
aber trotz allen Reichthums, aller Macht, aller Intelligenz, in
seiner Kultur, von der Wissenschaft abgesehen, immer noch
mehr empfangend als spendend.
Obgleich Paris eine natürliche, gewachsene Stadt und Berlin
bis in dieses Jahrhundert hinein eher eine künstliche, gegrün-
dete war, sind doch die wesentlichen Züge, die die Gestaltung
des Stadtbildes bedingt haben, bei beiden identisch. Beide
waren im Lauf ihrer Entwicklung abwechselnd Bürgerstädte
und Fürstenstädte, und beide verdanken die charakteristischen
Züge in ihrem Antlitz den fürstlichen Bauherren.
Was ist Paris? Nicht die Cite, die alte Bürgerstadt, die
von den Fremden als ein kurioser Rest der Vergangenheit mit
einem flüchtigen Besuche abgethan wird, sondern der Tract
vom Louvre durch den Tuileriengarten über die Place de la
Concorde und die Avenue des Champs Elyse'es bis zum Are
C 64 3
(\ Die Stadt. ]) Was wir Stadt nennen, ist die sichtbare
Hülle eines im letzten Grunde unsichtbaren Lebewesens, der
Stadtgemeinde. Die Struktur der Stadt ist über diesen Körper
gemodelt, wie die des Schneckenhauses über den seiner Be-
wohnerin. Aber da die Stadtgemeinde, ein langlebiges Wesen,
im Laufe ihres nach Jahrhunderten oder wohl gar nach Jahr-
tausenden zählenden Daseins unter Umständen mehrfache und
tiefgreifende Wandlungen durchmacht, die jedesmal eine Ver-
änderung der Kruste nach sich ziehen, so bieten nur wenige
bedeutende Städte das Bild eines reinen Typus.
Aus einer Bürgerstadt mit ihrem Rathaus als Sitz der
Stadthäupter und dem Rathausmarkt als Versammlungsort
der stimmfähigen Bürger, kann eine Fürstenstadt werden,
deren neuen Mittelpunkt Palast und Garten des Herrschers
ausmachen. Wo der Fürst die Stadt begründet, etwa der
Bischof, dessen Palast und Dom das erste Centrum bildete,
da pflegt das im Schutz des Herrn erstarkte Bürgertum ein
Nebencentrum mit Rathaus und Bürgerkirche zu schaffen, und
es hängt von der ferneren Entwicklung der Kräfte ab, ob
beide sich behaupten, ob der Bischof der Stärkere bleibt, wie
in Würzburg, ob die Bürgerschaft alle Macht an sich reisst
und behauptet, wie in Lübeck, oder ob, wie in Hildesheim,
im Wechsel der Zeiten bald der Bischof, bald der Bürger die
Vorherrschaft gewinnt. Was immer geschehen mag, drückt
sich im Stadtbild aus.
Wenn sich, wie vieler Orten zu unsern Tagen, der straffe
Organismus der alten Stadtgemeinde in eine amorphe Masse
lose verbundener Zellen auflöst, dann verliert auch das Aeussere
der Stadt an Geschlossenheit. Charakter haben die grösseren
Städte meist nur im Centrum, und wenn ihr Name genannt
wird, so tritt das Bild dieses alten Stadtkernes vor die Seele.
Die weitläufigen Vorstädte sind wie ein loses Gewand um
diese lebendigen Glieder gelegt.
Auch Berlin hat die typischen Wandlungen von der
Bürgerstadt zur Fürstenstadt durchgemacht. Was es ist, lässt
sich am besten durch einen Blick auf das Wesen der gewal-
tigen Stadt erkennen, deren Rivalin es auf dem Continent
geworden ist.
Berlin und Paris! Paris, die uralte Kulturgebärerin, zu
dessen gewaltigsten Bauwerken heute noch die Reste eines
römischen Kaiserpalastes gehören, das seit dem Aufblühen
des gothischen Stils in Architektur, Malerei, Skulptur, Littera-
tur und Wissenschaft Europa mit neuen Ideen gespeist hat,
die einzige moderne Stadt, die es im Sinne der antiken An-
schauung ist, alle Lebenskraft des ganzen Landes an sich
saugend und ausströmend — und Berlin, die junge, schnell
aufgeschossene Riesin, bis in unser Jahrhundert ohne wirken-
des Lebensprinzip ausser dem Fürsten, der es sich zur Residenz
geschaffen, eine Baumschule der Kultur, die an die Fürsorge
der Hohenzollern gebunden war, und seit wenigen Jahrzehnten
nunmehr das gewaltigste industrielle Centrum Mitteleuropas
aber trotz allen Reichthums, aller Macht, aller Intelligenz, in
seiner Kultur, von der Wissenschaft abgesehen, immer noch
mehr empfangend als spendend.
Obgleich Paris eine natürliche, gewachsene Stadt und Berlin
bis in dieses Jahrhundert hinein eher eine künstliche, gegrün-
dete war, sind doch die wesentlichen Züge, die die Gestaltung
des Stadtbildes bedingt haben, bei beiden identisch. Beide
waren im Lauf ihrer Entwicklung abwechselnd Bürgerstädte
und Fürstenstädte, und beide verdanken die charakteristischen
Züge in ihrem Antlitz den fürstlichen Bauherren.
Was ist Paris? Nicht die Cite, die alte Bürgerstadt, die
von den Fremden als ein kurioser Rest der Vergangenheit mit
einem flüchtigen Besuche abgethan wird, sondern der Tract
vom Louvre durch den Tuileriengarten über die Place de la
Concorde und die Avenue des Champs Elyse'es bis zum Are
C 64 3