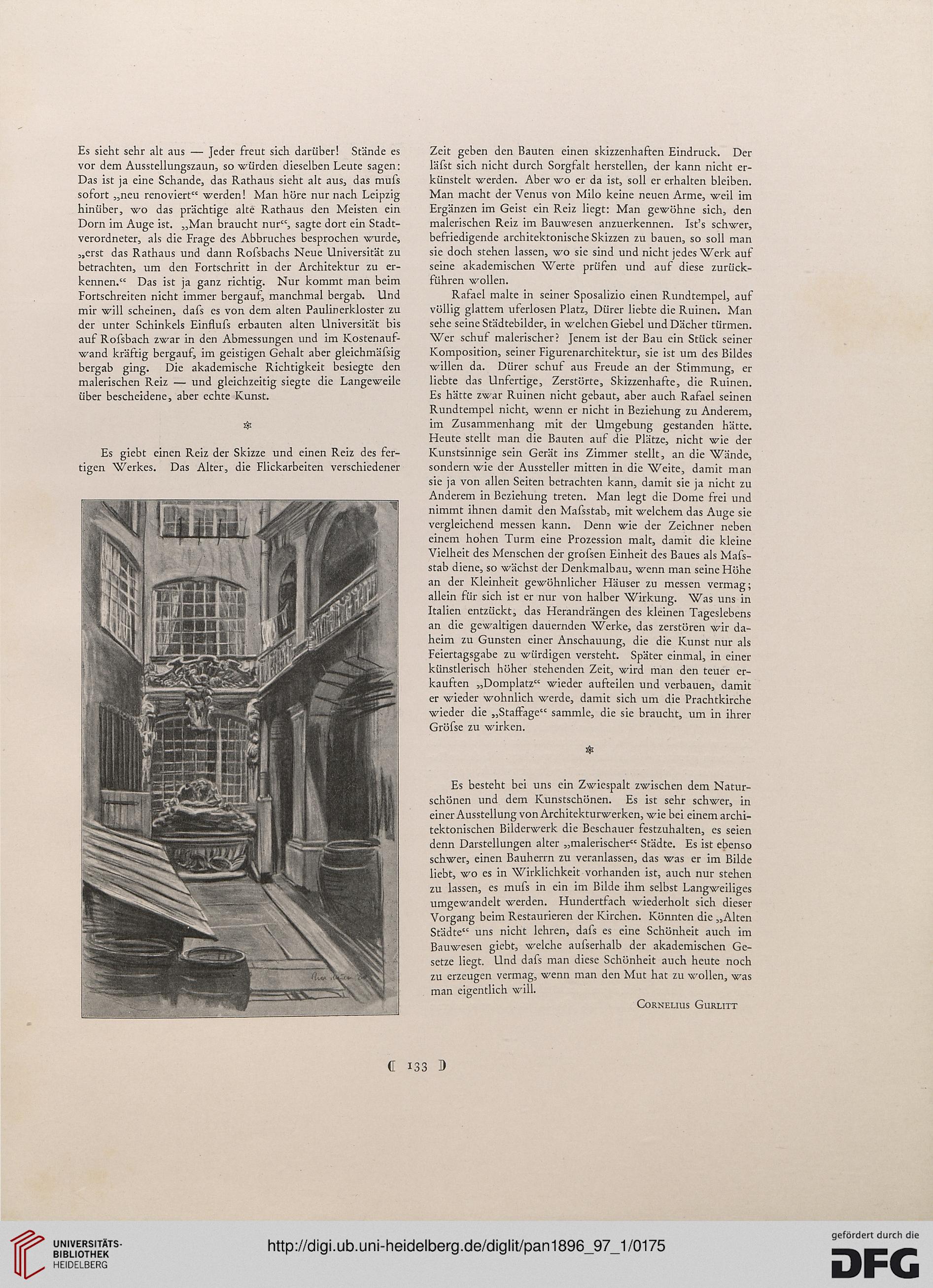Es sieht sehr alt aus — Jeder freut sich darüber! Stände es
vor dem Ausstellungszaun, so würden dieselben Leute sagen:
Das ist ja eine Schande, das Rathaus sieht alt aus, das mufs
sofort „neu renoviert" werden! Man höre nur nach Leipzig
hinüber, wo das prächtige alte Rathaus den Meisten ein
Dorn im Auge ist. „Man braucht nur", sagte dort ein Stadt-
verordneter, als die Frage des Abbruches besprochen wurde,
„erst das Rathaus und dann Rofsbachs Neue Universität zu
betrachten, um den Fortschritt in der Architektur zu er-
kennen." Das ist ja ganz richtig. Nur kommt man beim
Fortschreiten nicht immer bergauf, manchmal bergab. Und
mir will scheinen, dafs es von dem alten Paulinerkloster zu
der unter Schinkels Einflufs erbauten alten Universität bis
auf Rofsbach zwar in den Abmessungen und im Kostenauf-
wand kräftig bergauf, im geistigen Gehalt aber gleichmäfsig
bergab ging. Die akademische Richtigkeit besiegte den
malerischen Reiz — und gleichzeitig siegte die Langeweile
über bescheidene, aber echte Kunst.
Es giebt einen Reiz der Skizze und einen Reiz des fer-
tigen "Werkes. Das Alter, die Flickarbeiten verschiedener
Zeit geben den Bauten einen skizzenhaften Eindruck. Der
läfst sich nicht durch Sorgfalt herstellen, der kann nicht er-
künstelt werden. Aber wo er da ist, soll er erhalten bleiben.
Man macht der Venus von Milo keine neuen Arme, weil im
Ergänzen im Geist ein Reiz liegt: Man gewöhne sich, den
malerischen Reiz im Bauwesen anzuerkennen. Ist's schwer,
befriedigende architektonische Skizzen zu bauen, so soll man
sie doch stehen lassen, wo sie sind und nicht jedes Werk auf
seine akademischen Werte prüfen und auf diese zurück-
führen wollen.
Rafael malte in seiner Sposalizio einen Rundtempel, auf
völlig glattem uferlosen Platz, Dürer liebte die Ruinen. Man
sehe seine Städtebilder, in welchen Giebel und Dächer türmen.
Wer schuf malerischer? Jenem ist der Bau ein Stück seiner
Komposition, seiner Figurenarchitektur, sie ist um des Bildes
willen da. Dürer schuf aus Freude an der Stimmung, er
liebte das Unfertige, Zerstörte, Skizzenhafte, die Ruinen.
Es hätte zwar Ruinen nicht gebaut, aber auch Rafael seinen
Rundtempel nicht, wenn er nicht in Beziehung zu Anderem,
im Zusammenhang mit der Umgebung gestanden hätte.
Heute stellt man die Bauten auf die Plätze, nicht wie der
Kunstsinnige sein Gerät ins Zimmer stellt, an die Wände,
sondern wie der Aussteller mitten in die Weite, damit man
sie ja von allen Seiten betrachten kann, damit sie ja nicht zu
Anderem in Beziehung treten. Man legt die Dome frei und
nimmt ihnen damit den Mafsstab, mit welchem das Auge sie
vergleichend messen kann. Denn wie der Zeichner neben
einem hohen Turm eine Prozession malt, damit die kleine
Vielheit des Menschen der grofsen Einheit des Baues als Mafs-
stab diene, so wächst der Denkmalbau, wenn man seine Höhe
an der Kleinheit gewöhnlicher Häuser zu messen vermag;
allein für sich ist er nur von halber Wirkung. Was uns in
Italien entzückt, das Herandrängen des kleinen Tageslebens
an die gewaltigen dauernden Werke, das zerstören wir da-
heim zu Gunsten einer Anschauung, die die Kunst nur als
Feiertagsgabe zu würdigen versteht. Spater einmal, in einer
künstlerisch höher stehenden Zeit, wird man den teuer er-
kauften „Domplatz" wieder aufteilen und verbauen, damit
er wieder wohnlich werde, damit sich um die Prachtkirche
wieder die „Staffage" sammle, die sie braucht, um in ihrer
Gröfse zu wirken.
Es besteht bei uns ein Zwiespalt zwischen dem Natur-
schönen und dem Kunstschönen. Es ist sehr schwer, in
einer Ausstellung von Architekturwerken, wie bei einem archi-
tektonischen Bilderwerk die Beschauer festzuhalten, es seien
denn Darstellungen alter „malerischer" Städte. Es ist ebenso
schwer, einen Bauherrn zu veranlassen, das was er im Bilde
liebt, wo es in Wirklichkeit vorhanden ist, auch nur stehen
zu lassen, es mufs in ein im Bilde ihm selbst Langweiliges
umgewandelt werden. Hundertfach wiederholt sich dieser
Vorgang beim Restaurieren der Kirchen. Könnten die „Alten
Städte" uns nicht lehren, dafs es eine Schönheit auch im
Bauwesen giebt, welche aufserhalb der akademischen Ge-
setze liegt. Und dafs man diese Schönheit auch heute noch
zu erzeugen vermag, wenn man den Mut hat zu wollen, was
man eigentlich will.
Cornelius Gurlitt
C i33 3
vor dem Ausstellungszaun, so würden dieselben Leute sagen:
Das ist ja eine Schande, das Rathaus sieht alt aus, das mufs
sofort „neu renoviert" werden! Man höre nur nach Leipzig
hinüber, wo das prächtige alte Rathaus den Meisten ein
Dorn im Auge ist. „Man braucht nur", sagte dort ein Stadt-
verordneter, als die Frage des Abbruches besprochen wurde,
„erst das Rathaus und dann Rofsbachs Neue Universität zu
betrachten, um den Fortschritt in der Architektur zu er-
kennen." Das ist ja ganz richtig. Nur kommt man beim
Fortschreiten nicht immer bergauf, manchmal bergab. Und
mir will scheinen, dafs es von dem alten Paulinerkloster zu
der unter Schinkels Einflufs erbauten alten Universität bis
auf Rofsbach zwar in den Abmessungen und im Kostenauf-
wand kräftig bergauf, im geistigen Gehalt aber gleichmäfsig
bergab ging. Die akademische Richtigkeit besiegte den
malerischen Reiz — und gleichzeitig siegte die Langeweile
über bescheidene, aber echte Kunst.
Es giebt einen Reiz der Skizze und einen Reiz des fer-
tigen "Werkes. Das Alter, die Flickarbeiten verschiedener
Zeit geben den Bauten einen skizzenhaften Eindruck. Der
läfst sich nicht durch Sorgfalt herstellen, der kann nicht er-
künstelt werden. Aber wo er da ist, soll er erhalten bleiben.
Man macht der Venus von Milo keine neuen Arme, weil im
Ergänzen im Geist ein Reiz liegt: Man gewöhne sich, den
malerischen Reiz im Bauwesen anzuerkennen. Ist's schwer,
befriedigende architektonische Skizzen zu bauen, so soll man
sie doch stehen lassen, wo sie sind und nicht jedes Werk auf
seine akademischen Werte prüfen und auf diese zurück-
führen wollen.
Rafael malte in seiner Sposalizio einen Rundtempel, auf
völlig glattem uferlosen Platz, Dürer liebte die Ruinen. Man
sehe seine Städtebilder, in welchen Giebel und Dächer türmen.
Wer schuf malerischer? Jenem ist der Bau ein Stück seiner
Komposition, seiner Figurenarchitektur, sie ist um des Bildes
willen da. Dürer schuf aus Freude an der Stimmung, er
liebte das Unfertige, Zerstörte, Skizzenhafte, die Ruinen.
Es hätte zwar Ruinen nicht gebaut, aber auch Rafael seinen
Rundtempel nicht, wenn er nicht in Beziehung zu Anderem,
im Zusammenhang mit der Umgebung gestanden hätte.
Heute stellt man die Bauten auf die Plätze, nicht wie der
Kunstsinnige sein Gerät ins Zimmer stellt, an die Wände,
sondern wie der Aussteller mitten in die Weite, damit man
sie ja von allen Seiten betrachten kann, damit sie ja nicht zu
Anderem in Beziehung treten. Man legt die Dome frei und
nimmt ihnen damit den Mafsstab, mit welchem das Auge sie
vergleichend messen kann. Denn wie der Zeichner neben
einem hohen Turm eine Prozession malt, damit die kleine
Vielheit des Menschen der grofsen Einheit des Baues als Mafs-
stab diene, so wächst der Denkmalbau, wenn man seine Höhe
an der Kleinheit gewöhnlicher Häuser zu messen vermag;
allein für sich ist er nur von halber Wirkung. Was uns in
Italien entzückt, das Herandrängen des kleinen Tageslebens
an die gewaltigen dauernden Werke, das zerstören wir da-
heim zu Gunsten einer Anschauung, die die Kunst nur als
Feiertagsgabe zu würdigen versteht. Spater einmal, in einer
künstlerisch höher stehenden Zeit, wird man den teuer er-
kauften „Domplatz" wieder aufteilen und verbauen, damit
er wieder wohnlich werde, damit sich um die Prachtkirche
wieder die „Staffage" sammle, die sie braucht, um in ihrer
Gröfse zu wirken.
Es besteht bei uns ein Zwiespalt zwischen dem Natur-
schönen und dem Kunstschönen. Es ist sehr schwer, in
einer Ausstellung von Architekturwerken, wie bei einem archi-
tektonischen Bilderwerk die Beschauer festzuhalten, es seien
denn Darstellungen alter „malerischer" Städte. Es ist ebenso
schwer, einen Bauherrn zu veranlassen, das was er im Bilde
liebt, wo es in Wirklichkeit vorhanden ist, auch nur stehen
zu lassen, es mufs in ein im Bilde ihm selbst Langweiliges
umgewandelt werden. Hundertfach wiederholt sich dieser
Vorgang beim Restaurieren der Kirchen. Könnten die „Alten
Städte" uns nicht lehren, dafs es eine Schönheit auch im
Bauwesen giebt, welche aufserhalb der akademischen Ge-
setze liegt. Und dafs man diese Schönheit auch heute noch
zu erzeugen vermag, wenn man den Mut hat zu wollen, was
man eigentlich will.
Cornelius Gurlitt
C i33 3