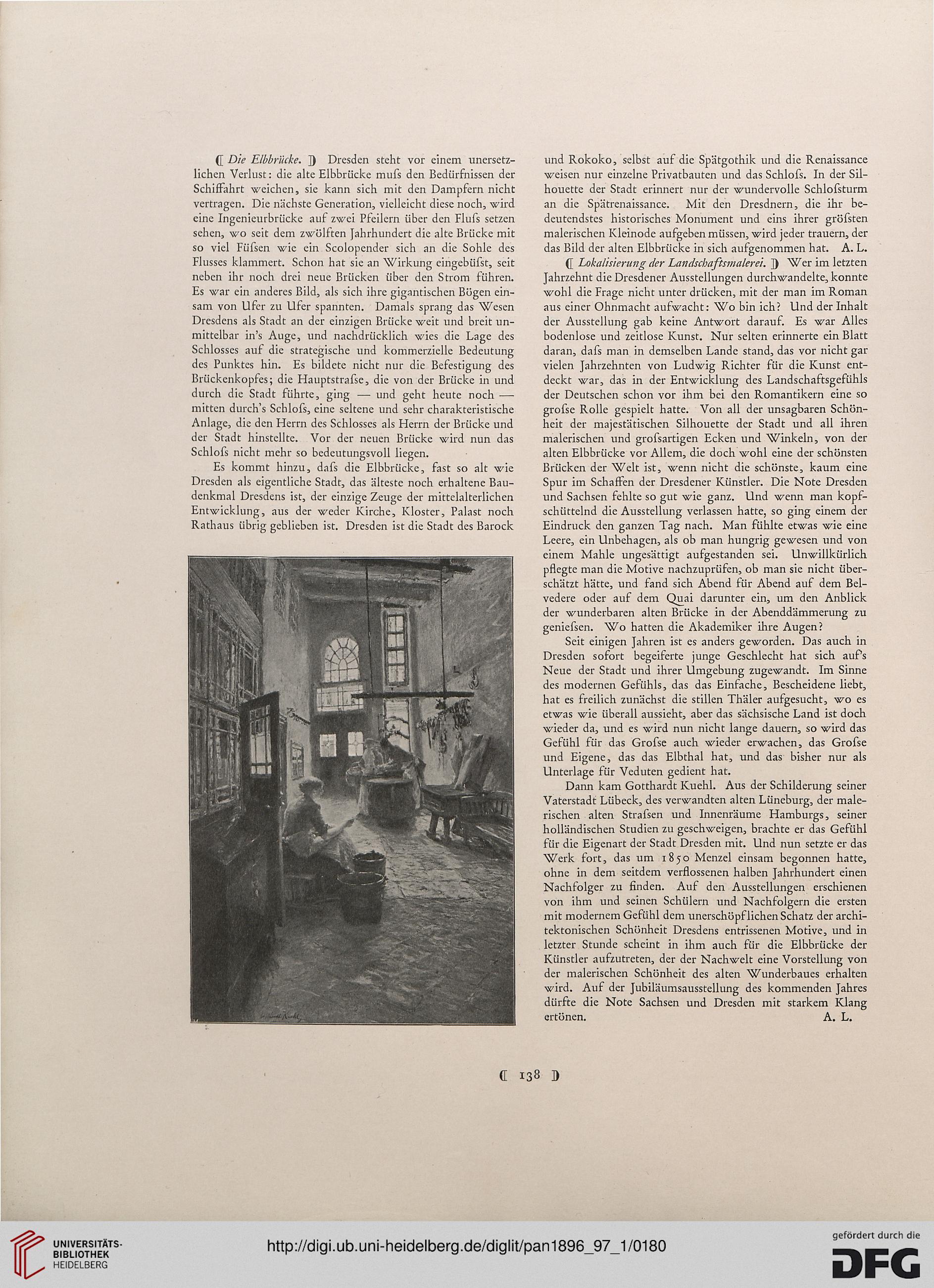([ Die Eibbrücke. ]) Dresden steht vor einem unersetz-
lichen Verlust: die alte Eibbrücke mufs den Bedürfnissen der
Schiffahrt weichen, sie kann sich mit den Dampfern nicht
vertragen. Die nächste Generation, vielleicht diese noch, wird
eine Ingenieurbrücke auf zwei Pfeilern über den Flufs setzen
sehen, wo seit dem zwölften Jahrhundert die alte Brücke mit
so viel Füfsen wie ein Scolopender sich an die Sohle des
Flusses klammert. Schon hat sie an Wirkung eingebüfst, seit
neben ihr noch drei neue Brücken über den Strom führen.
Es war ein anderes Bild, als sich ihre gigantischen Bögen ein-
sam von Ufer zu Ufer spannten. Damals sprang das Wesen
Dresdens als Stadt an der einzigen Brücke weit und breit un-
mittelbar in's Auge, und nachdrücklich wies die Lage des
Schlosses auf die strategische und kommerzielle Bedeutung
des Punktes hin. Es bildete nicht nur die Befestigung des
Brückenkopfes; die Hauptstrafse, die von der Brücke in und
durch die Stadt führte, ging — und geht heute noch —■
mitten durch's Schlofs, eine seltene und sehr charakteristische
Anlage, die den Herrn des Schlosses als Herrn der Brücke und
der Stadt hinstellte. Vor der neuen Brücke wird nun das
Schlofs nicht mehr so bedeutungsvoll liegen.
Es kommt hinzu, dafs die Eibbrücke, fast so alt wie
Dresden als eigentliche Stadt, das älteste noch erhaltene Bau-
denkmal Dresdens ist, der einzige Zeuge der mittelalterlichen
Entwicklung, aus der weder Kirche, Kloster, Palast noch
Rathaus übrig geblieben ist. Dresden ist die Stadt des Barock
und Rokoko, selbst auf die Spätgothik und die Renaissance
weisen nur einzelne Privatbauten und das Schlofs. In der Sil-
houette der Stadt erinnert nur der wundervolle Schlofsturm
an die Spätrenaissance. Mit den Dresdnern, die ihr be-
deutendstes historisches Monument und eins ihrer gröfsten
malerischen Kleinode aufgeben müssen, wird jeder trauern, der
das Bild der alten Eibbrücke in sich aufgenommen hat. A. L.
([ Lokalisierung der Landschaftsmalerei. ]) Wer im letzten
Jahrzehnt die Dresdener Ausstellungen durchwandelte, konnte
wohl die Frage nicht unter drücken, mit der man im Roman
aus einer Ohnmacht aufwacht: Wo bin ich? Und der Inhalt
der Ausstellung gab keine Antwort darauf. Es war Alles
bodenlose und zeitlose Kunst. Nur selten erinnerte ein Blatt
daran, dafs man in demselben Lande stand, das vor nicht gar
vielen Jahrzehnten von Ludwig Richter für die Kunst ent-
deckt war, das in der Entwicklung des Landschaftsgefühls
der Deutschen schon vor ihm bei den Romantikern eine so
grofse Rolle gespielt hatte. Von all der unsagbaren Schön-
heit der majestätischen Silhouette der Stadt und all ihren
malerischen und grofsartigen Ecken und Winkeln, von der
alten Eibbrücke vor Allem, die doch wohl eine der schönsten
Brücken der Welt ist, wenn nicht die schönste, kaum eine
Spur im Schaffen der Dresdener Künstler. Die Note Dresden
und Sachsen fehlte so gut wie ganz. Und wenn man kopf-
schüttelnd die Ausstellung verlassen hatte, so ging einem der
Eindruck den ganzen Tag nach. Man fühlte etwas wie eine
Leere, ein Unbehagen, als ob man hungrig gewesen und von
einem Mahle ungesättigt aufgestanden sei. Unwillkürlich
pflegte man die Motive nachzuprüfen, ob man sie nicht über-
schätzt hätte, und fand sich Abend für Abend auf dem Bel-
vedere oder auf dem Quai darunter ein, um den Anblick
der wunderbaren alten Brücke in der Abenddämmerung zu
geniefsen. Wo hatten die Akademiker ihre Augen?
Seit einigen Jahren ist es anders geworden. Das auch in
Dresden sofort begeiferte junge Geschlecht hat sich auPs
Neue der Stadt und ihrer Umgebung zugewandt. Im Sinne
des modernen Gefühls, das das Einfache, Bescheidene liebt,
hat es freilich zunächst die stillen Thäler aufgesucht, wo es
etwas wie überall aussieht, aber das sächsische Land ist doch
wieder da, und es wird nun nicht lange dauern, so wird das
Gefühl für das Grofse auch wieder erwachen, das Grofse
und Eigene, das das Elbthal hat, und das bisher nur als
Unterlage für Veduten gedient hat.
Dann kam Gotthardt Kuehl. Aus der Schilderung seiner
Vaterstadt Lübeck, des verwandten alten Lüneburg, der male-
rischen alten Strafsen und Innenräume Hamburgs, seiner
holländischen Studien zu geschweigen, brachte er das Gefühl
für die Eigenart der Stadt Dresden mit. Und nun setzte er das
Werk fort, das um 1850 Menzel einsam begonnen hatte,
ohne in dem seitdem verflossenen halben Jahrhundert einen
Nachfolger zu finden. Auf den Ausstellungen erschienen
von ihm und seinen Schülern und Nachfolgern die ersten
mit modernem Gefühl dem unerschöpflichen Schatz der archi-
tektonischen Schönheit Dresdens entrissenen Motive, und in
letzter Stunde scheint in ihm auch für die Eibbrücke der
Künstler aufzutreten, der der Nachwelt eine Vorstellung von
der malerischen Schönheit des alten Wunderbaues erhalten
wird. Auf der Jubiläumsausstellung des kommenden Jahres
dürfte die Note Sachsen und Dresden mit starkem Klang
ertönen. A. L.
C 138 3
lichen Verlust: die alte Eibbrücke mufs den Bedürfnissen der
Schiffahrt weichen, sie kann sich mit den Dampfern nicht
vertragen. Die nächste Generation, vielleicht diese noch, wird
eine Ingenieurbrücke auf zwei Pfeilern über den Flufs setzen
sehen, wo seit dem zwölften Jahrhundert die alte Brücke mit
so viel Füfsen wie ein Scolopender sich an die Sohle des
Flusses klammert. Schon hat sie an Wirkung eingebüfst, seit
neben ihr noch drei neue Brücken über den Strom führen.
Es war ein anderes Bild, als sich ihre gigantischen Bögen ein-
sam von Ufer zu Ufer spannten. Damals sprang das Wesen
Dresdens als Stadt an der einzigen Brücke weit und breit un-
mittelbar in's Auge, und nachdrücklich wies die Lage des
Schlosses auf die strategische und kommerzielle Bedeutung
des Punktes hin. Es bildete nicht nur die Befestigung des
Brückenkopfes; die Hauptstrafse, die von der Brücke in und
durch die Stadt führte, ging — und geht heute noch —■
mitten durch's Schlofs, eine seltene und sehr charakteristische
Anlage, die den Herrn des Schlosses als Herrn der Brücke und
der Stadt hinstellte. Vor der neuen Brücke wird nun das
Schlofs nicht mehr so bedeutungsvoll liegen.
Es kommt hinzu, dafs die Eibbrücke, fast so alt wie
Dresden als eigentliche Stadt, das älteste noch erhaltene Bau-
denkmal Dresdens ist, der einzige Zeuge der mittelalterlichen
Entwicklung, aus der weder Kirche, Kloster, Palast noch
Rathaus übrig geblieben ist. Dresden ist die Stadt des Barock
und Rokoko, selbst auf die Spätgothik und die Renaissance
weisen nur einzelne Privatbauten und das Schlofs. In der Sil-
houette der Stadt erinnert nur der wundervolle Schlofsturm
an die Spätrenaissance. Mit den Dresdnern, die ihr be-
deutendstes historisches Monument und eins ihrer gröfsten
malerischen Kleinode aufgeben müssen, wird jeder trauern, der
das Bild der alten Eibbrücke in sich aufgenommen hat. A. L.
([ Lokalisierung der Landschaftsmalerei. ]) Wer im letzten
Jahrzehnt die Dresdener Ausstellungen durchwandelte, konnte
wohl die Frage nicht unter drücken, mit der man im Roman
aus einer Ohnmacht aufwacht: Wo bin ich? Und der Inhalt
der Ausstellung gab keine Antwort darauf. Es war Alles
bodenlose und zeitlose Kunst. Nur selten erinnerte ein Blatt
daran, dafs man in demselben Lande stand, das vor nicht gar
vielen Jahrzehnten von Ludwig Richter für die Kunst ent-
deckt war, das in der Entwicklung des Landschaftsgefühls
der Deutschen schon vor ihm bei den Romantikern eine so
grofse Rolle gespielt hatte. Von all der unsagbaren Schön-
heit der majestätischen Silhouette der Stadt und all ihren
malerischen und grofsartigen Ecken und Winkeln, von der
alten Eibbrücke vor Allem, die doch wohl eine der schönsten
Brücken der Welt ist, wenn nicht die schönste, kaum eine
Spur im Schaffen der Dresdener Künstler. Die Note Dresden
und Sachsen fehlte so gut wie ganz. Und wenn man kopf-
schüttelnd die Ausstellung verlassen hatte, so ging einem der
Eindruck den ganzen Tag nach. Man fühlte etwas wie eine
Leere, ein Unbehagen, als ob man hungrig gewesen und von
einem Mahle ungesättigt aufgestanden sei. Unwillkürlich
pflegte man die Motive nachzuprüfen, ob man sie nicht über-
schätzt hätte, und fand sich Abend für Abend auf dem Bel-
vedere oder auf dem Quai darunter ein, um den Anblick
der wunderbaren alten Brücke in der Abenddämmerung zu
geniefsen. Wo hatten die Akademiker ihre Augen?
Seit einigen Jahren ist es anders geworden. Das auch in
Dresden sofort begeiferte junge Geschlecht hat sich auPs
Neue der Stadt und ihrer Umgebung zugewandt. Im Sinne
des modernen Gefühls, das das Einfache, Bescheidene liebt,
hat es freilich zunächst die stillen Thäler aufgesucht, wo es
etwas wie überall aussieht, aber das sächsische Land ist doch
wieder da, und es wird nun nicht lange dauern, so wird das
Gefühl für das Grofse auch wieder erwachen, das Grofse
und Eigene, das das Elbthal hat, und das bisher nur als
Unterlage für Veduten gedient hat.
Dann kam Gotthardt Kuehl. Aus der Schilderung seiner
Vaterstadt Lübeck, des verwandten alten Lüneburg, der male-
rischen alten Strafsen und Innenräume Hamburgs, seiner
holländischen Studien zu geschweigen, brachte er das Gefühl
für die Eigenart der Stadt Dresden mit. Und nun setzte er das
Werk fort, das um 1850 Menzel einsam begonnen hatte,
ohne in dem seitdem verflossenen halben Jahrhundert einen
Nachfolger zu finden. Auf den Ausstellungen erschienen
von ihm und seinen Schülern und Nachfolgern die ersten
mit modernem Gefühl dem unerschöpflichen Schatz der archi-
tektonischen Schönheit Dresdens entrissenen Motive, und in
letzter Stunde scheint in ihm auch für die Eibbrücke der
Künstler aufzutreten, der der Nachwelt eine Vorstellung von
der malerischen Schönheit des alten Wunderbaues erhalten
wird. Auf der Jubiläumsausstellung des kommenden Jahres
dürfte die Note Sachsen und Dresden mit starkem Klang
ertönen. A. L.
C 138 3