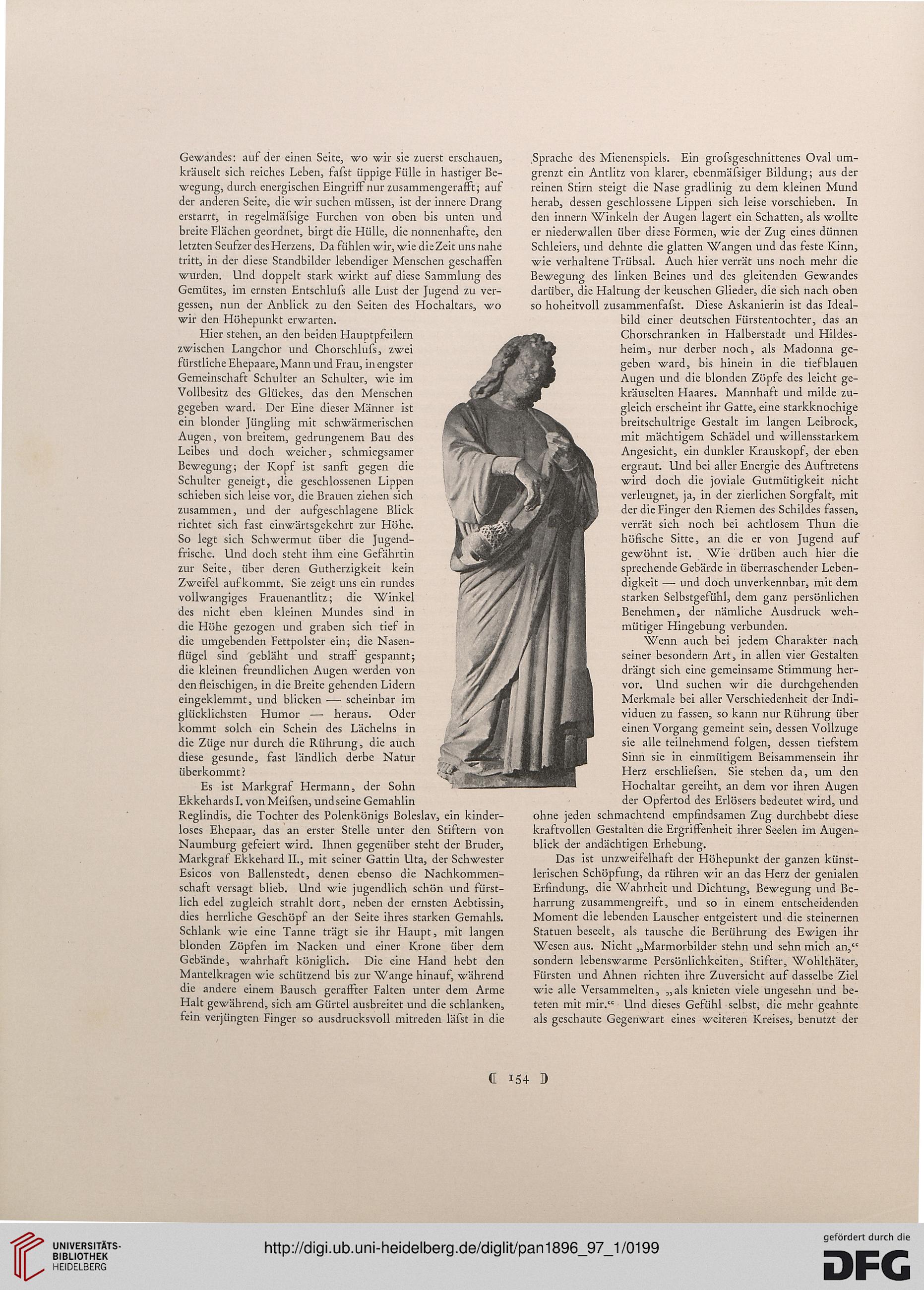Gewandes: auf der einen Seite, wo wir sie zuerst erschauen,
kräuselt sich reiches Leben, fafst üppige Fülle in hastiger Be-
wegung, durch energischen Eingriff nur zusammengerafft; auf
der anderen Seite, die wir suchen müssen, ist der innere Drang
erstarrt, in regelmäfsige Furchen von oben bis unten und
breite Flächen geordnet, birgt die Hülle, die nonnenhafte, den
letzten Seufzer des Herzens. Da fühlen wir, wie die Zeit uns nahe
tritt, in der diese Standbilder lebendiger Menschen geschaffen
wurden. Und doppelt stark wirkt auf diese Sammlung des
Gemütes, im ernsten Entschlufs alle Lust der Jugend zu ver-
gessen, nun der Anblick zu den Seiten des Hochaltars, wo
wir den Höhepunkt erwarten.
Hier stehen, an den beiden Hauptpfeilern
zwischen Langchor und Chorschlufs, zwei
fürstliche Ehepaare, Mann und Frau, in engster
Gemeinschaft Schulter an Schulter, wie im
Vollbesitz des Glückes, das den Menschen
gegeben ward. Der Eine dieser Männer ist
ein blonder Jüngling mit schwärmerischen
Augen, von breitem, gedrungenem Bau des
Leibes und doch weicher, schmiegsamer
Bewegung; der Kopf ist sanft gegen die
Schulter geneigt, die geschlossenen Lippen
schieben sich leise vor, die Brauen ziehen sich
zusammen, und der aufgeschlagene Blick
richtet sich fast einwärtsgekehrt zur Höhe.
So legt sich Schwermut über die Jugend-
frische. Und doch steht ihm eine Gefährtin
zur Seite, über deren Gutherzigkeit kein
Zweifel aufkommt. Sie zeigt uns ein rundes
vollwangiges Frauenantlitz; die "Winkel
des nicht eben kleinen Mundes sind in
die Höhe gezogen und graben sich tief in
die umgebenden Fettpolster ein; die Nasen-
flügel sind gebläht und straff gespannt;
die kleinen freundlichen Augen werden von
den fleischigen, in die Breite gehenden Lidern
eingeklemmt, und blicken — scheinbar im
glücklichsten Humor — heraus. Oder
kommt solch ein Schein des Lächelns in
die Züge nur durch die Rührung, die auch
diese gesunde, fast ländlich derbe Natur
überkommt ?
Es ist Markgraf Hermann, der Sohn
Ekkehards I. von Meifsen, und seine Gemahlin
Reglindis, die Tochter des Polenkönigs Boleslav, ein kinder-
loses Ehepaar, das an erster Stelle unter den Stiftern von
Naumburg gefeiert wird. Ihnen gegenüber steht der Bruder,
Markgraf Ekkehard IL, mit seiner Gattin Uta, der Schwester
Esicos von Ballenstedt, denen ebenso die Nachkommen-
schaft versagt blieb. Und wie jugendlich schön und fürst-
lich edel zugleich strahlt dort, neben der ernsten Aebtissin,
dies herrliche Geschöpf an der Seite ihres starken Gemahls.
Schlank wie eine Tanne trägt sie ihr Haupt, mit langen
blonden Zöpfen im Nacken und einer Krone über dem
Gebände, wahrhaft königlich. Die eine Hand hebt den
Mantelkragen wie schützend bis zur Wange hinauf, während
die andere einem Bausch geraffter Falten unter dem Arme
Halt gewährend, sich am Gürtel ausbreitet und die schlanken,
fein verjüngten Finger so ausdrucksvoll mitreden läfst in die
Sprache des Mienenspiels. Ein grofsgeschnittenes Oval um-
grenzt ein Antlitz von klarer, ebenmäfsiger Bildung; aus der
reinen Stirn steigt die Nase gradlinig zu dem kleinen Mund
herab, dessen geschlossene Lippen sich leise vorschieben. In
den innern Winkeln der Augen lagert ein Schatten, als wollte
er niederwallen über diese Formen, wie der Zug eines dünnen
Schleiers, und dehnte die glatten Wangen und das feste Kinn,
wie verhaltene Trübsal. Auch hier verrät uns noch mehr die
Bewegung des linken Beines und des gleitenden Gewandes
darüber, die Haltung der keuschen Glieder, die sich nach oben
so hoheitvoll zusammenfafst. Diese Askanierin ist das Ideal-
bild einer deutschen Fürstentochter, das an
Chorschranken in Halberstadt und Hildes-
heim, nur derber noch, als Madonna ge-
geben ward, bis hinein in die tiefblauen
Augen und die blonden Zöpfe des leicht ge-
kräuselten Haares. Mannhaft und milde zu-
gleich erscheint ihr Gatte, eine starkknochige
breitschultrige Gestalt im langen Leibrock,
mit mächtigem Schädel und willensstarkem
Angesicht, ein dunkler Krauskopf, der eben
ergraut. Und bei aller Energie des Auftretens
■wird doch die joviale Gutmütigkeit nicht
verleugnet, ja, in der zierlichen Sorgfalt, mit
der die Finger den Riemen des Schildes fassen,
verrät sich noch bei achtlosem Thun die
höfische Sitte, an die er von Jugend auf
gewöhnt ist. Wie drüben auch hier die
sprechende Gebärde in überraschender Leben-
digkeit — und doch unverkennbar, mit dem
starken Selbstgefühl, dem ganz persönlichen
Benehmen, der nämliche Ausdruck weh-
mütiger Hingebung verbunden.
Wenn auch bei jedem Charakter nach
seiner besondern Art, in allen vier Gestalten
drängt sich eine gemeinsame Stimmung her-
vor. Und suchen wir die durchgehenden
Merkmale bei aller Verschiedenheit der Indi-
viduen zu fassen, so kann nur Rührung über
einen Vorgang gemeint sein, dessen Vollzuge
sie alle teilnehmend folgen, dessen tiefstem
Sinn sie in einmütigem Beisammensein ihr
Herz erschliefsen. Sie stehen da, um den
Hochaltar gereiht, an dem vor ihren Augen
der Opfertod des Erlösers bedeutet wird, und
ohne jeden schmachtend empfindsamen Zug durchbebt diese
kraftvollen Gestalten die Ergriffenheit ihrer Seelen im Augen-
blick der andächtigen Erhebung.
Das ist unzweifelhaft der Höhepunkt der ganzen künst-
lerischen Schöpfung, da rühren wir an das Herz der genialen
Erfindung, die Wahrheit und Dichtung, Bewegung und Be-
harrung zusammengreift, und so in einem entscheidenden
Moment die lebenden Lauscher entgeistert und die steinernen
Statuen beseelt, als tausche die Berührung des Ewigen ihr
Wesen aus. Nicht „Marmorbilder stehn und sehn mich an,"
sondern lebenswarme Persönlichkeiten, Stifter, Wohlthäter,
Fürsten und Ahnen richten ihre Zuversicht auf dasselbe Ziel
wie alle Versammelten, „als knieten viele ungesehn und be-
teten mit mir." Und dieses Gefühl selbst, die mehr geahnte
als geschaute Gegenwart eines weiteren Kreises, benutzt der
C i54 D
kräuselt sich reiches Leben, fafst üppige Fülle in hastiger Be-
wegung, durch energischen Eingriff nur zusammengerafft; auf
der anderen Seite, die wir suchen müssen, ist der innere Drang
erstarrt, in regelmäfsige Furchen von oben bis unten und
breite Flächen geordnet, birgt die Hülle, die nonnenhafte, den
letzten Seufzer des Herzens. Da fühlen wir, wie die Zeit uns nahe
tritt, in der diese Standbilder lebendiger Menschen geschaffen
wurden. Und doppelt stark wirkt auf diese Sammlung des
Gemütes, im ernsten Entschlufs alle Lust der Jugend zu ver-
gessen, nun der Anblick zu den Seiten des Hochaltars, wo
wir den Höhepunkt erwarten.
Hier stehen, an den beiden Hauptpfeilern
zwischen Langchor und Chorschlufs, zwei
fürstliche Ehepaare, Mann und Frau, in engster
Gemeinschaft Schulter an Schulter, wie im
Vollbesitz des Glückes, das den Menschen
gegeben ward. Der Eine dieser Männer ist
ein blonder Jüngling mit schwärmerischen
Augen, von breitem, gedrungenem Bau des
Leibes und doch weicher, schmiegsamer
Bewegung; der Kopf ist sanft gegen die
Schulter geneigt, die geschlossenen Lippen
schieben sich leise vor, die Brauen ziehen sich
zusammen, und der aufgeschlagene Blick
richtet sich fast einwärtsgekehrt zur Höhe.
So legt sich Schwermut über die Jugend-
frische. Und doch steht ihm eine Gefährtin
zur Seite, über deren Gutherzigkeit kein
Zweifel aufkommt. Sie zeigt uns ein rundes
vollwangiges Frauenantlitz; die "Winkel
des nicht eben kleinen Mundes sind in
die Höhe gezogen und graben sich tief in
die umgebenden Fettpolster ein; die Nasen-
flügel sind gebläht und straff gespannt;
die kleinen freundlichen Augen werden von
den fleischigen, in die Breite gehenden Lidern
eingeklemmt, und blicken — scheinbar im
glücklichsten Humor — heraus. Oder
kommt solch ein Schein des Lächelns in
die Züge nur durch die Rührung, die auch
diese gesunde, fast ländlich derbe Natur
überkommt ?
Es ist Markgraf Hermann, der Sohn
Ekkehards I. von Meifsen, und seine Gemahlin
Reglindis, die Tochter des Polenkönigs Boleslav, ein kinder-
loses Ehepaar, das an erster Stelle unter den Stiftern von
Naumburg gefeiert wird. Ihnen gegenüber steht der Bruder,
Markgraf Ekkehard IL, mit seiner Gattin Uta, der Schwester
Esicos von Ballenstedt, denen ebenso die Nachkommen-
schaft versagt blieb. Und wie jugendlich schön und fürst-
lich edel zugleich strahlt dort, neben der ernsten Aebtissin,
dies herrliche Geschöpf an der Seite ihres starken Gemahls.
Schlank wie eine Tanne trägt sie ihr Haupt, mit langen
blonden Zöpfen im Nacken und einer Krone über dem
Gebände, wahrhaft königlich. Die eine Hand hebt den
Mantelkragen wie schützend bis zur Wange hinauf, während
die andere einem Bausch geraffter Falten unter dem Arme
Halt gewährend, sich am Gürtel ausbreitet und die schlanken,
fein verjüngten Finger so ausdrucksvoll mitreden läfst in die
Sprache des Mienenspiels. Ein grofsgeschnittenes Oval um-
grenzt ein Antlitz von klarer, ebenmäfsiger Bildung; aus der
reinen Stirn steigt die Nase gradlinig zu dem kleinen Mund
herab, dessen geschlossene Lippen sich leise vorschieben. In
den innern Winkeln der Augen lagert ein Schatten, als wollte
er niederwallen über diese Formen, wie der Zug eines dünnen
Schleiers, und dehnte die glatten Wangen und das feste Kinn,
wie verhaltene Trübsal. Auch hier verrät uns noch mehr die
Bewegung des linken Beines und des gleitenden Gewandes
darüber, die Haltung der keuschen Glieder, die sich nach oben
so hoheitvoll zusammenfafst. Diese Askanierin ist das Ideal-
bild einer deutschen Fürstentochter, das an
Chorschranken in Halberstadt und Hildes-
heim, nur derber noch, als Madonna ge-
geben ward, bis hinein in die tiefblauen
Augen und die blonden Zöpfe des leicht ge-
kräuselten Haares. Mannhaft und milde zu-
gleich erscheint ihr Gatte, eine starkknochige
breitschultrige Gestalt im langen Leibrock,
mit mächtigem Schädel und willensstarkem
Angesicht, ein dunkler Krauskopf, der eben
ergraut. Und bei aller Energie des Auftretens
■wird doch die joviale Gutmütigkeit nicht
verleugnet, ja, in der zierlichen Sorgfalt, mit
der die Finger den Riemen des Schildes fassen,
verrät sich noch bei achtlosem Thun die
höfische Sitte, an die er von Jugend auf
gewöhnt ist. Wie drüben auch hier die
sprechende Gebärde in überraschender Leben-
digkeit — und doch unverkennbar, mit dem
starken Selbstgefühl, dem ganz persönlichen
Benehmen, der nämliche Ausdruck weh-
mütiger Hingebung verbunden.
Wenn auch bei jedem Charakter nach
seiner besondern Art, in allen vier Gestalten
drängt sich eine gemeinsame Stimmung her-
vor. Und suchen wir die durchgehenden
Merkmale bei aller Verschiedenheit der Indi-
viduen zu fassen, so kann nur Rührung über
einen Vorgang gemeint sein, dessen Vollzuge
sie alle teilnehmend folgen, dessen tiefstem
Sinn sie in einmütigem Beisammensein ihr
Herz erschliefsen. Sie stehen da, um den
Hochaltar gereiht, an dem vor ihren Augen
der Opfertod des Erlösers bedeutet wird, und
ohne jeden schmachtend empfindsamen Zug durchbebt diese
kraftvollen Gestalten die Ergriffenheit ihrer Seelen im Augen-
blick der andächtigen Erhebung.
Das ist unzweifelhaft der Höhepunkt der ganzen künst-
lerischen Schöpfung, da rühren wir an das Herz der genialen
Erfindung, die Wahrheit und Dichtung, Bewegung und Be-
harrung zusammengreift, und so in einem entscheidenden
Moment die lebenden Lauscher entgeistert und die steinernen
Statuen beseelt, als tausche die Berührung des Ewigen ihr
Wesen aus. Nicht „Marmorbilder stehn und sehn mich an,"
sondern lebenswarme Persönlichkeiten, Stifter, Wohlthäter,
Fürsten und Ahnen richten ihre Zuversicht auf dasselbe Ziel
wie alle Versammelten, „als knieten viele ungesehn und be-
teten mit mir." Und dieses Gefühl selbst, die mehr geahnte
als geschaute Gegenwart eines weiteren Kreises, benutzt der
C i54 D