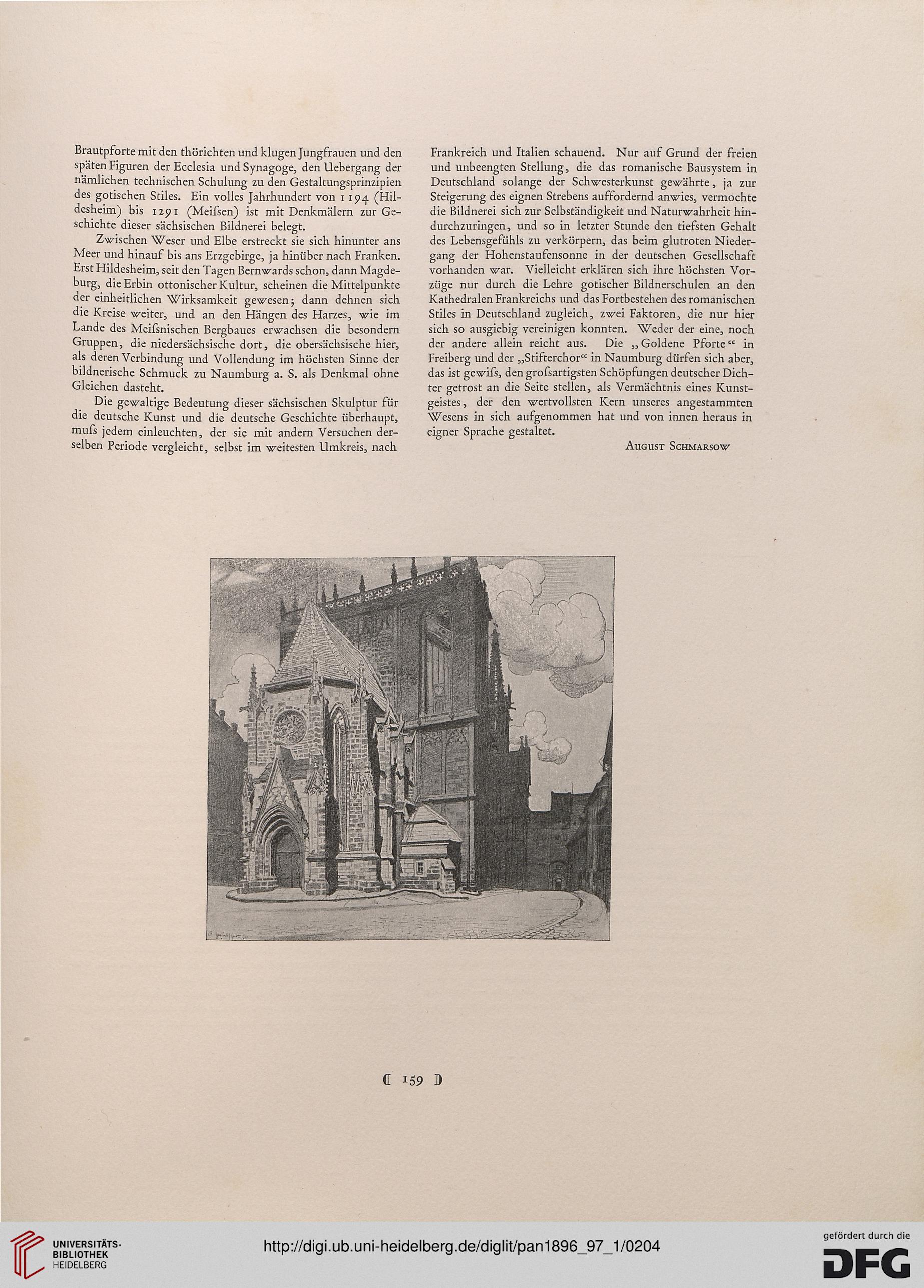Brautpforte mit den thörichten und klugen Jungfrauen und den
späten Figuren der Ecclesia und Synagoge, den Uebergang der
nämlichen technischen Schulung zu den Gestaltungsprinzipien
des gotischen Stiles. Ein volles Jahrhundert von 1104 (Hil-
desheim) bis 1201 (Meifsen) ist mit Denkmälern zur Ge-
schichte dieser sächsischen Bildnerei belegt.
Zwischen Weser und Elbe erstreckt sie sich hinunter ans
Meer und hinauf bis ans Erzgebirge, ja hinüber nach Franken.
Erst Hildesheim, seit den Tagen Bernwards schon, dann Magde-
burg, die Erbin ottonischer Kultur, scheinen die Mittelpunkte
der einheitlichen Wirksamkeit gewesen; dann dehnen sich
die Kreise weiter, und an den Hängen des Harzes, wie im
Lande des Meifsnischen Bergbaues erwachsen die besondern
Gruppen, die niedersächsische dort, die obersächsische hier,
als deren Verbindung und Vollendung im höchsten Sinne der
bildnerische Schmuck zu Naumburg a. S. als Denkmal ohne
Gleichen dasteht.
Die gewaltige Bedeutung dieser sächsischen Skulptur für
die deutsche Kunst und die deutsche Geschichte überhaupt,
mufs jedem einleuchten, der sie mit andern Versuchen der-
selben Periode vergleicht, selbst im weitesten Umkreis, nach
Frankreich und Italien schauend. Nur auf Grund der freien
und unbeengten Stellung, die das romanische Bausystem in
Deutschland solange der Schwesterkunst gewährte, ja zur
Steigerung des eignen Strebens auffordernd anwies, vermochte
die Bildnerei sich zur Selbständigkeit und Naturwahrheit hin-
durchzuringen, und so in letzter Stunde den tiefsten Gehalt
des Lebensgefühls zu verkörpern, das beim glutroten Nieder-
gang der Hohenstaufensonne in der deutschen Gesellschaft
vorhanden war. Vielleicht erklären sich ihre höchsten Vor-
züge nur durch die Lehre gotischer Bildnerschulen an den
Kathedralen Frankreichs und das Fortbestehen des romanischen
Stiles in Deutschland zugleich, zwei Faktoren, die nur hier
sich so ausgiebig vereinigen konnten. Weder der eine, noch
der andere allein reicht aus. Die „ Goldene Pforte" in
Freiberg und der „Stifterchor" in Naumburg dürfen sich aber,
das ist gewifs, den grofsartigsten Schöpfungen deutscher Dich-
ter getrost an die Seite stellen, als Vermächtnis eines Kunst-
geistes, der den wertvollsten Kern unseres angestammten
Wesens in sich aufgenommen hat und von innen heraus in
eigner Sprache gestaltet.
August Schmarsow
(T 159 3
späten Figuren der Ecclesia und Synagoge, den Uebergang der
nämlichen technischen Schulung zu den Gestaltungsprinzipien
des gotischen Stiles. Ein volles Jahrhundert von 1104 (Hil-
desheim) bis 1201 (Meifsen) ist mit Denkmälern zur Ge-
schichte dieser sächsischen Bildnerei belegt.
Zwischen Weser und Elbe erstreckt sie sich hinunter ans
Meer und hinauf bis ans Erzgebirge, ja hinüber nach Franken.
Erst Hildesheim, seit den Tagen Bernwards schon, dann Magde-
burg, die Erbin ottonischer Kultur, scheinen die Mittelpunkte
der einheitlichen Wirksamkeit gewesen; dann dehnen sich
die Kreise weiter, und an den Hängen des Harzes, wie im
Lande des Meifsnischen Bergbaues erwachsen die besondern
Gruppen, die niedersächsische dort, die obersächsische hier,
als deren Verbindung und Vollendung im höchsten Sinne der
bildnerische Schmuck zu Naumburg a. S. als Denkmal ohne
Gleichen dasteht.
Die gewaltige Bedeutung dieser sächsischen Skulptur für
die deutsche Kunst und die deutsche Geschichte überhaupt,
mufs jedem einleuchten, der sie mit andern Versuchen der-
selben Periode vergleicht, selbst im weitesten Umkreis, nach
Frankreich und Italien schauend. Nur auf Grund der freien
und unbeengten Stellung, die das romanische Bausystem in
Deutschland solange der Schwesterkunst gewährte, ja zur
Steigerung des eignen Strebens auffordernd anwies, vermochte
die Bildnerei sich zur Selbständigkeit und Naturwahrheit hin-
durchzuringen, und so in letzter Stunde den tiefsten Gehalt
des Lebensgefühls zu verkörpern, das beim glutroten Nieder-
gang der Hohenstaufensonne in der deutschen Gesellschaft
vorhanden war. Vielleicht erklären sich ihre höchsten Vor-
züge nur durch die Lehre gotischer Bildnerschulen an den
Kathedralen Frankreichs und das Fortbestehen des romanischen
Stiles in Deutschland zugleich, zwei Faktoren, die nur hier
sich so ausgiebig vereinigen konnten. Weder der eine, noch
der andere allein reicht aus. Die „ Goldene Pforte" in
Freiberg und der „Stifterchor" in Naumburg dürfen sich aber,
das ist gewifs, den grofsartigsten Schöpfungen deutscher Dich-
ter getrost an die Seite stellen, als Vermächtnis eines Kunst-
geistes, der den wertvollsten Kern unseres angestammten
Wesens in sich aufgenommen hat und von innen heraus in
eigner Sprache gestaltet.
August Schmarsow
(T 159 3