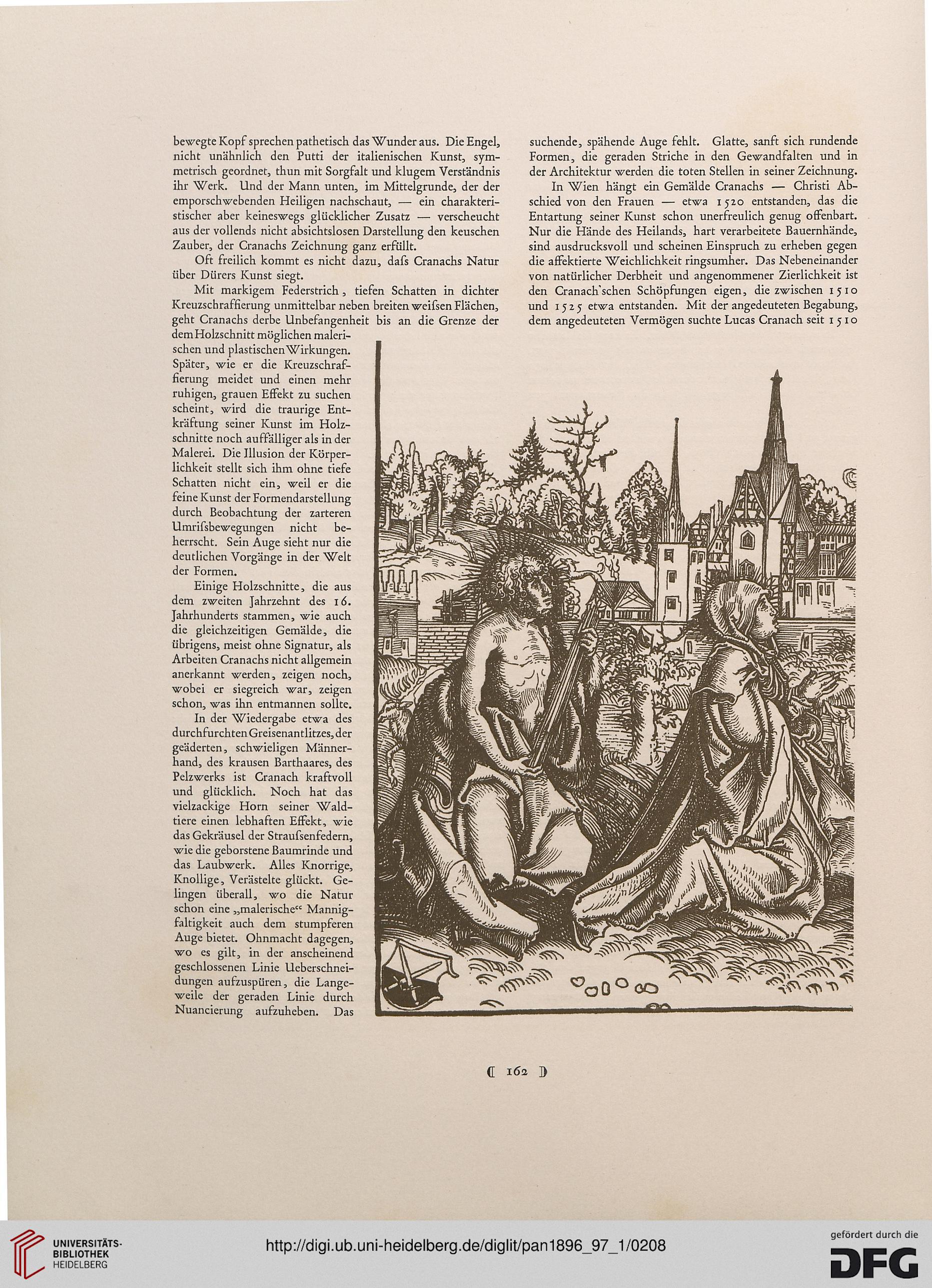bewegte Kopf sprechen pathetisch das "Wunder aus. Die Engel,
nicht unähnlich den Putti der italienischen Kunst, sym-
metrisch geordnet, thun mit Sorgfalt und klugem Verständnis
ihr Werk. Und der Mann unten, im Mittelgrunde, der der
emporschwebenden Heiligen nachschaut, — ein charakteri-
stischer aber keineswegs glücklicher Zusatz — verscheucht
aus der vollends nicht absichtslosen Darstellung den keuschen
Zauber, der Cranachs Zeichnung ganz erfüllt.
Oft freilich kommt es nicht dazu, dafs Cranachs Natur
über Dürers Kunst siegt.
Mit markigem Federstrich, tiefen Schatten in dichter
Kreuzschraffierung unmittelbar neben breiten weifsen Flächen,
geht Cranachs derbe Unbefangenheit bis an die Grenze der
dem Holzschnitt möglichen maleri-
schen und plastischen Wirkungen.
Später, wie er die Kreuzschraf-
fierung meidet und einen mehr
ruhigen, grauen Effekt zu suchen
scheint, wird die traurige Ent-
kräftung seiner Kunst im Holz-
schnitte noch auffälliger als in der
Malerei. Die Illusion der Körper-
lichkeit stellt sich ihm ohne tiefe
Schatten nicht ein, weil er die
feine Kunst der Formendarstellung
durch Beobachtung der zarteren
Umrifsbewegungen nicht be-
herrscht. Sein Auge sieht nur die
deutlichen Vorgänge in der Welt
der Formen.
Einige Holzschnitte, die aus
dem zweiten Jahrzehnt des 16.
Jahrhunderts stammen, wie auch
die gleichzeitigen Gemälde, die
übrigens, meist ohne Signatur, als
Arbeiten Cranachs nicht allgemein
anerkannt werden, zeigen noch,
wobei er siegreich war, zeigen
schon, was ihn entmannen sollte.
In der Wiedergabe etwa des
durchfurchten Greisenantlitzes, der
geäderten, schwieligen Männer-
hand, des krausen Barthaares, des
Pelzwerks ist Cranach kraftvoll
und glücklich. Noch hat das
vielzackige Hörn seiner Wald-
tiere einen lebhaften Effekt, wie
das Gekräusel der Straufsenfedern,
wie die geborstene Baumrinde und
das Laubwerk. Alles Knorrige,
Knollige, Verästelte glückt. Ge-
lingen überall, wo die Natur
schon eine „malerische" Mannig-
faltigkeit auch dem stumpferen
Auge bietet. Ohnmacht dagegen,
wo es gilt, in der anscheinend
geschlossenen Linie Ueberschnei-
dungen aufzuspüren, die Lange-
weile der geraden Linie durch
Nuancierung aufzuheben. Das
suchende, spähende Auge fehlt. Glatte, sanft sich rundende
Formen, die geraden Striche in den Gewandfalten und in
der Architektur werden die toten Stellen in seiner Zeichnung.
In Wien hängt ein Gemälde Cranachs — Christi Ab-
schied von den Frauen — etwa 1520 entstanden, das die
Entartung seiner Kunst schon unerfreulich genug offenbart.
Nur die Hände des Heilands, hart verarbeitete Bauernhände,
sind ausdrucksvoll und scheinen Einspruch zu erheben gegen
die affektierte Weichlichkeit ringsumher. Das Nebeneinander
von natürlicher Derbheit und angenommener Zierlichkeit ist
den Cranach'schen Schöpfungen eigen, die zwischen 15 10
und 1525 etwa entstanden. Mit der angedeuteten Begabung,
dem angedeuteten Vermögen suchte Lucas Cranach seit 1 51 o
C 16a »
nicht unähnlich den Putti der italienischen Kunst, sym-
metrisch geordnet, thun mit Sorgfalt und klugem Verständnis
ihr Werk. Und der Mann unten, im Mittelgrunde, der der
emporschwebenden Heiligen nachschaut, — ein charakteri-
stischer aber keineswegs glücklicher Zusatz — verscheucht
aus der vollends nicht absichtslosen Darstellung den keuschen
Zauber, der Cranachs Zeichnung ganz erfüllt.
Oft freilich kommt es nicht dazu, dafs Cranachs Natur
über Dürers Kunst siegt.
Mit markigem Federstrich, tiefen Schatten in dichter
Kreuzschraffierung unmittelbar neben breiten weifsen Flächen,
geht Cranachs derbe Unbefangenheit bis an die Grenze der
dem Holzschnitt möglichen maleri-
schen und plastischen Wirkungen.
Später, wie er die Kreuzschraf-
fierung meidet und einen mehr
ruhigen, grauen Effekt zu suchen
scheint, wird die traurige Ent-
kräftung seiner Kunst im Holz-
schnitte noch auffälliger als in der
Malerei. Die Illusion der Körper-
lichkeit stellt sich ihm ohne tiefe
Schatten nicht ein, weil er die
feine Kunst der Formendarstellung
durch Beobachtung der zarteren
Umrifsbewegungen nicht be-
herrscht. Sein Auge sieht nur die
deutlichen Vorgänge in der Welt
der Formen.
Einige Holzschnitte, die aus
dem zweiten Jahrzehnt des 16.
Jahrhunderts stammen, wie auch
die gleichzeitigen Gemälde, die
übrigens, meist ohne Signatur, als
Arbeiten Cranachs nicht allgemein
anerkannt werden, zeigen noch,
wobei er siegreich war, zeigen
schon, was ihn entmannen sollte.
In der Wiedergabe etwa des
durchfurchten Greisenantlitzes, der
geäderten, schwieligen Männer-
hand, des krausen Barthaares, des
Pelzwerks ist Cranach kraftvoll
und glücklich. Noch hat das
vielzackige Hörn seiner Wald-
tiere einen lebhaften Effekt, wie
das Gekräusel der Straufsenfedern,
wie die geborstene Baumrinde und
das Laubwerk. Alles Knorrige,
Knollige, Verästelte glückt. Ge-
lingen überall, wo die Natur
schon eine „malerische" Mannig-
faltigkeit auch dem stumpferen
Auge bietet. Ohnmacht dagegen,
wo es gilt, in der anscheinend
geschlossenen Linie Ueberschnei-
dungen aufzuspüren, die Lange-
weile der geraden Linie durch
Nuancierung aufzuheben. Das
suchende, spähende Auge fehlt. Glatte, sanft sich rundende
Formen, die geraden Striche in den Gewandfalten und in
der Architektur werden die toten Stellen in seiner Zeichnung.
In Wien hängt ein Gemälde Cranachs — Christi Ab-
schied von den Frauen — etwa 1520 entstanden, das die
Entartung seiner Kunst schon unerfreulich genug offenbart.
Nur die Hände des Heilands, hart verarbeitete Bauernhände,
sind ausdrucksvoll und scheinen Einspruch zu erheben gegen
die affektierte Weichlichkeit ringsumher. Das Nebeneinander
von natürlicher Derbheit und angenommener Zierlichkeit ist
den Cranach'schen Schöpfungen eigen, die zwischen 15 10
und 1525 etwa entstanden. Mit der angedeuteten Begabung,
dem angedeuteten Vermögen suchte Lucas Cranach seit 1 51 o
C 16a »