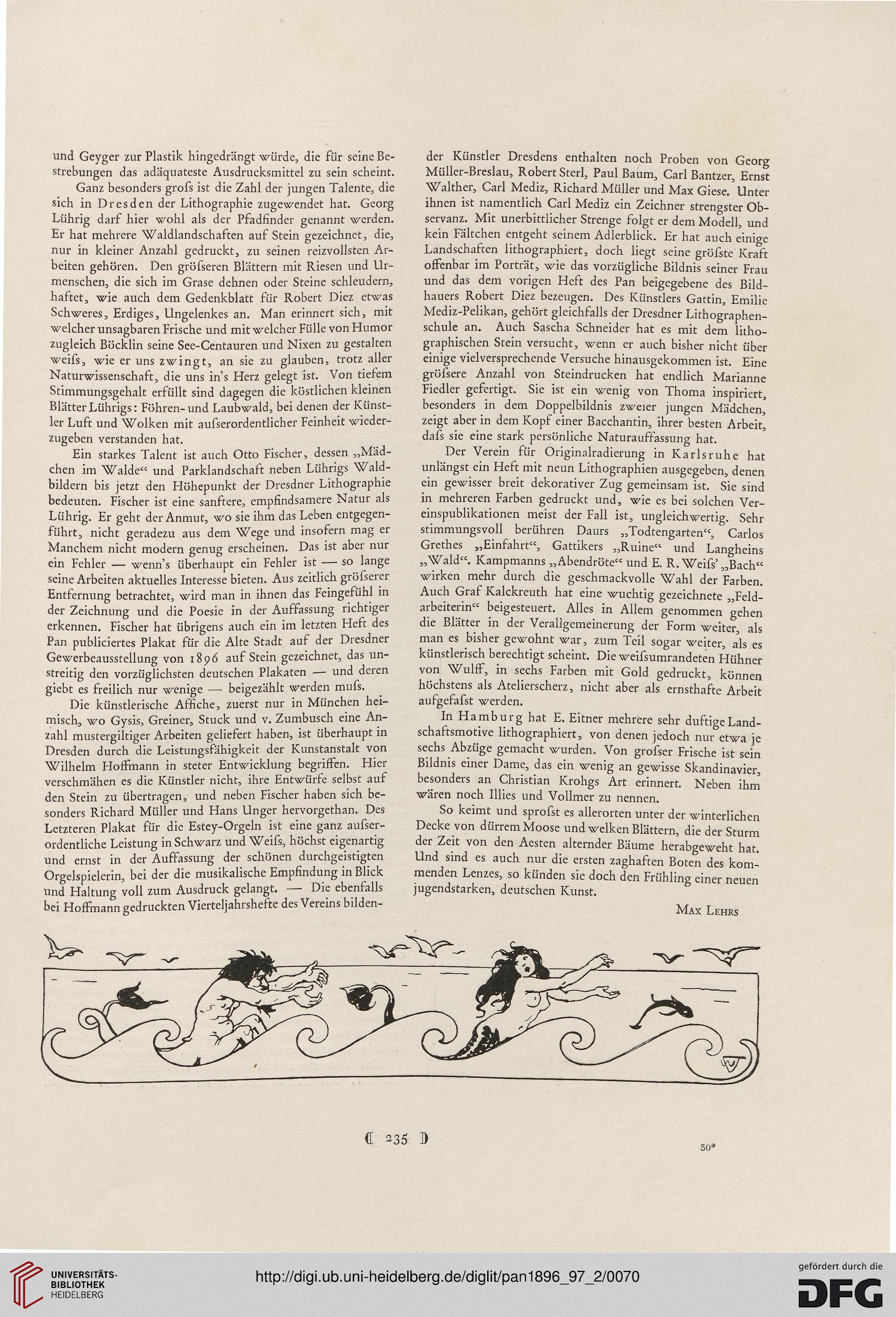und Geyger zur Plastik hingedrängt würde, die für seine Be-
strebungen das adäquateste Ausdrucksmittel zu sein scheint.
Ganz besonders grofs ist die Zahl der jungen Talente, die
sich in Dresden der Lithographie zugewendet hat. Georg
Lührig darf hier wohl als der Pfadfinder genannt werden.
Er hat mehrere Waldlandschaften auf Stein gezeichnet, die,
nur in kleiner Anzahl gedruckt, zu seinen reizvollsten Ar-
beiten gehören. Den gröfseren Blättern mit Riesen und Ur-
menschen, die sich im Grase dehnen oder Steine schleudern,
haftet, wie auch dem Gedenkblatt für Robert Diez etwas
Schweres, Erdiges, Ungelenkes an. Man erinnert sich, mit
welcher unsagbaren Frische und mit welcher Fülle von Humor
zugleich Böcklin seine See-Centauren und Nixen zu gestalten
weifs, wie er uns zwingt, an sie zu glauben, trotz aller
Naturwissenschaft, die uns ins Herz gelegt ist. Von tiefem
Stimmungsgehalt erfüllt sind dagegen die köstlichen kleinen
Blätter Lührigs: Föhren- und Laubwald, bei denen der Künst-
ler Luft und Wolken mit aufserordentlicher Feinheit wieder-
zugeben verstanden hat.
Ein starkes Talent ist auch Otto Fischer, dessen „Mäd-
chen im Walde« und Parklandschaft neben Lührigs Wald-
bildern bis jetzt den Höhepunkt der Dresdner Lithographie
bedeuten. Fischer ist eine sanftere, empfindsamere Natur als
Lührig. Er geht der Anmut, wo sie ihm das Leben entgegen-
führt, nicht geradezu aus dem Wege und insofern mag er
Manchem nicht modern genug erscheinen. Das ist aber nur
ein Fehler — wenn's überhaupt ein Fehler ist — so lange
seine Arbeiten aktuelles Interesse bieten. Aus zeitlich gröfserer
Entfernung betrachtet, wird man in ihnen das Feingefühl in
der Zeichnung und die Poesie in der Auffassung richtiger
erkennen. Fischer hat übrigens auch ein im letzten Heft des
Pan publiciertes Plakat für die Alte Stadt auf der Dresdner
Gewerbeausstellung von 1896 auf Stein gezeichnet, das un-
streitig den vorzüglichsten deutschen Plakaten — und deren
giebt es freilich nur wenige — beigezählt werden mufs.
Die künstlerische Affiche, zuerst nur in München hei-
misch, wo Gysis, Greiner, Stuck und v. Zumbusch eine An-
zahl mustergiltiger Arbeiten geliefert haben, ist überhaupt in
Dresden durch die Leistungsfähigkeit der Kunstanstalt von
Wilhelm Hoffmann in steter Entwicklung begriffen. Hier
verschmähen es die Künstler nicht, ihre Entwürfe selbst auf
den Stein zu übertragen, und neben Fischer haben sich be-
sonders Richard Müller und Hans Unger hervorgethan. Des
Letzteren Plakat für die Estey-Orgeln ist eine ganz aufser-
ordentliche Leistung in Schwarz und Weifs, höchst eigenartig
und ernst in der Auffassung der schönen durchgeistigten
Orgelspielerin, bei der die musikalische Empfindung in Blick
und Haltung voll zum Ausdruck gelangt. — Die ebenfalls
bei Hoffmann gedruckten Vierteljahrshefte des Vereins bilden-
der Künstler Dresdens enthalten noch Proben von Georg
Müller-Breslau, Robert Sterl, Paul Baum, Carl Bantzer, Ernst
Walther, Carl Mediz, Richard Müller und Max Giese. Unter
ihnen ist namentlich Carl Mediz ein Zeichner strengster Ob-
servanz. Mit unerbittlicher Strenge folgt er dem Modell, und
kein Fältchen entgeht seinem Adlerblick. Er hat auch einige
Landschaften lithographiert, doch liegt seine gröfste Kraft
offenbar im Porträt, wie das vorzügliche Bildnis seiner Frau
und das dem vorigen Heft des Pan beigegebene des Bild-
hauers Robert Diez bezeugen. Des Künstlers Gattin, Emilie
Mediz-Pelikan, gehört gleichfalls der Dresdner Lithographen-
schule an. Auch Sascha Schneider hat es mit dem litho-
graphischen Stein versucht, wenn er auch bisher nicht über
einige vielversprechende Versuche hinausgekommen ist. Eine
gröfsere Anzahl von Steindrucken hat endlich Marianne
Fiedler gefertigt. Sie ist ein wenig von Thoma inspiriert,
besonders in dem Doppelbildnis zweier jungen Mädchen'
zeigt aber in dem Kopf einer Bacchantin, ihrer besten Arbeit,
dafs sie eine stark persönliche Naturauffassung hat.
Der Verein für Originalradierung in Karlsruhe hat
unlängst ein Heft mit neun Lithographien ausgegeben, denen
ein gewisser breit dekorativer Zug gemeinsam ist. Sie sind
in mehreren Farben gedruckt und, wie es bei solchen Ver-
einspublikationen meist der Fall ist, ungleichwertig. Sehr
stimmungsvoll berühren Daurs „Todtengarten", Carlos
Grethes „Einfahrt", Gattikers „Ruine" und Langheins
„Wald". Kampmanns „Abendröte" und E. R. Weifs' „Bach"
wirken mehr durch die geschmackvolle Wahl der Farben.
Auch Graf Kalckreuth hat eine wuchtig gezeichnete „Feld-
arbeiterin" beigesteuert. Alles in Allem genommen gehen
die Blätter in der Verallgemeinerung der Form weiter, als
man es bisher gewohnt war, zum Teil sogar weiter, als es
künstlerisch berechtigt scheint. Dieweifsumrandeten Hühner
von Wulff, in sechs Farben mit Gold gedruckt, können
höchstens als Atelierscherz, nicht aber als ernsthafte Arbeit
aufgefafst werden.
In Hamburg hat E. Eitner mehrere sehr duftige Land-
schaftsmotive lithographiert, von denen jedoch nur etwa je
sechs Abzüge gemacht wurden. Von grofser Frische ist sein
Bildnis einer Dame, das ein wenig an gewisse Skandinavier,
besonders an Christian Krohgs Art erinnert. Neben ihm
wären noch Illies und Vollmer zu nennen.
So keimt und sprofst es allerorten unter der winterlichen
Decke von dürrem Moose und welken Blättern, die der Sturm
der Zeit von den Aesten alternder Bäume herabgeweht hat.
Und sind es auch nur die ersten zaghaften Boten des kom-
menden Lenzes, so künden sie doch den Frühling einer neuen
jugendstarken, deutschen Kunst.
Max Lehrs
-^-^T~
C 235 B
50*
strebungen das adäquateste Ausdrucksmittel zu sein scheint.
Ganz besonders grofs ist die Zahl der jungen Talente, die
sich in Dresden der Lithographie zugewendet hat. Georg
Lührig darf hier wohl als der Pfadfinder genannt werden.
Er hat mehrere Waldlandschaften auf Stein gezeichnet, die,
nur in kleiner Anzahl gedruckt, zu seinen reizvollsten Ar-
beiten gehören. Den gröfseren Blättern mit Riesen und Ur-
menschen, die sich im Grase dehnen oder Steine schleudern,
haftet, wie auch dem Gedenkblatt für Robert Diez etwas
Schweres, Erdiges, Ungelenkes an. Man erinnert sich, mit
welcher unsagbaren Frische und mit welcher Fülle von Humor
zugleich Böcklin seine See-Centauren und Nixen zu gestalten
weifs, wie er uns zwingt, an sie zu glauben, trotz aller
Naturwissenschaft, die uns ins Herz gelegt ist. Von tiefem
Stimmungsgehalt erfüllt sind dagegen die köstlichen kleinen
Blätter Lührigs: Föhren- und Laubwald, bei denen der Künst-
ler Luft und Wolken mit aufserordentlicher Feinheit wieder-
zugeben verstanden hat.
Ein starkes Talent ist auch Otto Fischer, dessen „Mäd-
chen im Walde« und Parklandschaft neben Lührigs Wald-
bildern bis jetzt den Höhepunkt der Dresdner Lithographie
bedeuten. Fischer ist eine sanftere, empfindsamere Natur als
Lührig. Er geht der Anmut, wo sie ihm das Leben entgegen-
führt, nicht geradezu aus dem Wege und insofern mag er
Manchem nicht modern genug erscheinen. Das ist aber nur
ein Fehler — wenn's überhaupt ein Fehler ist — so lange
seine Arbeiten aktuelles Interesse bieten. Aus zeitlich gröfserer
Entfernung betrachtet, wird man in ihnen das Feingefühl in
der Zeichnung und die Poesie in der Auffassung richtiger
erkennen. Fischer hat übrigens auch ein im letzten Heft des
Pan publiciertes Plakat für die Alte Stadt auf der Dresdner
Gewerbeausstellung von 1896 auf Stein gezeichnet, das un-
streitig den vorzüglichsten deutschen Plakaten — und deren
giebt es freilich nur wenige — beigezählt werden mufs.
Die künstlerische Affiche, zuerst nur in München hei-
misch, wo Gysis, Greiner, Stuck und v. Zumbusch eine An-
zahl mustergiltiger Arbeiten geliefert haben, ist überhaupt in
Dresden durch die Leistungsfähigkeit der Kunstanstalt von
Wilhelm Hoffmann in steter Entwicklung begriffen. Hier
verschmähen es die Künstler nicht, ihre Entwürfe selbst auf
den Stein zu übertragen, und neben Fischer haben sich be-
sonders Richard Müller und Hans Unger hervorgethan. Des
Letzteren Plakat für die Estey-Orgeln ist eine ganz aufser-
ordentliche Leistung in Schwarz und Weifs, höchst eigenartig
und ernst in der Auffassung der schönen durchgeistigten
Orgelspielerin, bei der die musikalische Empfindung in Blick
und Haltung voll zum Ausdruck gelangt. — Die ebenfalls
bei Hoffmann gedruckten Vierteljahrshefte des Vereins bilden-
der Künstler Dresdens enthalten noch Proben von Georg
Müller-Breslau, Robert Sterl, Paul Baum, Carl Bantzer, Ernst
Walther, Carl Mediz, Richard Müller und Max Giese. Unter
ihnen ist namentlich Carl Mediz ein Zeichner strengster Ob-
servanz. Mit unerbittlicher Strenge folgt er dem Modell, und
kein Fältchen entgeht seinem Adlerblick. Er hat auch einige
Landschaften lithographiert, doch liegt seine gröfste Kraft
offenbar im Porträt, wie das vorzügliche Bildnis seiner Frau
und das dem vorigen Heft des Pan beigegebene des Bild-
hauers Robert Diez bezeugen. Des Künstlers Gattin, Emilie
Mediz-Pelikan, gehört gleichfalls der Dresdner Lithographen-
schule an. Auch Sascha Schneider hat es mit dem litho-
graphischen Stein versucht, wenn er auch bisher nicht über
einige vielversprechende Versuche hinausgekommen ist. Eine
gröfsere Anzahl von Steindrucken hat endlich Marianne
Fiedler gefertigt. Sie ist ein wenig von Thoma inspiriert,
besonders in dem Doppelbildnis zweier jungen Mädchen'
zeigt aber in dem Kopf einer Bacchantin, ihrer besten Arbeit,
dafs sie eine stark persönliche Naturauffassung hat.
Der Verein für Originalradierung in Karlsruhe hat
unlängst ein Heft mit neun Lithographien ausgegeben, denen
ein gewisser breit dekorativer Zug gemeinsam ist. Sie sind
in mehreren Farben gedruckt und, wie es bei solchen Ver-
einspublikationen meist der Fall ist, ungleichwertig. Sehr
stimmungsvoll berühren Daurs „Todtengarten", Carlos
Grethes „Einfahrt", Gattikers „Ruine" und Langheins
„Wald". Kampmanns „Abendröte" und E. R. Weifs' „Bach"
wirken mehr durch die geschmackvolle Wahl der Farben.
Auch Graf Kalckreuth hat eine wuchtig gezeichnete „Feld-
arbeiterin" beigesteuert. Alles in Allem genommen gehen
die Blätter in der Verallgemeinerung der Form weiter, als
man es bisher gewohnt war, zum Teil sogar weiter, als es
künstlerisch berechtigt scheint. Dieweifsumrandeten Hühner
von Wulff, in sechs Farben mit Gold gedruckt, können
höchstens als Atelierscherz, nicht aber als ernsthafte Arbeit
aufgefafst werden.
In Hamburg hat E. Eitner mehrere sehr duftige Land-
schaftsmotive lithographiert, von denen jedoch nur etwa je
sechs Abzüge gemacht wurden. Von grofser Frische ist sein
Bildnis einer Dame, das ein wenig an gewisse Skandinavier,
besonders an Christian Krohgs Art erinnert. Neben ihm
wären noch Illies und Vollmer zu nennen.
So keimt und sprofst es allerorten unter der winterlichen
Decke von dürrem Moose und welken Blättern, die der Sturm
der Zeit von den Aesten alternder Bäume herabgeweht hat.
Und sind es auch nur die ersten zaghaften Boten des kom-
menden Lenzes, so künden sie doch den Frühling einer neuen
jugendstarken, deutschen Kunst.
Max Lehrs
-^-^T~
C 235 B
50*