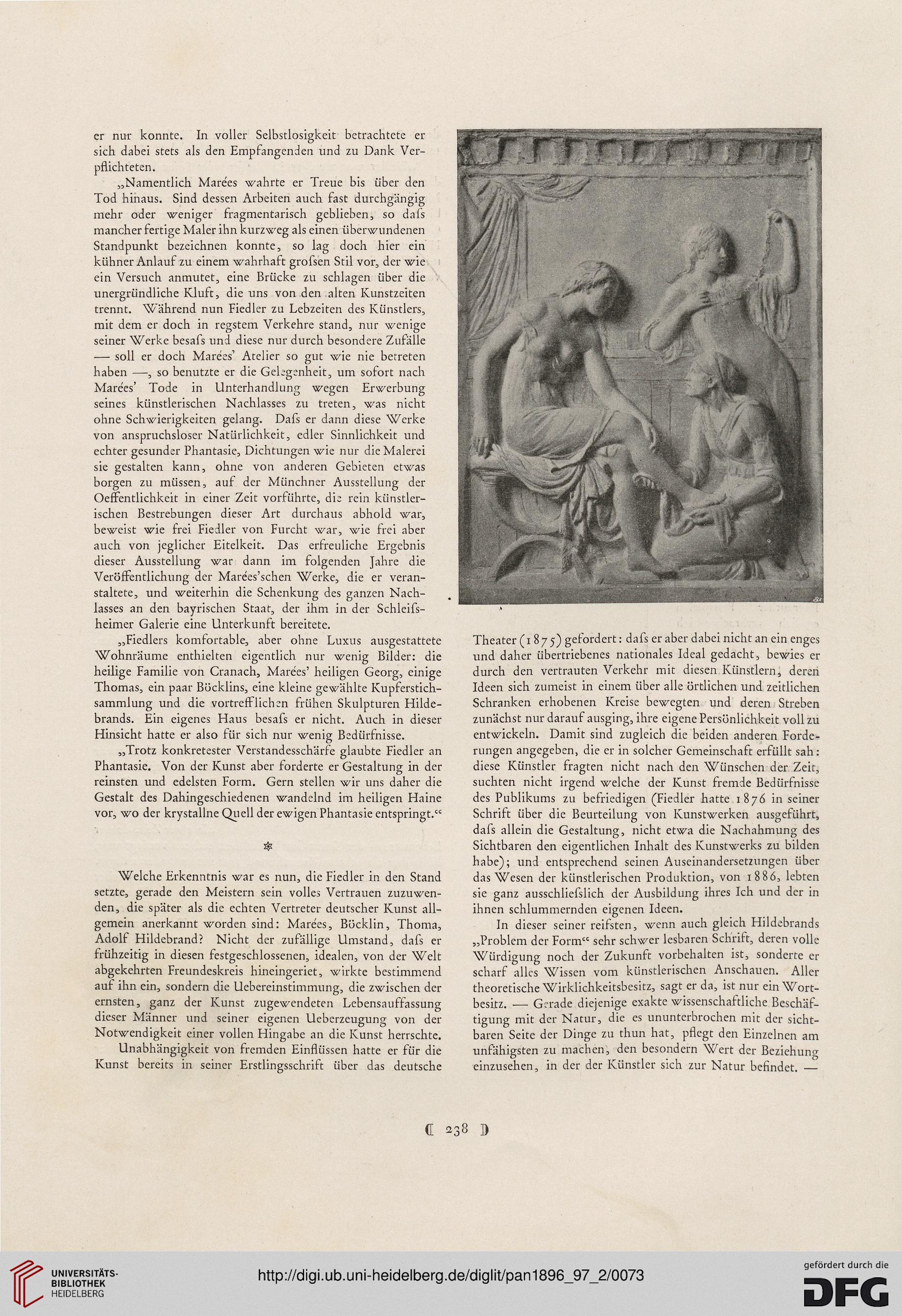er nur konnte. In voller Selbstlosigkeit betrachtete er
sich dabei stets als den Empfangenden und zu Dank Ver-
pflichteten.
„Namentlich Mare'es wahrte er Treue bis über den
Tod hinaus. Sind dessen Arbeiten auch fast durchgängig
mehr oder weniger fragmentarisch geblieben, so dafs
mancher fertige Maler ihn kurzweg als einen überwundenen
Standpunkt bezeichnen konnte, so lag doch hier ein
kühner Anlauf zu einem wahrhaft grofsen Stil vor, der wie
ein Versuch anmutet, eine Brücke zu schlagen über die
unergründliche Kluft, die uns von den alten Kunstzeiten
trennt. Während nun Fiedler zu Lebzeiten des Künstlers,
mit dem er doch in regstem Verkehre stand, nur wenige
seiner Werke besafs und diese nur durch besondere Zufälle
— soll er doch Marees' Atelier so gut wie nie betreten
haben —, so benutzte er die Gelegenheit, um sofort nach
Marees' Tode in Unterhandlung wegen Erwerbung
seines künstlerischen Nachlasses zu treten, was nicht
ohne Schwierigkeiten gelang. Dafs er dann diese Werke
von anspruchsloser Natürlichkeit, edler Sinnlichkeit und
echter gesunder Phantasie, Dichtungen wie nur die Malerei
sie gestalten kann, ohne von anderen Gebieten etwas
borgen zu müssen, auf der Münchner Ausstellung der
OefFentlichkeit in einer Zeit vorführte, die rein künstler-
ischen Bestrebungen dieser Art durchaus abhold war,
beweist wie frei Fiedler von Furcht war, wie frei aber
auch von jeglicher Eitelkeit. Das erfreuliche Ergebnis
dieser Ausstellung war dann im folgenden Jahre die
Veröffentlichung der Marees'schen Werke, die er veran-
staltete, und weiterhin die Schenkung des ganzen Nach-
lasses an den bayrischen Staat, der ihm in der Schleifs-
heimer Galerie eine Unterkunft bereitete.
„Fiedlers komfortable, aber ohne Luxus ausgestattete
Wohnräume enthielten eigentlich nur wenig Bilder: die
heilige Familie von Cranach, Marees' heiligen Georg, einige
Thomas, ein paar Böcklins, eine kleine gewählte Kupferstich-
sammlung und die vortrefflichen frühen Skulpturen Hilde-
brands. Ein eigenes Haus besafs er nicht. Auch in dieser
Hinsicht hatte er also für sich nur wenig Bedürfnisse.
„Trotz konkretester Verstandesschärfe glaubte Fiedler an
Phantasie. Von der Kunst aber forderte er Gestaltung in der
reinsten und edelsten Form. Gern stellen wir uns daher die
Gestalt des Dahingeschiedenen wandelnd im heiligen Haine
vor, wo der krystallne Quell der ewigen Phantasie entspringt."
&
Welche Erkenntnis war es nun, die Fiedler in den Stand
setzte, gerade den Meistern sein volles Vertrauen zuzuwen-
den, die später als die echten Vertreter deutscher Kunst all-
gemein anerkannt worden sind: Marees, Böcklin, Thoma,
Adolf Hildebrand? Nicht der zufällige Umstand, dafs er
frühzeitig in diesen festgeschlossenen, idealen, von der Welt
abgekehrten Freundeskreis hineingeriet, wirkte bestimmend
auf ihn ein, sondern die Uebereinstimmnng, die zwischen der
ernsten, ganz der Kunst zugewendeten Lebensauffassung
dieser Männer und seiner eigenen Ueberzeugung von der
Notwendigkeit einer vollen Hingabe an die Kunst herrschte.
Unabhängigkeit von fremden Einflüssen hatte er für die
Kunst bereits in seiner Erstlingsschrift über das deutsche
Theater (1875) gefordert: dafs er aber dabei nicht an ein enges
und daher übertriebenes nationales Ideal gedacht, bewies er
durch den vertrauten Verkehr mit diesen Künstlern, deren
Ideen sich zumeist in einem über alle örtlichen und zeitlichen
Schranken erhobenen Kreise bewegten und deren Streben
zunächst nur darauf ausging, ihre eigene Persönlichkeit voll zu
entwickeln. Damit sind zugleich die beiden anderen Forde-
rungen angegeben, die er in solcher Gemeinschaft erfüllt sah:
diese Künstler fragten nicht nach den Wünschen der Zeit,
suchten nicht irgend welche der Kunst fremde Bedürfnisse
des Publikums zu befriedigen (Fiedler hatte 1876 in seiner
Schrift über die Beurteilung von Kunstwerken ausgeführt,
dafs allein die Gestaltung, nicht etwa die Nachahmung des
Sichtbaren den eigentlichen Inhalt des Kunstwerks zu bilden
habe); und entsprechend seinen Auseinandersetzungen über
das Wesen der künstlerischen Produktion, von 1886, lebten
sie ganz ausschliefslich der Ausbildung ihres Ich und der in
ihnen schlummernden eigenen Ideen.
In dieser seiner reifsten, wenn auch gleich Hildebrands
„Problem der Form" sehr schwer lesbaren Schrift, deren volle
Würdigung noch der Zukunft vorbehalten ist, sonderte er
scharf alles Wissen vom künstlerischen Anschauen. Aller
theoretische Wirklichkeitsbesitz, sagt er da, ist nur ein Wort-
besitz. — Gerade diejenige exakte wissenschaftliche Beschäf-
tigung mit der Natur, die es ununterbrochen mit der sicht-
baren Seite der Dinge zu thun hat, pflegt den Einzelnen am
unfähigsten zu machen, den besondern Wert der Beziehung
einzusehen, in der der Künstler sich zur Natur befindet. —
C 238 I)
sich dabei stets als den Empfangenden und zu Dank Ver-
pflichteten.
„Namentlich Mare'es wahrte er Treue bis über den
Tod hinaus. Sind dessen Arbeiten auch fast durchgängig
mehr oder weniger fragmentarisch geblieben, so dafs
mancher fertige Maler ihn kurzweg als einen überwundenen
Standpunkt bezeichnen konnte, so lag doch hier ein
kühner Anlauf zu einem wahrhaft grofsen Stil vor, der wie
ein Versuch anmutet, eine Brücke zu schlagen über die
unergründliche Kluft, die uns von den alten Kunstzeiten
trennt. Während nun Fiedler zu Lebzeiten des Künstlers,
mit dem er doch in regstem Verkehre stand, nur wenige
seiner Werke besafs und diese nur durch besondere Zufälle
— soll er doch Marees' Atelier so gut wie nie betreten
haben —, so benutzte er die Gelegenheit, um sofort nach
Marees' Tode in Unterhandlung wegen Erwerbung
seines künstlerischen Nachlasses zu treten, was nicht
ohne Schwierigkeiten gelang. Dafs er dann diese Werke
von anspruchsloser Natürlichkeit, edler Sinnlichkeit und
echter gesunder Phantasie, Dichtungen wie nur die Malerei
sie gestalten kann, ohne von anderen Gebieten etwas
borgen zu müssen, auf der Münchner Ausstellung der
OefFentlichkeit in einer Zeit vorführte, die rein künstler-
ischen Bestrebungen dieser Art durchaus abhold war,
beweist wie frei Fiedler von Furcht war, wie frei aber
auch von jeglicher Eitelkeit. Das erfreuliche Ergebnis
dieser Ausstellung war dann im folgenden Jahre die
Veröffentlichung der Marees'schen Werke, die er veran-
staltete, und weiterhin die Schenkung des ganzen Nach-
lasses an den bayrischen Staat, der ihm in der Schleifs-
heimer Galerie eine Unterkunft bereitete.
„Fiedlers komfortable, aber ohne Luxus ausgestattete
Wohnräume enthielten eigentlich nur wenig Bilder: die
heilige Familie von Cranach, Marees' heiligen Georg, einige
Thomas, ein paar Böcklins, eine kleine gewählte Kupferstich-
sammlung und die vortrefflichen frühen Skulpturen Hilde-
brands. Ein eigenes Haus besafs er nicht. Auch in dieser
Hinsicht hatte er also für sich nur wenig Bedürfnisse.
„Trotz konkretester Verstandesschärfe glaubte Fiedler an
Phantasie. Von der Kunst aber forderte er Gestaltung in der
reinsten und edelsten Form. Gern stellen wir uns daher die
Gestalt des Dahingeschiedenen wandelnd im heiligen Haine
vor, wo der krystallne Quell der ewigen Phantasie entspringt."
&
Welche Erkenntnis war es nun, die Fiedler in den Stand
setzte, gerade den Meistern sein volles Vertrauen zuzuwen-
den, die später als die echten Vertreter deutscher Kunst all-
gemein anerkannt worden sind: Marees, Böcklin, Thoma,
Adolf Hildebrand? Nicht der zufällige Umstand, dafs er
frühzeitig in diesen festgeschlossenen, idealen, von der Welt
abgekehrten Freundeskreis hineingeriet, wirkte bestimmend
auf ihn ein, sondern die Uebereinstimmnng, die zwischen der
ernsten, ganz der Kunst zugewendeten Lebensauffassung
dieser Männer und seiner eigenen Ueberzeugung von der
Notwendigkeit einer vollen Hingabe an die Kunst herrschte.
Unabhängigkeit von fremden Einflüssen hatte er für die
Kunst bereits in seiner Erstlingsschrift über das deutsche
Theater (1875) gefordert: dafs er aber dabei nicht an ein enges
und daher übertriebenes nationales Ideal gedacht, bewies er
durch den vertrauten Verkehr mit diesen Künstlern, deren
Ideen sich zumeist in einem über alle örtlichen und zeitlichen
Schranken erhobenen Kreise bewegten und deren Streben
zunächst nur darauf ausging, ihre eigene Persönlichkeit voll zu
entwickeln. Damit sind zugleich die beiden anderen Forde-
rungen angegeben, die er in solcher Gemeinschaft erfüllt sah:
diese Künstler fragten nicht nach den Wünschen der Zeit,
suchten nicht irgend welche der Kunst fremde Bedürfnisse
des Publikums zu befriedigen (Fiedler hatte 1876 in seiner
Schrift über die Beurteilung von Kunstwerken ausgeführt,
dafs allein die Gestaltung, nicht etwa die Nachahmung des
Sichtbaren den eigentlichen Inhalt des Kunstwerks zu bilden
habe); und entsprechend seinen Auseinandersetzungen über
das Wesen der künstlerischen Produktion, von 1886, lebten
sie ganz ausschliefslich der Ausbildung ihres Ich und der in
ihnen schlummernden eigenen Ideen.
In dieser seiner reifsten, wenn auch gleich Hildebrands
„Problem der Form" sehr schwer lesbaren Schrift, deren volle
Würdigung noch der Zukunft vorbehalten ist, sonderte er
scharf alles Wissen vom künstlerischen Anschauen. Aller
theoretische Wirklichkeitsbesitz, sagt er da, ist nur ein Wort-
besitz. — Gerade diejenige exakte wissenschaftliche Beschäf-
tigung mit der Natur, die es ununterbrochen mit der sicht-
baren Seite der Dinge zu thun hat, pflegt den Einzelnen am
unfähigsten zu machen, den besondern Wert der Beziehung
einzusehen, in der der Künstler sich zur Natur befindet. —
C 238 I)