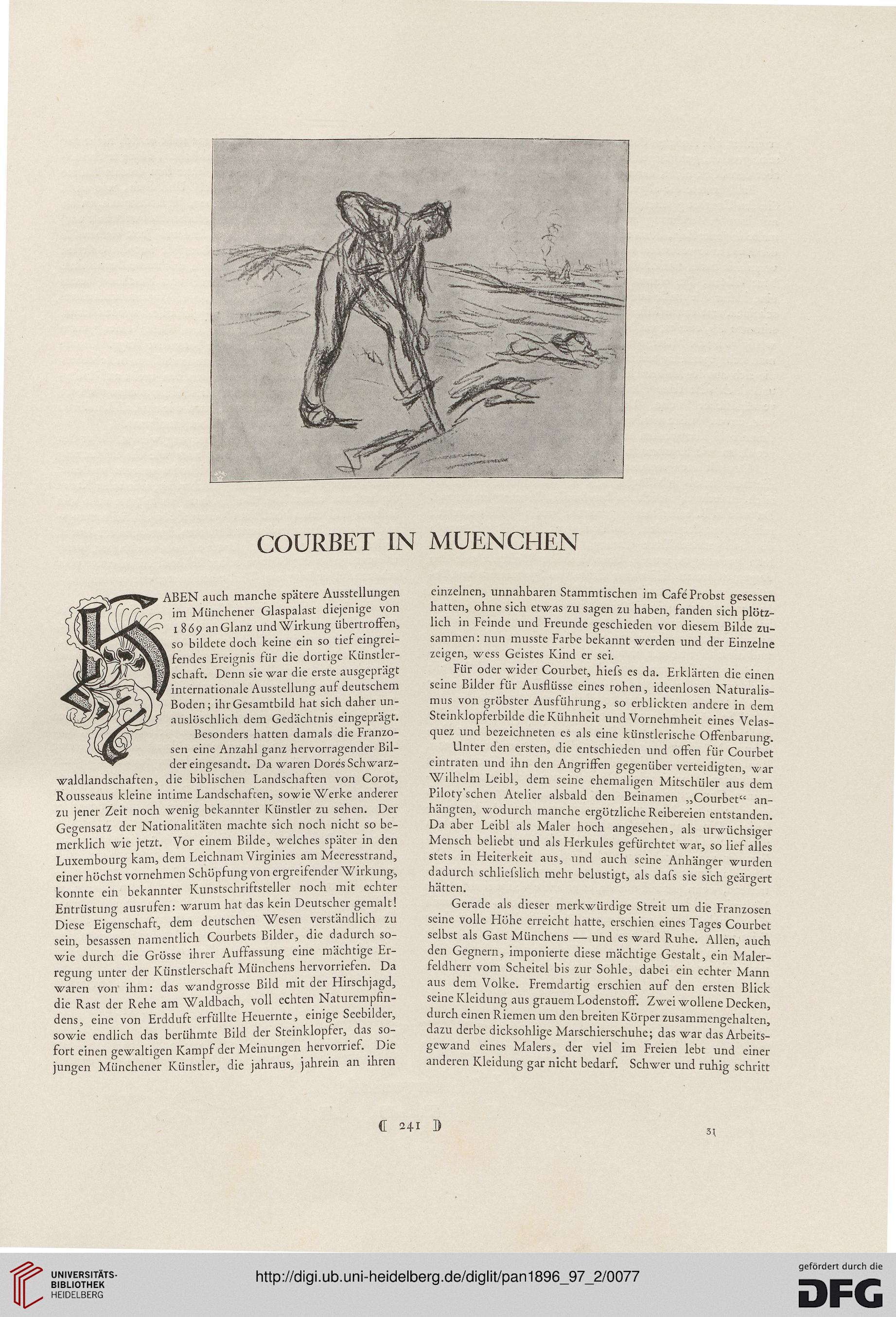COURBET IN MUENCHEN
ABEN auch manche spätere Ausstellungen
im Münchener Glaspalast diejenige von
i 86p an Glanz und Wirkung übertroffen,
so bildete doch keine ein so tief eingrei-
fendes Ereignis für die dortige Künstler-
Ischaft. Denn sie war die erste ausgeprägt
internationale Ausstellung auf deutschem
Boden; ihr Gesamtbild hat sich daher un-
auslöschlich dem Gedächtnis eingeprägt.
Besonders hatten damals die Franzo-
sen eine Anzahl ganz hervorragender Bil-
der eingesandt. Da waren Dores Schwarz-
waldlandschaften, die biblischen Landschaften von Corot,
Rousseaus kleine intime Landschaften, sowie Werke anderer
zu jener Zeit noch wenig bekannter Künstler zu sehen. Der
Gegensatz der Nationalitäten machte sich noch nicht so be-
merklich wie jetzt. Vor einem Bilde, welches später in den
Luxembourg kam, dem Leichnam Virginies am Meeresstrand,
einer höchst vornehmen Schöpfung von ergreifender Wirkung,
konnte ein bekannter Kunstschriftsteller noch mit echter
Entrüstung ausrufen: warum hat das kein Deutscher gemalt!
Diese Eigenschaft, dem deutschen Wesen verständlich zu
sein, besassen namentlich Courbets Bilder, die dadurch so-
wie durch die Grösse ihrer Auffassung eine mächtige Er-
regung unter der Künstlerschaft Münchens hervorriefen. Da
waren von ihm: das wandgrosse Bild mit der Hirschjagd,
die Rast der Rehe am Waldbach, voll echten Naturempfin-
dens, eine von Erdduft erfüllte Heuernte, einige Seebilder,
sowie endlich das berühmte Bild der Steinklopfer, das so-
fort einen gewaltigen Kampf der Meinungen hervorrief. Die
jungen Münchener Künstler, die jahraus, jahrein an ihren
einzelnen, unnahbaren Stammtischen im Cafe Probst gesessen
hatten, ohne sich etwas zu sagen zu haben, fanden sich plötz-
lich in Feinde und Freunde geschieden vor diesem Bilde zu-
sammen: nun musste Farbe bekannt werden und der Einzelne
zeigen, wess Geistes Kind er sei.
Für oder wider Courbet, hiefs es da. Erklärten die einen
seine Bilder für Ausflüsse eines rohen, ideenlosen Naturalis-
mus von gröbster Ausführung, so erblickten andere in dem
Steinklopferbilde die Kühnheit und Vornehmheit eines Velas-
quez und bezeichneten es als eine künstlerische Offenbarung.
Unter den ersten, die entschieden und offen für Courbet
eintraten und ihn den Angriffen gegenüber verteidigten, war
Wilhelm Leibl, dem seine ehemaligen Mitschüler aus dem
Piloty'sehen Atelier alsbald den Beinamen „Courbet" an-
hängten, wodurch manche ergötzliche Reibereien entstanden.
Da aber Leibl als Maler hoch angesehen, als urwüchsiger
Mensch beliebt und als Herkules gefürchtet war, so lief alles
stets in Heiterkeit aus, und auch seine Anhänger wurden
dadurch schliefslich mehr belustigt, als dafs sie sich geärgert
hätten.
Gerade als dieser merkwürdige Streit um die Franzosen
seine volle Höhe erreicht hatte, erschien eines Tages Courbet
selbst als Gast Münchens — und es ward Ruhe. Allen, auch
den Gegnern, imponierte diese mächtige Gestalt, ein Maler-
feldherr vom Scheitel bis zur Sohle, dabei ein echter Mann
aus dem Volke. Fremdartig erschien auf den ersten Blick
seine Kleidung aus grauem Lodenstoff. Zwei wollene Decken,
durch einen Riemen um den breiten Körper zusammengehalten,
dazu derbe dicksohlige Marschierschuhe; das war das Arbeits-
gewand eines Malers, der viel im Freien lebt und einer
anderen Kleidung gar nicht bedarf. Schwer und ruhig schritt
C 241 B
31
ABEN auch manche spätere Ausstellungen
im Münchener Glaspalast diejenige von
i 86p an Glanz und Wirkung übertroffen,
so bildete doch keine ein so tief eingrei-
fendes Ereignis für die dortige Künstler-
Ischaft. Denn sie war die erste ausgeprägt
internationale Ausstellung auf deutschem
Boden; ihr Gesamtbild hat sich daher un-
auslöschlich dem Gedächtnis eingeprägt.
Besonders hatten damals die Franzo-
sen eine Anzahl ganz hervorragender Bil-
der eingesandt. Da waren Dores Schwarz-
waldlandschaften, die biblischen Landschaften von Corot,
Rousseaus kleine intime Landschaften, sowie Werke anderer
zu jener Zeit noch wenig bekannter Künstler zu sehen. Der
Gegensatz der Nationalitäten machte sich noch nicht so be-
merklich wie jetzt. Vor einem Bilde, welches später in den
Luxembourg kam, dem Leichnam Virginies am Meeresstrand,
einer höchst vornehmen Schöpfung von ergreifender Wirkung,
konnte ein bekannter Kunstschriftsteller noch mit echter
Entrüstung ausrufen: warum hat das kein Deutscher gemalt!
Diese Eigenschaft, dem deutschen Wesen verständlich zu
sein, besassen namentlich Courbets Bilder, die dadurch so-
wie durch die Grösse ihrer Auffassung eine mächtige Er-
regung unter der Künstlerschaft Münchens hervorriefen. Da
waren von ihm: das wandgrosse Bild mit der Hirschjagd,
die Rast der Rehe am Waldbach, voll echten Naturempfin-
dens, eine von Erdduft erfüllte Heuernte, einige Seebilder,
sowie endlich das berühmte Bild der Steinklopfer, das so-
fort einen gewaltigen Kampf der Meinungen hervorrief. Die
jungen Münchener Künstler, die jahraus, jahrein an ihren
einzelnen, unnahbaren Stammtischen im Cafe Probst gesessen
hatten, ohne sich etwas zu sagen zu haben, fanden sich plötz-
lich in Feinde und Freunde geschieden vor diesem Bilde zu-
sammen: nun musste Farbe bekannt werden und der Einzelne
zeigen, wess Geistes Kind er sei.
Für oder wider Courbet, hiefs es da. Erklärten die einen
seine Bilder für Ausflüsse eines rohen, ideenlosen Naturalis-
mus von gröbster Ausführung, so erblickten andere in dem
Steinklopferbilde die Kühnheit und Vornehmheit eines Velas-
quez und bezeichneten es als eine künstlerische Offenbarung.
Unter den ersten, die entschieden und offen für Courbet
eintraten und ihn den Angriffen gegenüber verteidigten, war
Wilhelm Leibl, dem seine ehemaligen Mitschüler aus dem
Piloty'sehen Atelier alsbald den Beinamen „Courbet" an-
hängten, wodurch manche ergötzliche Reibereien entstanden.
Da aber Leibl als Maler hoch angesehen, als urwüchsiger
Mensch beliebt und als Herkules gefürchtet war, so lief alles
stets in Heiterkeit aus, und auch seine Anhänger wurden
dadurch schliefslich mehr belustigt, als dafs sie sich geärgert
hätten.
Gerade als dieser merkwürdige Streit um die Franzosen
seine volle Höhe erreicht hatte, erschien eines Tages Courbet
selbst als Gast Münchens — und es ward Ruhe. Allen, auch
den Gegnern, imponierte diese mächtige Gestalt, ein Maler-
feldherr vom Scheitel bis zur Sohle, dabei ein echter Mann
aus dem Volke. Fremdartig erschien auf den ersten Blick
seine Kleidung aus grauem Lodenstoff. Zwei wollene Decken,
durch einen Riemen um den breiten Körper zusammengehalten,
dazu derbe dicksohlige Marschierschuhe; das war das Arbeits-
gewand eines Malers, der viel im Freien lebt und einer
anderen Kleidung gar nicht bedarf. Schwer und ruhig schritt
C 241 B
31