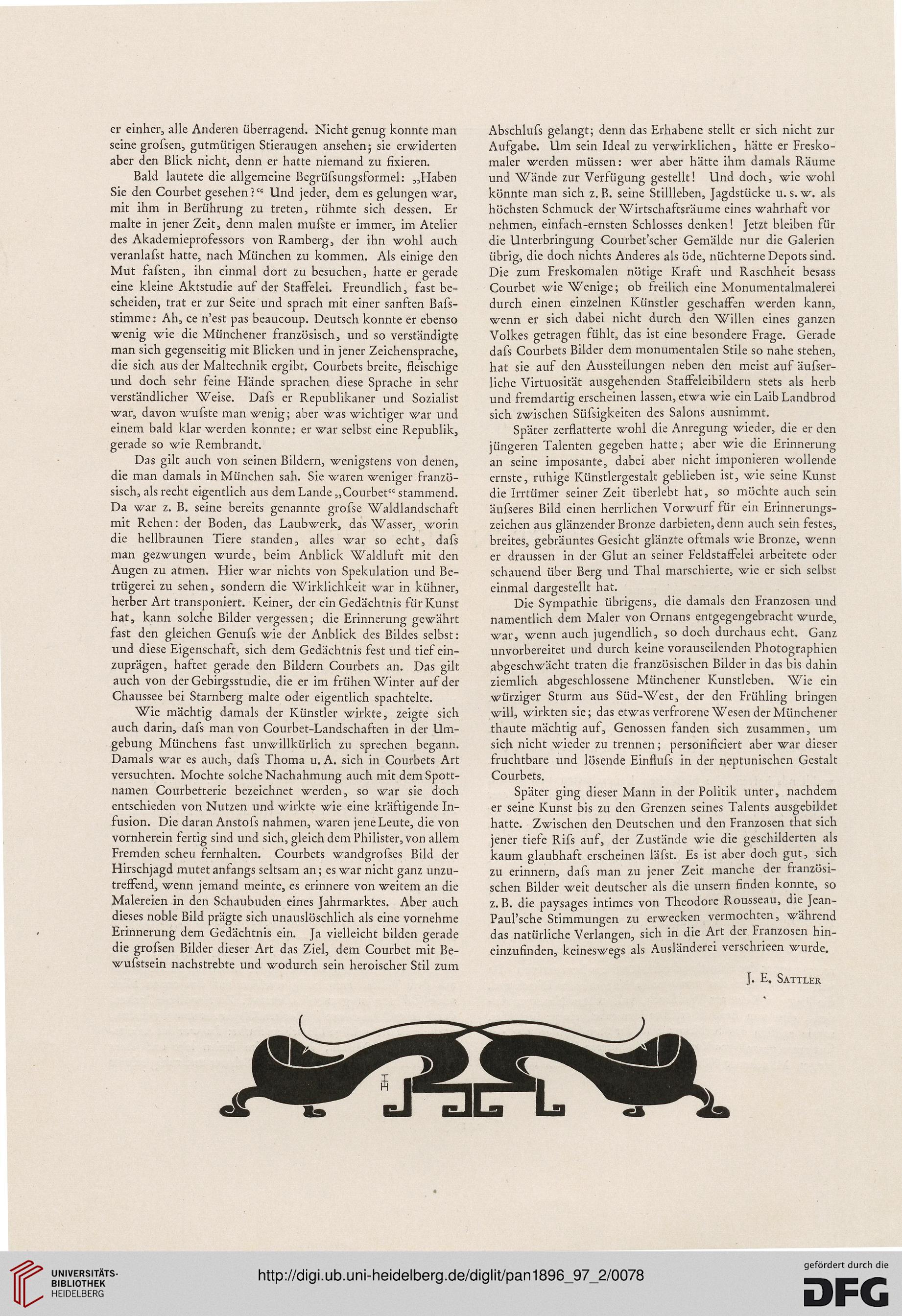er einher, alle Anderen überragend. Nicht genug konnte man
seine grofsen, gutmütigen Stieraugen ansehen; sie erwiderten
aber den Blick nicht, denn er hatte niemand zu fixieren.
Bald lautete die allgemeine Begrüfsungsformel: „Haben
Sie den Courbet gesehen?" Und jeder, dem es gelungen war,
mit ihm in Berührung zu treten, rühmte sich dessen. Er
malte in jener Zeit, denn malen mufste er immer, im Atelier
des Akademieprofessors von Ramberg, der ihn wohl auch
veranlafst hatte, nach München zu kommen. Als einige den
Mut fafsten, ihn einmal dort zu besuchen, hatte er gerade
eine kleine Aktstudie auf der Staffelei. Freundlich, fast be-
scheiden, trat er zur Seite und sprach mit einer sanften Bafs-
stimme: Ah, ce n'est pas beaucoup. Deutsch konnte er ebenso
wenig wie die Münchener französisch, und so verständigte
man sich gegenseitig mit Blicken und in jener Zeichensprache,
die sich aus der Maltechnik ergibt. Courbets breite, fleischige
und doch sehr feine Hände sprachen diese Sprache in sehr
verständlicher Weise. Dafs er Republikaner und Sozialist
war, davon wufste man wenig; aber was wichtiger war und
einem bald klar werden konnte: er war selbst eine Republik,
gerade so wie Rembrandt.
Das gilt auch von seinen Bildern, wenigstens von denen,
die man damals in München sah. Sie waren weniger franzö-
sisch, als recht eigentlich aus dem Lande „Courbet" stammend.
Da war z. B. seine bereits genannte grofse Waldlandschaft
mit Rehen: der Boden, das Laubwerk, das Wasser, worin
die hellbraunen Tiere standen, alles war so echt, dafs
man gezwungen wurde, beim Anblick Waldluft mit den
Augen zu atmen. Hier war nichts von Spekulation und Be-
trügerei zu sehen, sondern die Wirklichkeit war in kühner,
herber Art transponiert. Keiner, der ein Gedächtnis für Kunst
hat, kann solche Bilder vergessen; die Erinnerung gewährt
fast den gleichen Genufs wie der Anblick des Bildes selbst:
und diese Eigenschaft, sich dem Gedächtnis fest und tief ein-
zuprägen, haftet gerade den Bildern Courbets an. Das gilt
auch von der Gebirgsstudie, die er im frühen Winter auf der
Chaussee bei Starnberg malte oder eigentlich spachtelte.
Wie mächtig damals der Künstler wirkte, zeigte sich
auch darin, dafs man von Courbet-Landschaften in der Um-
gebung Münchens fast unwillkürlich zu sprechen begann.
Damals war es auch, dafs Thoma u. A. sich in Courbets Art
versuchten. Mochte solche Nachahmung auch mit dem Spott-
namen Courbetterie bezeichnet werden, so war sie doch
entschieden von Nutzen und wirkte wie eine kräftigende In-
fusion. Die daran Anstofs nahmen, waren jene Leute, die von
vornherein fertig sind und sich, gleich dem Philister, von allem
Fremden scheu fernhalten. Courbets wandgrofses Bild der
Hirschjagd mutet anfangs seltsam an; es war nicht ganz unzu-
treffend, wenn jemand meinte, es erinnere von weitem an die
Malereien in den Schaubuden eines Jahrmarktes. Aber auch
dieses noble Bild prägte sich unauslöschlich als eine vornehme
Erinnerung dem Gedächtnis ein. Ja vielleicht bilden gerade
die grofsen Bilder dieser Art das Ziel, dem Courbet mit Be-
wufstsein nachstrebte und wodurch sein heroischer Stil zum
Abschlufs gelangt; denn das Erhabene stellt er sich nicht zur
Aufgabe. Um sein Ideal zu verwirklichen, hätte er Fresko-
maler werden müssen: wer aber hätte ihm damals Räume
und Wände zur Verfügung gestellt! Und doch, wie wohl
könnte man sich z. B. seine Stillleben, Jagdstücke u. s. w. als
höchsten Schmuck derWirtschaftsräume eines wahrhaft vor
nehmen, einfach-ernsten Schlosses denken! Jetzt bleiben für
die Unterbringung Courbet'scher Gemälde nur die Galerien
übrig, die doch nichts Anderes als öde, nüchterne Depots sind.
Die zum Freskomalen nötige Kraft und Raschheit besass
Courbet wie Wenige; ob freilich eine Monumentalmalerei
durch einen einzelnen Künstler geschaffen werden kann,
wenn er sich dabei nicht durch den Willen eines ganzen
Volkes getragen fühlt, das ist eine besondere Frage. Gerade
dafs Courbets Bilder dem monumentalen Stile so nahe stehen,
hat sie auf den Ausstellungen neben den meist auf äufser-
liche Virtuosität ausgehenden Staffeleibildern stets als herb
und fremdartig erscheinen lassen, etwa wie ein Laib Landbrod
sich zwischen Süfsigkeiten des Salons ausnimmt.
Später zerflatterte wohl die Anregung wieder, die er den
jüngeren Talenten gegeben hatte; aber wie die Erinnerung
an seine imposante, dabei aber nicht imponieren wollende
ernste, ruhige Künstlergestalt geblieben ist, wie seine Kunst
die Irrtümer seiner Zeit überlebt hat, so möchte auch sein
äufseres Bild einen herrlichen Vorwurf für ein Erinnerungs-
zeichen aus glänzender Bronze darbieten, denn auch sein festes,
breites, gebräuntes Gesicht glänzte oftmals wie Bronze, wenn
er draussen in der Glut an seiner Feldstaffelei arbeitete oder
schauend über Berg und Thal marschierte, wie er sich selbst
einmal dargestellt hat.
Die Sympathie übrigens, die damals den Franzosen und
namentlich dem Maler von Omans entgegengebracht wurde,
war, wenn auch jugendlich, so doch durchaus echt. Ganz
unvorbereitet und durch keine vorauseilenden Photographien
abgeschwächt traten die französischen Bilder in das bis dahin
ziemlich abgeschlossene Münchener Kunstleben. Wie ein
würziger Sturm aus Süd-West, der den Frühling bringen
will, wirkten sie; das etwas verfrorene Wesen der Münchener
thaute mächtig auf, Genossen fanden sich zusammen, um
sich nicht wieder zu trennen; personificiert aber war dieser
fruchtbare und lösende Einflufs in der neptunischen Gestalt
Courbets.
Später ging dieser Mann in der Politik unter, nachdem
er seine Kunst bis zu den Grenzen seines Talents ausgebildet
hatte. Zwischen den Deutschen und den Franzosen that sich
jener tiefe Rifs auf, der Zustände wie die geschilderten als
kaum glaubhaft erscheinen läfst. Es ist aber doch gut, sich
zu erinnern, dafs man zu jener Zeit manche der französi-
schen Bilder weit deutscher als die unsern finden konnte, so
z. B. die paysages intimes von Theodore Rousseau, die Jean-
Paul'sche Stimmungen zu erwecken vermochten, während
das natürliche Verlangen, sich in die Art der Franzosen hin-
einzufinden, keineswegs als Ausländerei verschrieen wurde.
J. E. Sattler
seine grofsen, gutmütigen Stieraugen ansehen; sie erwiderten
aber den Blick nicht, denn er hatte niemand zu fixieren.
Bald lautete die allgemeine Begrüfsungsformel: „Haben
Sie den Courbet gesehen?" Und jeder, dem es gelungen war,
mit ihm in Berührung zu treten, rühmte sich dessen. Er
malte in jener Zeit, denn malen mufste er immer, im Atelier
des Akademieprofessors von Ramberg, der ihn wohl auch
veranlafst hatte, nach München zu kommen. Als einige den
Mut fafsten, ihn einmal dort zu besuchen, hatte er gerade
eine kleine Aktstudie auf der Staffelei. Freundlich, fast be-
scheiden, trat er zur Seite und sprach mit einer sanften Bafs-
stimme: Ah, ce n'est pas beaucoup. Deutsch konnte er ebenso
wenig wie die Münchener französisch, und so verständigte
man sich gegenseitig mit Blicken und in jener Zeichensprache,
die sich aus der Maltechnik ergibt. Courbets breite, fleischige
und doch sehr feine Hände sprachen diese Sprache in sehr
verständlicher Weise. Dafs er Republikaner und Sozialist
war, davon wufste man wenig; aber was wichtiger war und
einem bald klar werden konnte: er war selbst eine Republik,
gerade so wie Rembrandt.
Das gilt auch von seinen Bildern, wenigstens von denen,
die man damals in München sah. Sie waren weniger franzö-
sisch, als recht eigentlich aus dem Lande „Courbet" stammend.
Da war z. B. seine bereits genannte grofse Waldlandschaft
mit Rehen: der Boden, das Laubwerk, das Wasser, worin
die hellbraunen Tiere standen, alles war so echt, dafs
man gezwungen wurde, beim Anblick Waldluft mit den
Augen zu atmen. Hier war nichts von Spekulation und Be-
trügerei zu sehen, sondern die Wirklichkeit war in kühner,
herber Art transponiert. Keiner, der ein Gedächtnis für Kunst
hat, kann solche Bilder vergessen; die Erinnerung gewährt
fast den gleichen Genufs wie der Anblick des Bildes selbst:
und diese Eigenschaft, sich dem Gedächtnis fest und tief ein-
zuprägen, haftet gerade den Bildern Courbets an. Das gilt
auch von der Gebirgsstudie, die er im frühen Winter auf der
Chaussee bei Starnberg malte oder eigentlich spachtelte.
Wie mächtig damals der Künstler wirkte, zeigte sich
auch darin, dafs man von Courbet-Landschaften in der Um-
gebung Münchens fast unwillkürlich zu sprechen begann.
Damals war es auch, dafs Thoma u. A. sich in Courbets Art
versuchten. Mochte solche Nachahmung auch mit dem Spott-
namen Courbetterie bezeichnet werden, so war sie doch
entschieden von Nutzen und wirkte wie eine kräftigende In-
fusion. Die daran Anstofs nahmen, waren jene Leute, die von
vornherein fertig sind und sich, gleich dem Philister, von allem
Fremden scheu fernhalten. Courbets wandgrofses Bild der
Hirschjagd mutet anfangs seltsam an; es war nicht ganz unzu-
treffend, wenn jemand meinte, es erinnere von weitem an die
Malereien in den Schaubuden eines Jahrmarktes. Aber auch
dieses noble Bild prägte sich unauslöschlich als eine vornehme
Erinnerung dem Gedächtnis ein. Ja vielleicht bilden gerade
die grofsen Bilder dieser Art das Ziel, dem Courbet mit Be-
wufstsein nachstrebte und wodurch sein heroischer Stil zum
Abschlufs gelangt; denn das Erhabene stellt er sich nicht zur
Aufgabe. Um sein Ideal zu verwirklichen, hätte er Fresko-
maler werden müssen: wer aber hätte ihm damals Räume
und Wände zur Verfügung gestellt! Und doch, wie wohl
könnte man sich z. B. seine Stillleben, Jagdstücke u. s. w. als
höchsten Schmuck derWirtschaftsräume eines wahrhaft vor
nehmen, einfach-ernsten Schlosses denken! Jetzt bleiben für
die Unterbringung Courbet'scher Gemälde nur die Galerien
übrig, die doch nichts Anderes als öde, nüchterne Depots sind.
Die zum Freskomalen nötige Kraft und Raschheit besass
Courbet wie Wenige; ob freilich eine Monumentalmalerei
durch einen einzelnen Künstler geschaffen werden kann,
wenn er sich dabei nicht durch den Willen eines ganzen
Volkes getragen fühlt, das ist eine besondere Frage. Gerade
dafs Courbets Bilder dem monumentalen Stile so nahe stehen,
hat sie auf den Ausstellungen neben den meist auf äufser-
liche Virtuosität ausgehenden Staffeleibildern stets als herb
und fremdartig erscheinen lassen, etwa wie ein Laib Landbrod
sich zwischen Süfsigkeiten des Salons ausnimmt.
Später zerflatterte wohl die Anregung wieder, die er den
jüngeren Talenten gegeben hatte; aber wie die Erinnerung
an seine imposante, dabei aber nicht imponieren wollende
ernste, ruhige Künstlergestalt geblieben ist, wie seine Kunst
die Irrtümer seiner Zeit überlebt hat, so möchte auch sein
äufseres Bild einen herrlichen Vorwurf für ein Erinnerungs-
zeichen aus glänzender Bronze darbieten, denn auch sein festes,
breites, gebräuntes Gesicht glänzte oftmals wie Bronze, wenn
er draussen in der Glut an seiner Feldstaffelei arbeitete oder
schauend über Berg und Thal marschierte, wie er sich selbst
einmal dargestellt hat.
Die Sympathie übrigens, die damals den Franzosen und
namentlich dem Maler von Omans entgegengebracht wurde,
war, wenn auch jugendlich, so doch durchaus echt. Ganz
unvorbereitet und durch keine vorauseilenden Photographien
abgeschwächt traten die französischen Bilder in das bis dahin
ziemlich abgeschlossene Münchener Kunstleben. Wie ein
würziger Sturm aus Süd-West, der den Frühling bringen
will, wirkten sie; das etwas verfrorene Wesen der Münchener
thaute mächtig auf, Genossen fanden sich zusammen, um
sich nicht wieder zu trennen; personificiert aber war dieser
fruchtbare und lösende Einflufs in der neptunischen Gestalt
Courbets.
Später ging dieser Mann in der Politik unter, nachdem
er seine Kunst bis zu den Grenzen seines Talents ausgebildet
hatte. Zwischen den Deutschen und den Franzosen that sich
jener tiefe Rifs auf, der Zustände wie die geschilderten als
kaum glaubhaft erscheinen läfst. Es ist aber doch gut, sich
zu erinnern, dafs man zu jener Zeit manche der französi-
schen Bilder weit deutscher als die unsern finden konnte, so
z. B. die paysages intimes von Theodore Rousseau, die Jean-
Paul'sche Stimmungen zu erwecken vermochten, während
das natürliche Verlangen, sich in die Art der Franzosen hin-
einzufinden, keineswegs als Ausländerei verschrieen wurde.
J. E. Sattler