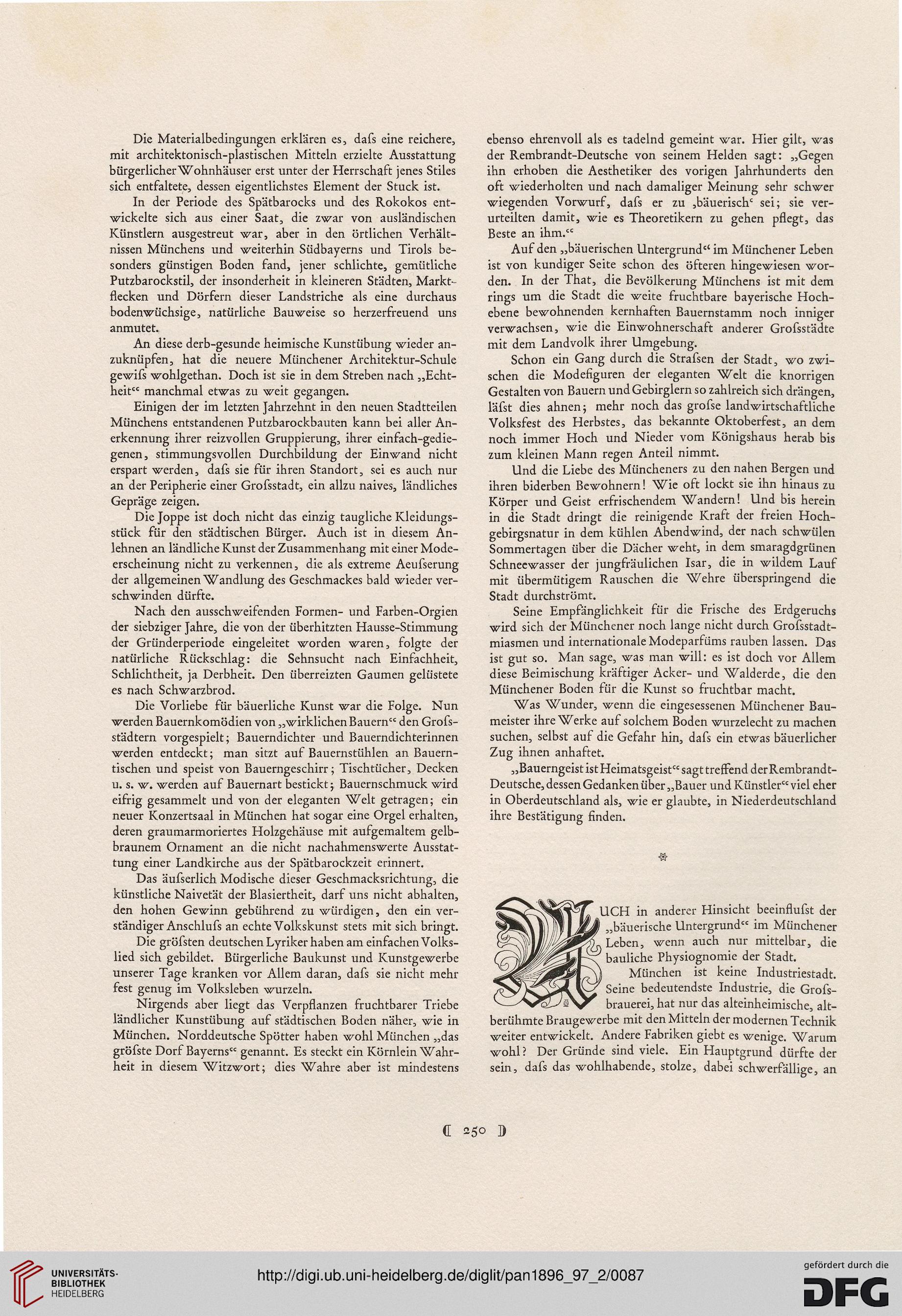Die Materialbedingungen erklären es, dafs eine reichere,
mit architektonisch-plastischen Mitteln erzielte Ausstattung
bürgerlicher "Wohnhäuser erst unter der Herrschaft jenes Stiles
sich entfaltete, dessen eigentlichstes Element der Stuck ist.
In der Periode des Spätbarocks und des Rokokos ent-
wickelte sich aus einer Saat, die zwar von ausländischen
Künstlern ausgestreut war, aber in den örtlichen Verhält-
nissen Münchens und weiterhin Südbayerns und Tirols be-
sonders günstigen Boden fand, jener schlichte, gemütliche
Putzbarockstil, der insonderheit in kleineren Städten, Markt-
flecken und Dörfern dieser Landstriche als eine durchaus
bodenwüchsige, natürliche Bauweise so herzerfreuend uns
anmutet.
An diese derb-gesunde heimische Kunstübung wieder an-
zuknüpfen, hat die neuere Münchener Architektur-Schule
gewifs wohlgethan. Doch ist sie in dem Streben nach „Echt-
heit" manchmal etwas zu weit gegangen.
Einigen der im letzten Jahrzehnt in den neuen Stadtteilen
Münchens entstandenen Putzbarockbauten kann bei aller An-
erkennung ihrer reizvollen Gruppierung, ihrer einfach-gedie-
genen, stimmungsvollen Durchbildung der Einwand nicht
erspart werden, dafs sie für ihren Standort, sei es auch nur
an der Peripherie einer Grofsstadt, ein allzu naives, ländliches
Gepräge zeigen.
Die Joppe ist doch nicht das einzig taugliche Kleidungs-
stück für den städtischen Bürger. Auch ist in diesem An-
lehnen an ländliche Kunst der Zusammenhang mit einer Mode-
erscheinung nicht zu verkennen, die als extreme Aeufserung
der allgemeinen "Wandlung des Geschmackes bald wieder ver-
schwinden dürfte.
Nach den ausschweifenden Formen- und Farben-Orgien
der siebziger Jahre, die von der überhitzten Hausse-Stimmung
der Gründerperiode eingeleitet worden waren, folgte der
natürliche Rückschlag: die Sehnsucht nach Einfachheit,
Schlichtheit, ja Derbheit. Den überreizten Gaumen gelüstete
es nach Schwarzbrod.
Die Vorliebe für bäuerliche Kunst war die Folge. Nun
werden Bauernkomödien von „wirklichen Bauern" den Grofs-
städtern vorgespielt; Bauerndichter und Bauerndichterinnen
werden entdeckt; man sitzt auf Bauernstühlen an Bauern-
tischen und speist von Bauerngeschirr; Tischtücher, Decken
u. s. w. werden auf Bauernart bestickt; Bauernschmuck wird
eifrig gesammelt und von der eleganten "Welt getragen; ein
neuer Konzertsaal in München hat sogar eine Orgel erhalten,
deren graumarmoriertes Holzgehäuse mit aufgemaltem gelb-
braunem Ornament an die nicht nachahmenswerte Ausstat-
tung einer Landkirche aus der Spätbarockzeit erinnert.
Das äufserlich Modische dieser Geschmacksrichtung, die
künstliche Naivetät der Blasiertheit, darf uns nicht abhalten,
den hohen Gewinn gebührend zu würdigen, den ein ver-
ständiger Anschlufs an echte Volkskunst stets mit sich bringt.
Die gröfsten deutschen Lyriker haben am einfachen Volks-
lied sich gebildet. Bürgerliche Baukunst und Kunstgewerbe
unserer Tage kranken vor Allem daran, dafs sie nicht mehr
fest genug im Volksleben wurzeln.
Nirgends aber liegt das Verpflanzen fruchtbarer Triebe
ländlicher Kunstübung auf städtischen Boden näher, wie in
München. Norddeutsche Spötter haben wohl München „das
gröfste Dorf Bayerns" genannt. Es steckt ein Körnlein Wahr-
heit in diesem Witzwort; dies Wahre aber ist mindestens
ebenso ehrenvoll als es tadelnd gemeint war. Hier gilt, was
der Rembrandt-Deutsche von seinem Helden sagt: „Gegen
ihn erhoben die Aesthetiker des vorigen Jahrhunderts den
oft wiederholten und nach damaliger Meinung sehr schwer
wiegenden Vorwurf, dafs er zu ,bäuerisch' sei; sie ver-
urteilten damit, wie es Theoretikern zu gehen pflegt, das
Beste an ihm."
Auf den „bäuerischen Untergrund«'im Münchener Leben
ist von kundiger Seite schon des öfteren hingewiesen wor-
den. In der That, die Bevölkerung Münchens ist mit dem
rings um die Stadt die weite fruchtbare bayerische Hoch-
ebene bewohnenden kernhaften Bauernstamm noch inniger
verwachsen, wie die Einwohnerschaft anderer Grofsstädte
mit dem Landvolk ihrer Umgebung.
Schon ein Gang durch die Strafsen der Stadt, wo zwi-
schen die Modefiguren der eleganten Welt die knorrigen
Gestalten von Bauern und Gebirglern so zahlreich sich drängen,
läfst dies ahnen; mehr noch das grofse landwirtschaftliche
Volksfest des Herbstes, das bekannte Oktoberfest, an dem
noch immer Hoch und Nieder vom Königshaus herab bis
zum kleinen Mann regen Anteil nimmt.
Und die Liebe des Müncheners zu den nahen Bergen und
ihren biderben Bewohnern! Wie oft lockt sie ihn hinaus zu
Körper und Geist erfrischendem Wandern! Und bis herein
in die Stadt dringt die reinigende Kraft der freien Hoch-
gebirgsnatur in dem kühlen Abendwind, der nach schwülen
Sommertagen über die Dächer weht, in dem smaragdgrünen
Schneewasser der jungfräulichen Isar, die in wildem Lauf
mit übermütigem Rauschen die Wehre überspringend die
Stadt durchströmt.
Seine Empfänglichkeit für die Frische des Erdgeruchs
wird sich der Münchener noch lange nicht durch Grofsstadt-
miasmen und internationale Modeparfüms rauben lassen. Das
ist gut so. Man sage, was man will: es ist doch vor Allem
diese Beimischung kräftiger Acker- und Walderde, die den
Münchener Boden für die Kunst so fruchtbar macht.
Was Wunder, wenn die eingesessenen Münchener Bau-
meister ihre Werke auf solchem Boden wurzelecht zu machen
suchen, selbst auf die Gefahr hin, dafs ein etwas bäuerlicher
Zug ihnen anhaftet.
„Bauerngeist ist Heimatsgeist" sagt treffend der Rembrandt-
Deutsche, dessen Gedanken über „Bauer und Künstler" viel eher
in Oberdeutschland als, wie er glaubte, in Niederdeutschland
ihre Bestätigung finden.
*
UCH in anderer Hinsicht beeinflufst der
„bäuerische Untergrund" im Münchener
Leben, wenn auch nur mittelbar, die
bauliche Physiognomie der Stadt.
München ist keine Industriestadt.
Seine bedeutendste Industrie, die Grofs-
brauerei, hat nur das alteinheimische, alt-
berühmte Braugewerbe mit den Mitteln der modernen Technik
weiter entwickelt. Andere Fabriken giebt es wenige. Warum
wohl ? Der Gründe sind viele. Ein Hauptgrund dürfte der
sein, dafs das wohlhabende, stolze, dabei schwerfällige, an
C 250 3
mit architektonisch-plastischen Mitteln erzielte Ausstattung
bürgerlicher "Wohnhäuser erst unter der Herrschaft jenes Stiles
sich entfaltete, dessen eigentlichstes Element der Stuck ist.
In der Periode des Spätbarocks und des Rokokos ent-
wickelte sich aus einer Saat, die zwar von ausländischen
Künstlern ausgestreut war, aber in den örtlichen Verhält-
nissen Münchens und weiterhin Südbayerns und Tirols be-
sonders günstigen Boden fand, jener schlichte, gemütliche
Putzbarockstil, der insonderheit in kleineren Städten, Markt-
flecken und Dörfern dieser Landstriche als eine durchaus
bodenwüchsige, natürliche Bauweise so herzerfreuend uns
anmutet.
An diese derb-gesunde heimische Kunstübung wieder an-
zuknüpfen, hat die neuere Münchener Architektur-Schule
gewifs wohlgethan. Doch ist sie in dem Streben nach „Echt-
heit" manchmal etwas zu weit gegangen.
Einigen der im letzten Jahrzehnt in den neuen Stadtteilen
Münchens entstandenen Putzbarockbauten kann bei aller An-
erkennung ihrer reizvollen Gruppierung, ihrer einfach-gedie-
genen, stimmungsvollen Durchbildung der Einwand nicht
erspart werden, dafs sie für ihren Standort, sei es auch nur
an der Peripherie einer Grofsstadt, ein allzu naives, ländliches
Gepräge zeigen.
Die Joppe ist doch nicht das einzig taugliche Kleidungs-
stück für den städtischen Bürger. Auch ist in diesem An-
lehnen an ländliche Kunst der Zusammenhang mit einer Mode-
erscheinung nicht zu verkennen, die als extreme Aeufserung
der allgemeinen "Wandlung des Geschmackes bald wieder ver-
schwinden dürfte.
Nach den ausschweifenden Formen- und Farben-Orgien
der siebziger Jahre, die von der überhitzten Hausse-Stimmung
der Gründerperiode eingeleitet worden waren, folgte der
natürliche Rückschlag: die Sehnsucht nach Einfachheit,
Schlichtheit, ja Derbheit. Den überreizten Gaumen gelüstete
es nach Schwarzbrod.
Die Vorliebe für bäuerliche Kunst war die Folge. Nun
werden Bauernkomödien von „wirklichen Bauern" den Grofs-
städtern vorgespielt; Bauerndichter und Bauerndichterinnen
werden entdeckt; man sitzt auf Bauernstühlen an Bauern-
tischen und speist von Bauerngeschirr; Tischtücher, Decken
u. s. w. werden auf Bauernart bestickt; Bauernschmuck wird
eifrig gesammelt und von der eleganten "Welt getragen; ein
neuer Konzertsaal in München hat sogar eine Orgel erhalten,
deren graumarmoriertes Holzgehäuse mit aufgemaltem gelb-
braunem Ornament an die nicht nachahmenswerte Ausstat-
tung einer Landkirche aus der Spätbarockzeit erinnert.
Das äufserlich Modische dieser Geschmacksrichtung, die
künstliche Naivetät der Blasiertheit, darf uns nicht abhalten,
den hohen Gewinn gebührend zu würdigen, den ein ver-
ständiger Anschlufs an echte Volkskunst stets mit sich bringt.
Die gröfsten deutschen Lyriker haben am einfachen Volks-
lied sich gebildet. Bürgerliche Baukunst und Kunstgewerbe
unserer Tage kranken vor Allem daran, dafs sie nicht mehr
fest genug im Volksleben wurzeln.
Nirgends aber liegt das Verpflanzen fruchtbarer Triebe
ländlicher Kunstübung auf städtischen Boden näher, wie in
München. Norddeutsche Spötter haben wohl München „das
gröfste Dorf Bayerns" genannt. Es steckt ein Körnlein Wahr-
heit in diesem Witzwort; dies Wahre aber ist mindestens
ebenso ehrenvoll als es tadelnd gemeint war. Hier gilt, was
der Rembrandt-Deutsche von seinem Helden sagt: „Gegen
ihn erhoben die Aesthetiker des vorigen Jahrhunderts den
oft wiederholten und nach damaliger Meinung sehr schwer
wiegenden Vorwurf, dafs er zu ,bäuerisch' sei; sie ver-
urteilten damit, wie es Theoretikern zu gehen pflegt, das
Beste an ihm."
Auf den „bäuerischen Untergrund«'im Münchener Leben
ist von kundiger Seite schon des öfteren hingewiesen wor-
den. In der That, die Bevölkerung Münchens ist mit dem
rings um die Stadt die weite fruchtbare bayerische Hoch-
ebene bewohnenden kernhaften Bauernstamm noch inniger
verwachsen, wie die Einwohnerschaft anderer Grofsstädte
mit dem Landvolk ihrer Umgebung.
Schon ein Gang durch die Strafsen der Stadt, wo zwi-
schen die Modefiguren der eleganten Welt die knorrigen
Gestalten von Bauern und Gebirglern so zahlreich sich drängen,
läfst dies ahnen; mehr noch das grofse landwirtschaftliche
Volksfest des Herbstes, das bekannte Oktoberfest, an dem
noch immer Hoch und Nieder vom Königshaus herab bis
zum kleinen Mann regen Anteil nimmt.
Und die Liebe des Müncheners zu den nahen Bergen und
ihren biderben Bewohnern! Wie oft lockt sie ihn hinaus zu
Körper und Geist erfrischendem Wandern! Und bis herein
in die Stadt dringt die reinigende Kraft der freien Hoch-
gebirgsnatur in dem kühlen Abendwind, der nach schwülen
Sommertagen über die Dächer weht, in dem smaragdgrünen
Schneewasser der jungfräulichen Isar, die in wildem Lauf
mit übermütigem Rauschen die Wehre überspringend die
Stadt durchströmt.
Seine Empfänglichkeit für die Frische des Erdgeruchs
wird sich der Münchener noch lange nicht durch Grofsstadt-
miasmen und internationale Modeparfüms rauben lassen. Das
ist gut so. Man sage, was man will: es ist doch vor Allem
diese Beimischung kräftiger Acker- und Walderde, die den
Münchener Boden für die Kunst so fruchtbar macht.
Was Wunder, wenn die eingesessenen Münchener Bau-
meister ihre Werke auf solchem Boden wurzelecht zu machen
suchen, selbst auf die Gefahr hin, dafs ein etwas bäuerlicher
Zug ihnen anhaftet.
„Bauerngeist ist Heimatsgeist" sagt treffend der Rembrandt-
Deutsche, dessen Gedanken über „Bauer und Künstler" viel eher
in Oberdeutschland als, wie er glaubte, in Niederdeutschland
ihre Bestätigung finden.
*
UCH in anderer Hinsicht beeinflufst der
„bäuerische Untergrund" im Münchener
Leben, wenn auch nur mittelbar, die
bauliche Physiognomie der Stadt.
München ist keine Industriestadt.
Seine bedeutendste Industrie, die Grofs-
brauerei, hat nur das alteinheimische, alt-
berühmte Braugewerbe mit den Mitteln der modernen Technik
weiter entwickelt. Andere Fabriken giebt es wenige. Warum
wohl ? Der Gründe sind viele. Ein Hauptgrund dürfte der
sein, dafs das wohlhabende, stolze, dabei schwerfällige, an
C 250 3