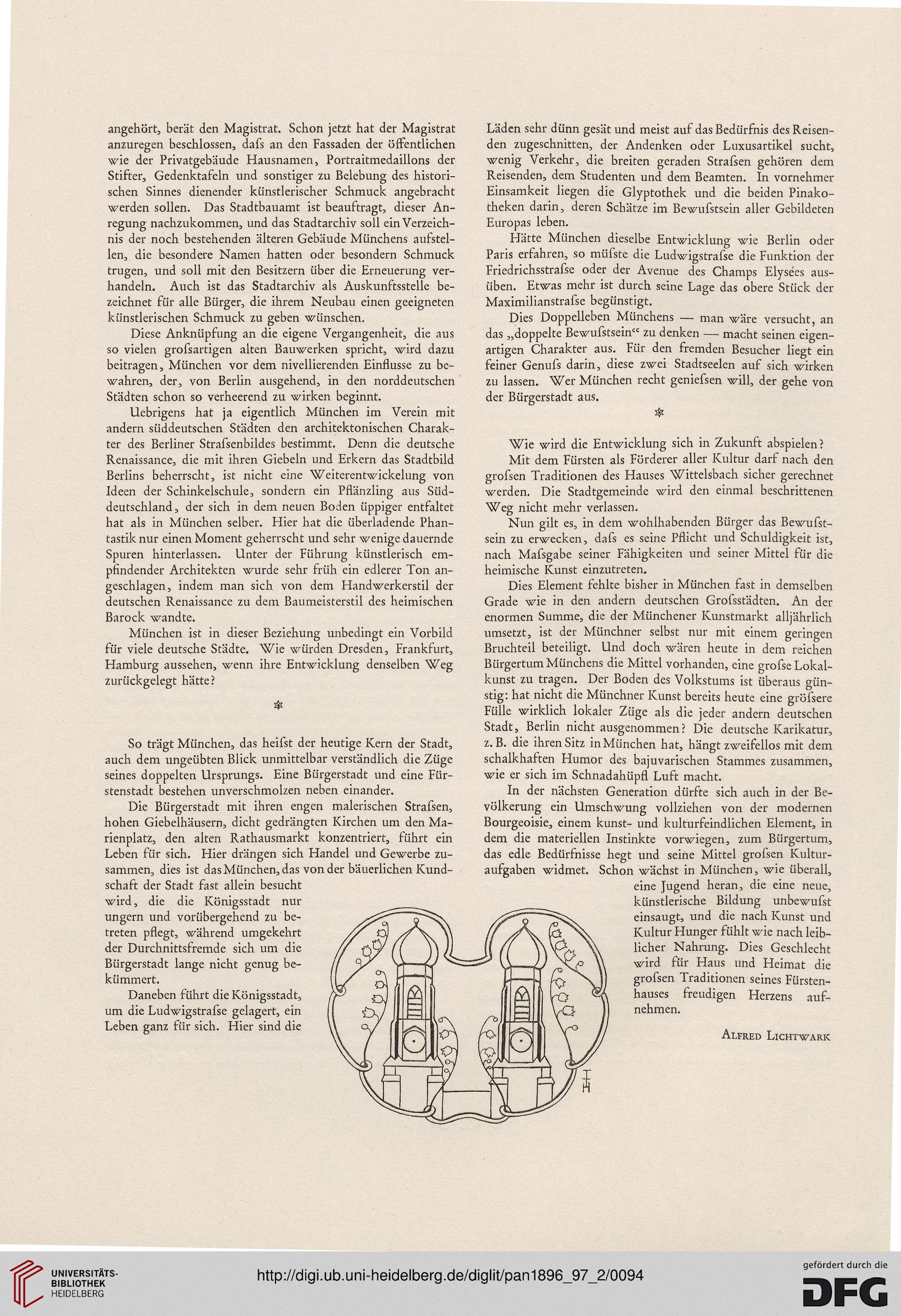angehört, berät den Magistrat. Schon jetzt hat der Magistrat
anzuregen beschlossen, dafs an den Fassaden der öffentlichen
wie der Privatgebäude Hausnamen, Portraitmedaillons der
Stifter, Gedenktafeln und sonstiger zu Belebung des histori-
schen Sinnes dienender künstlerischer Schmuck angebracht
werden sollen. Das Stadtbauamt ist beauftragt, dieser An-
regung nachzukommen, und das Stadtarchiv soll ein Verzeich-
nis der noch bestehenden älteren Gebäude Münchens aufstel-
len, die besondere Namen hatten oder besondern Schmuck
trugen, und soll mit den Besitzern über die Erneuerung ver-
handeln. Auch ist das Stadtarchiv als Auskunftsstelle be-
zeichnet für alle Bürger, die ihrem Neubau einen geeigneten
künstlerischen Schmuck zu geben wünschen.
Diese Anknüpfung an die eigene Vergangenheit, die aus
so vielen grofsartigen alten Bauwerken spricht, wird dazu
beitragen, München vor dem nivellierenden Einflüsse zu be-
wahren, der, von Berlin ausgehend, in den norddeutschen
Städten schon so verheerend zu wirken beginnt.
Uebrigens hat ja eigentlich München im Verein mit
andern süddeutschen Städten den architektonischen Charak-
ter des Berliner Strafsenbildes bestimmt. Denn die deutsche
Renaissance, die mit ihren Giebeln und Erkern das Stadtbild
Berlins beherrscht, ist nicht eine Weiterentwickelung von
Ideen der Schinkelschule, sondern ein Pflänzling aus Süd-
deutschland, der sich in dem neuen Boden üppiger entfaltet
hat als in München selber. Hier hat die überladende Phan-
tastik nur einen Moment geherrscht und sehr wenige dauernde
Spuren hinterlassen. Unter der Führung künstlerisch em-
pfindender Architekten wurde sehr früh ein edlerer Ton an-
geschlagen, indem man sich von dem Handwerkerstil der
deutschen Renaissance zu dem Baumeisterstil des heimischen
Barock wandte.
München ist in dieser Beziehung unbedingt ein Vorbild
für viele deutsche Städte. "Wie würden Dresden, Frankfurt,
Hamburg aussehen, wenn ihre Entwicklung denselben Weg
zurückgelegt hätte?
So trägt München, das heifst der heutige Kern der Stadt,
auch dem ungeübten Blick unmittelbar verständlich die Züge
seines doppelten Ursprungs. Eine Bürgerstadt und eine Für-
stenstadt bestehen unverschmolzen neben einander.
Die Bürgerstadt mit ihren engen malerischen Strafsen,
hohen Giebelhäusern, dicht gedrängten Kirchen um den Ma-
rienplatz, den alten Rathausmarkt konzentriert, führt ein
Leben für sich. Hier drängen sich Handel und Gewerbe zu-
sammen, dies ist das München, das von der bäuerlichen Kund-
schaft der Stadt fast allein besucht
wird, die die Königsstadt nur
ungern und vorübergehend zu be-
treten pflegt, während umgekehrt
der Durchnittsfremde sich um die
Bürgerstadt lange nicht genug be-
kümmert.
Daneben führt die Königsstadt,
um die Ludwigstrafse gelagert, ein
Leben ganz für sich. Hier sind die
Läden sehr dünn gesät und meist auf das Bedürfnis des Reisen-
den zugeschnitten, der Andenken oder Luxusartikel sucht,
wenig Verkehr, die breiten geraden Strafsen gehören dem
Reisenden, dem Studenten und dem Beamten. In vornehmer
Einsamkeit liegen die Glyptothek und die beiden Pinako-
theken darin, deren Schätze im Bewufstsein aller Gebildeten
Europas leben.
Hätte München dieselbe Entwicklung wie Berlin oder
Paris erfahren, so müfste die Ludwigstrafse die Funktion der
Friedrichsstrafse oder der Avenue des Champs Elysees aus-
üben. Etwas mehr ist durch seine Lage das obere Stück der
Maximilianstrafse begünstigt.
Dies Doppelleben Münchens — man wäre versucht, an
das „doppelte Bewufstsein" zu denken — macht seinen eigen-
artigen Charakter aus. Für den fremden Besucher liegt ein
feiner Genufs darin, diese zwei Stadtseelen auf sich wirken
zu lassen. Wer München recht geniefsen will, der gehe von
der Bürgerstadt aus.
Wie wird die Entwicklung sich in Zukunft abspielen ?
Mit dem Fürsten als Förderer aller Kultur darf nach den
grofsen Traditionen des Hauses Witteisbach sicher gerechnet
werden. Die Stadtgemeinde wird den einmal beschrittenen
Weg nicht mehr verlassen.
Nun gilt es, in dem wohlhabenden Bürger das Bewufst-
sein zu erwecken, dafs es seine Pflicht und Schuldigkeit ist,
nach Mafsgabe seiner Fähigkeiten und seiner Mittel für die
heimische Kunst einzutreten.
Dies Element fehlte bisher in München fast in demselben
Grade wie in den andern deutschen Grofsstädten. An der
enormen Summe, die der Münchener Kunstmarkt alljährlich
umsetzt, ist der Münchner selbst nur mit einem geringen
Bruchteil beteiligt. Und doch wären heute in dem reichen
Bürgertum Münchens die Mittel vorhanden, eine grofse Lokal-
kunst zu tragen. Der Boden des Volkstums ist überaus gün-
stig: hat nicht die Münchner Kunst bereits heute eine gröfsere
Fülle wirklich lokaler Züge als die jeder andern deutschen
Stadt, Berlin nicht ausgenommen? Die deutsche Karikatur,
z. B. die ihren Sitz in München hat, hängt zweifellos mit dem
schalkhaften Humor des bajuvarischen Stammes zusammen,
wie er sich im Schnadahüpfl Luft macht.
In der nächsten Generation dürfte sich auch in der Be-
völkerung ein Umschwung vollziehen von der modernen
Bourgeoisie, einem kunst- und kulturfeindlichen Element, in
dem die materiellen Instinkte vorwiegen, zum Bürgertum,
das edle Bedürfnisse hegt und seine Mittel grofsen Kultur-
aufgaben widmet. Schon wächst in München, wie überall,
eine Jugend heran, die eine neue,
künstlerische Bildung unbewufst
einsaugt, und die nach Kunst und
Kultur Hunger fühlt wie nach leib-
licher Nahrung. Dies Geschlecht
wird für Haus und Heimat die
grofsen Traditionen seines Fürsten-
hauses freudigen Herzens auf-
nehmen.
Alfred Lichtwark
anzuregen beschlossen, dafs an den Fassaden der öffentlichen
wie der Privatgebäude Hausnamen, Portraitmedaillons der
Stifter, Gedenktafeln und sonstiger zu Belebung des histori-
schen Sinnes dienender künstlerischer Schmuck angebracht
werden sollen. Das Stadtbauamt ist beauftragt, dieser An-
regung nachzukommen, und das Stadtarchiv soll ein Verzeich-
nis der noch bestehenden älteren Gebäude Münchens aufstel-
len, die besondere Namen hatten oder besondern Schmuck
trugen, und soll mit den Besitzern über die Erneuerung ver-
handeln. Auch ist das Stadtarchiv als Auskunftsstelle be-
zeichnet für alle Bürger, die ihrem Neubau einen geeigneten
künstlerischen Schmuck zu geben wünschen.
Diese Anknüpfung an die eigene Vergangenheit, die aus
so vielen grofsartigen alten Bauwerken spricht, wird dazu
beitragen, München vor dem nivellierenden Einflüsse zu be-
wahren, der, von Berlin ausgehend, in den norddeutschen
Städten schon so verheerend zu wirken beginnt.
Uebrigens hat ja eigentlich München im Verein mit
andern süddeutschen Städten den architektonischen Charak-
ter des Berliner Strafsenbildes bestimmt. Denn die deutsche
Renaissance, die mit ihren Giebeln und Erkern das Stadtbild
Berlins beherrscht, ist nicht eine Weiterentwickelung von
Ideen der Schinkelschule, sondern ein Pflänzling aus Süd-
deutschland, der sich in dem neuen Boden üppiger entfaltet
hat als in München selber. Hier hat die überladende Phan-
tastik nur einen Moment geherrscht und sehr wenige dauernde
Spuren hinterlassen. Unter der Führung künstlerisch em-
pfindender Architekten wurde sehr früh ein edlerer Ton an-
geschlagen, indem man sich von dem Handwerkerstil der
deutschen Renaissance zu dem Baumeisterstil des heimischen
Barock wandte.
München ist in dieser Beziehung unbedingt ein Vorbild
für viele deutsche Städte. "Wie würden Dresden, Frankfurt,
Hamburg aussehen, wenn ihre Entwicklung denselben Weg
zurückgelegt hätte?
So trägt München, das heifst der heutige Kern der Stadt,
auch dem ungeübten Blick unmittelbar verständlich die Züge
seines doppelten Ursprungs. Eine Bürgerstadt und eine Für-
stenstadt bestehen unverschmolzen neben einander.
Die Bürgerstadt mit ihren engen malerischen Strafsen,
hohen Giebelhäusern, dicht gedrängten Kirchen um den Ma-
rienplatz, den alten Rathausmarkt konzentriert, führt ein
Leben für sich. Hier drängen sich Handel und Gewerbe zu-
sammen, dies ist das München, das von der bäuerlichen Kund-
schaft der Stadt fast allein besucht
wird, die die Königsstadt nur
ungern und vorübergehend zu be-
treten pflegt, während umgekehrt
der Durchnittsfremde sich um die
Bürgerstadt lange nicht genug be-
kümmert.
Daneben führt die Königsstadt,
um die Ludwigstrafse gelagert, ein
Leben ganz für sich. Hier sind die
Läden sehr dünn gesät und meist auf das Bedürfnis des Reisen-
den zugeschnitten, der Andenken oder Luxusartikel sucht,
wenig Verkehr, die breiten geraden Strafsen gehören dem
Reisenden, dem Studenten und dem Beamten. In vornehmer
Einsamkeit liegen die Glyptothek und die beiden Pinako-
theken darin, deren Schätze im Bewufstsein aller Gebildeten
Europas leben.
Hätte München dieselbe Entwicklung wie Berlin oder
Paris erfahren, so müfste die Ludwigstrafse die Funktion der
Friedrichsstrafse oder der Avenue des Champs Elysees aus-
üben. Etwas mehr ist durch seine Lage das obere Stück der
Maximilianstrafse begünstigt.
Dies Doppelleben Münchens — man wäre versucht, an
das „doppelte Bewufstsein" zu denken — macht seinen eigen-
artigen Charakter aus. Für den fremden Besucher liegt ein
feiner Genufs darin, diese zwei Stadtseelen auf sich wirken
zu lassen. Wer München recht geniefsen will, der gehe von
der Bürgerstadt aus.
Wie wird die Entwicklung sich in Zukunft abspielen ?
Mit dem Fürsten als Förderer aller Kultur darf nach den
grofsen Traditionen des Hauses Witteisbach sicher gerechnet
werden. Die Stadtgemeinde wird den einmal beschrittenen
Weg nicht mehr verlassen.
Nun gilt es, in dem wohlhabenden Bürger das Bewufst-
sein zu erwecken, dafs es seine Pflicht und Schuldigkeit ist,
nach Mafsgabe seiner Fähigkeiten und seiner Mittel für die
heimische Kunst einzutreten.
Dies Element fehlte bisher in München fast in demselben
Grade wie in den andern deutschen Grofsstädten. An der
enormen Summe, die der Münchener Kunstmarkt alljährlich
umsetzt, ist der Münchner selbst nur mit einem geringen
Bruchteil beteiligt. Und doch wären heute in dem reichen
Bürgertum Münchens die Mittel vorhanden, eine grofse Lokal-
kunst zu tragen. Der Boden des Volkstums ist überaus gün-
stig: hat nicht die Münchner Kunst bereits heute eine gröfsere
Fülle wirklich lokaler Züge als die jeder andern deutschen
Stadt, Berlin nicht ausgenommen? Die deutsche Karikatur,
z. B. die ihren Sitz in München hat, hängt zweifellos mit dem
schalkhaften Humor des bajuvarischen Stammes zusammen,
wie er sich im Schnadahüpfl Luft macht.
In der nächsten Generation dürfte sich auch in der Be-
völkerung ein Umschwung vollziehen von der modernen
Bourgeoisie, einem kunst- und kulturfeindlichen Element, in
dem die materiellen Instinkte vorwiegen, zum Bürgertum,
das edle Bedürfnisse hegt und seine Mittel grofsen Kultur-
aufgaben widmet. Schon wächst in München, wie überall,
eine Jugend heran, die eine neue,
künstlerische Bildung unbewufst
einsaugt, und die nach Kunst und
Kultur Hunger fühlt wie nach leib-
licher Nahrung. Dies Geschlecht
wird für Haus und Heimat die
grofsen Traditionen seines Fürsten-
hauses freudigen Herzens auf-
nehmen.
Alfred Lichtwark