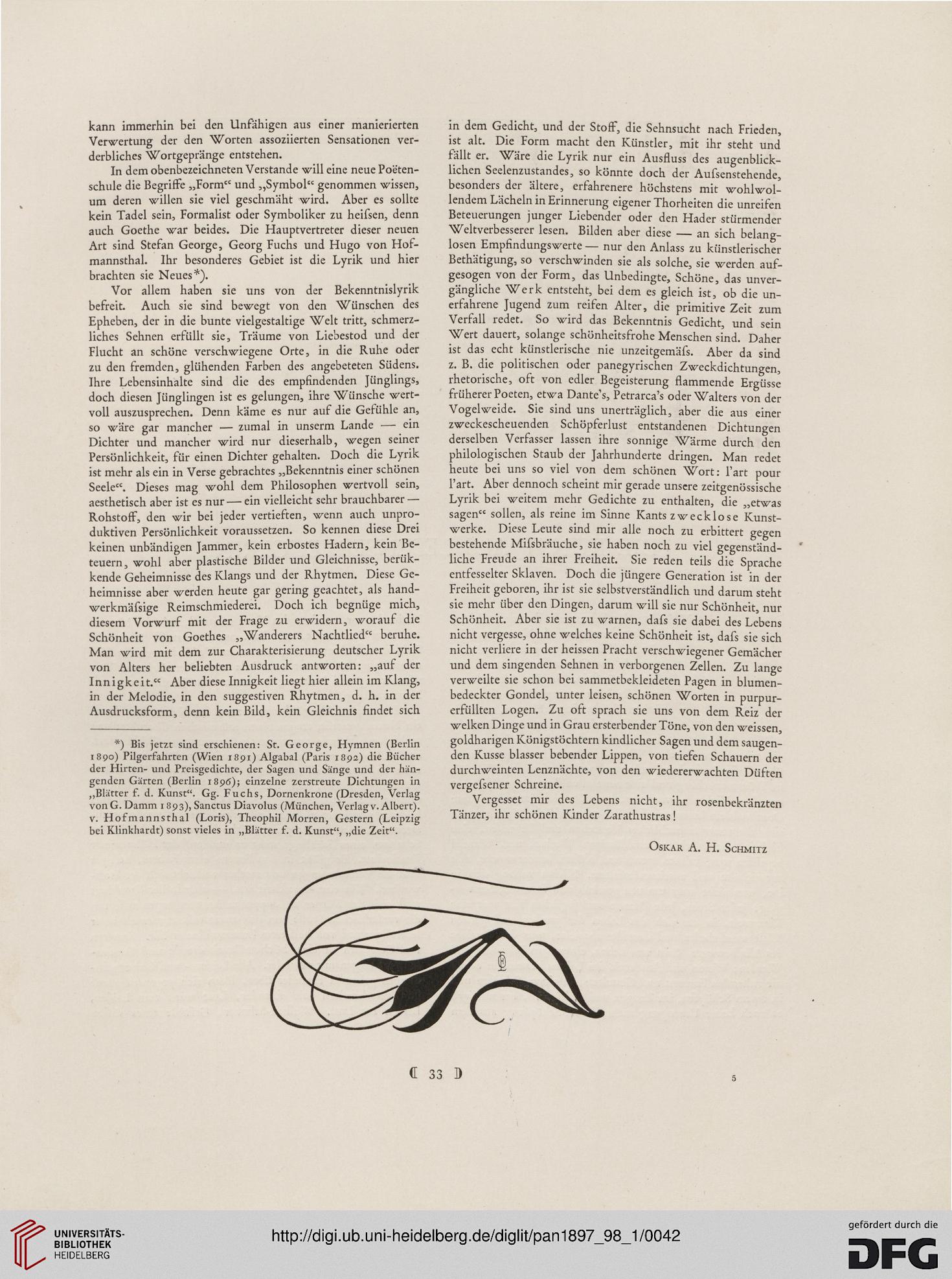kann immerhin bei den Unfähigen aus einer manierierten
Verwertung der den Worten assoziierten Sensationen ver-
derbliches Wortgepränge entstehen.
In dem obenbezeichneten Verstände will eine neue Poeten-
schule die Begriffe „Form" und ,,Symbol" genommen wissen,
um deren willen sie viel geschmäht wird. Aber es sollte
kein Tadel sein, Formalist oder Symboliker zu heifsen, denn
auch Goethe war beides. Die Hauptvertreter dieser neuen
Art sind Stefan George, Georg Fuchs und Hugo von Hof-
mannsthal. Ihr besonderes Gebiet ist die Lyrik und hier
brachten sie Neues*).
Vor allem haben sie uns von der Bekenntnislyrik
befreit. Auch sie sind bewegt von den Wünschen des
Epheben, der in die bunte vielgestaltige Welt tritt, schmerz-
liches Sehnen erfüllt sie, Träume von Liebestod und der
Flucht an schöne verschwiegene Orte, in die Ruhe oder
zu den fremden, glühenden Farben des angebeteten Südens.
Ihre Lebensinhalte sind die des empfindenden Jünglings,
doch diesen Jünglingen ist es gelungen, ihre Wünsche wert-
voll auszusprechen. Denn käme es nur auf die Gefühle an,
so wäre gar mancher — zumal in unserm Lande — ein
Dichter und mancher wird nur dieserhalb, wegen seiner
Persönlichkeit, für einen Dichter gehalten. Doch die Lyrik
ist mehr als ein in Verse gebrachtes „Bekenntnis einer schönen
Seele". Dieses mag wohl dem Philosophen wertvoll sein,
aesthetisch aber ist es nur — ein vielleicht sehr brauchbarer —
Rohstoff, den wir bei jeder vertieften, wenn auch unpro-
duktiven Persönlichkeit voraussetzen. So kennen diese Drei
keinen unbändigen Jammer, kein erbostes Hadern, kein Be-
teuern, wohl aber plastische Bilder und Gleichnisse, berük-
kende Geheimnisse des Klangs und der Rhytmen. Diese Ge-
heimnisse aber werden heute gar gering geachtet, als hand-
werkmäfsige Reimschmiederei. Doch ich begnüge mich,
diesem Vorwurf mit der Frage zu erwidern, worauf die
Schönheit von Goethes „Wanderers Nachtlied" beruhe.
Man wird mit dem zur Charakterisierung deutscher Lyrik
von Alters her beliebten Ausdruck antworten: „auf der
Innigkeit." Aber diese Innigkeit liegt hier allein im Klang,
in der Melodie, in den suggestiven Rhytmen, d. h. in der
Ausdrucksform, denn kein Bild, kein Gleichnis findet sich
*) Bis jetzt sind erschienen: St. George, Hymnen (Berlin
1890) Pilgerfahrten (Wien 1891) Algabal (Paris 1892) die Bücher
der Hirten- und Preisgedichte, der Sagen und Sänge und der hän-
genden Gärten (Berlin 1896); einzelne zerstreute Dichtungen in
„Blätter f. d. Kunst". Gg. Fuchs, Dornenkrone (Dresden, Verlag
vonG. Damm 1 893), Sanctus Diavolus (München, Verlagv. Albert).
v. Hofmannsthal (Loris), Theophil Morren, Gestern (Leipzig
bei Klinkhardt) sonst vieles in „Blätter f. d. Kunst", „die Zeit".
in dem Gedicht, und der Stoff, die Sehnsucht nach Frieden,
ist alt. Die Form macht den Künstler, mit ihr steht und
fällt er. Wäre die Lyrik nur ein Ausfluss des augenblick-
lichen Seelenzustandes, so könnte doch der Aufsenstehende,
besonders der ältere, erfahrenere höchstens mit wohlwol-
lendem Lächeln in Erinnerung eigener Thorheiten die unreifen
Beteuerungen junger Liebender oder den Hader stürmender
Weltverbesserer lesen. Bilden aber diese — an sich belang-
losen Empfindungswerte — nur den Anlass zu künstlerischer
Betätigung, so verschwinden sie als solche, sie werden auf-
gesogen von der Form, das Unbedingte, Schöne, das unver-
gängliche Werk entsteht, bei dem es gleich ist, ob die un-
erfahrene Jugend zum reifen Alter, die primitive Zeit zum
Verfall redet. So wird das Bekenntnis Gedicht, und sein
Wert dauert, solange schönheitsfrohe Menschen sind. Daher
ist das echt künstlerische nie unzeitgemäfs. Aber da sind
z. B. die politischen oder panegyrischen Zweckdichtungen,
rhetorische, oft von edler Begeisterung flammende Ergüsse
früherer Poeten, etwa Dante's, Petrarca's oder Walters von der
Vogel weide. Sie sind uns unerträglich, aber die aus einer
zweckescheuenden Schöpferlust entstandenen Dichtungen
derselben Verfasser lassen ihre sonnige Wärme durch den
philologischen Staub der Jahrhunderte dringen. Man redet
heute bei uns so viel von dem schönen Wort: l'art pour
l'art. Aber dennoch scheint mir gerade unsere zeitgenössische
Lyrik bei weitem mehr Gedichte zu enthalten, die „etwas
sagen" sollen, als reine im Sinne Kants zwecklose Kunst-
werke. Diese Leute sind mir alle noch zu erbittert gegen
bestehende Mifsbräuche, sie haben noch zu viel gegenständ-
liche Freude an ihrer Freiheit. Sie reden teils die Sprache
entfesselter Sklaven. Doch die jüngere Generation ist in der
Freiheit geboren, ihr ist sie selbstverständlich und darum steht
sie mehr über den Dingen, darum will sie nur Schönheit, nur
Schönheit. Aber sie ist zu warnen, dafs sie dabei des Lebens
nicht vergesse, ohne welches keine Schönheit ist, dafs sie sich
nicht verliere in der heissen Pracht verschwiegener Gemächer
und dem singenden Sehnen in verborgenen Zellen. Zu lange
verweilte sie schon bei sammetbekleideten Pagen in blumen-
bedeckter Gondel, unter leisen, schönen Worten in purpur-
erfüllten Logen. Zu oft sprach sie uns von dem Reiz der
welken Dinge und in Grau ersterbender Töne, von den weissen
goldharigen Königstöchtern kindlicher Sagen und dem saugen-
den Kusse blasser bebender Lippen, von tiefen Schauern der
durchweinten Lenznächte, von den wiedererwachten Düften
vergefsener Schreine.
Vergesset mir des Lebens nicht, ihr rosenbekränzten
Tänzer, ihr schönen Kinder Zarathustras!
Oskar A. H. Schmitz
C 33 3
Verwertung der den Worten assoziierten Sensationen ver-
derbliches Wortgepränge entstehen.
In dem obenbezeichneten Verstände will eine neue Poeten-
schule die Begriffe „Form" und ,,Symbol" genommen wissen,
um deren willen sie viel geschmäht wird. Aber es sollte
kein Tadel sein, Formalist oder Symboliker zu heifsen, denn
auch Goethe war beides. Die Hauptvertreter dieser neuen
Art sind Stefan George, Georg Fuchs und Hugo von Hof-
mannsthal. Ihr besonderes Gebiet ist die Lyrik und hier
brachten sie Neues*).
Vor allem haben sie uns von der Bekenntnislyrik
befreit. Auch sie sind bewegt von den Wünschen des
Epheben, der in die bunte vielgestaltige Welt tritt, schmerz-
liches Sehnen erfüllt sie, Träume von Liebestod und der
Flucht an schöne verschwiegene Orte, in die Ruhe oder
zu den fremden, glühenden Farben des angebeteten Südens.
Ihre Lebensinhalte sind die des empfindenden Jünglings,
doch diesen Jünglingen ist es gelungen, ihre Wünsche wert-
voll auszusprechen. Denn käme es nur auf die Gefühle an,
so wäre gar mancher — zumal in unserm Lande — ein
Dichter und mancher wird nur dieserhalb, wegen seiner
Persönlichkeit, für einen Dichter gehalten. Doch die Lyrik
ist mehr als ein in Verse gebrachtes „Bekenntnis einer schönen
Seele". Dieses mag wohl dem Philosophen wertvoll sein,
aesthetisch aber ist es nur — ein vielleicht sehr brauchbarer —
Rohstoff, den wir bei jeder vertieften, wenn auch unpro-
duktiven Persönlichkeit voraussetzen. So kennen diese Drei
keinen unbändigen Jammer, kein erbostes Hadern, kein Be-
teuern, wohl aber plastische Bilder und Gleichnisse, berük-
kende Geheimnisse des Klangs und der Rhytmen. Diese Ge-
heimnisse aber werden heute gar gering geachtet, als hand-
werkmäfsige Reimschmiederei. Doch ich begnüge mich,
diesem Vorwurf mit der Frage zu erwidern, worauf die
Schönheit von Goethes „Wanderers Nachtlied" beruhe.
Man wird mit dem zur Charakterisierung deutscher Lyrik
von Alters her beliebten Ausdruck antworten: „auf der
Innigkeit." Aber diese Innigkeit liegt hier allein im Klang,
in der Melodie, in den suggestiven Rhytmen, d. h. in der
Ausdrucksform, denn kein Bild, kein Gleichnis findet sich
*) Bis jetzt sind erschienen: St. George, Hymnen (Berlin
1890) Pilgerfahrten (Wien 1891) Algabal (Paris 1892) die Bücher
der Hirten- und Preisgedichte, der Sagen und Sänge und der hän-
genden Gärten (Berlin 1896); einzelne zerstreute Dichtungen in
„Blätter f. d. Kunst". Gg. Fuchs, Dornenkrone (Dresden, Verlag
vonG. Damm 1 893), Sanctus Diavolus (München, Verlagv. Albert).
v. Hofmannsthal (Loris), Theophil Morren, Gestern (Leipzig
bei Klinkhardt) sonst vieles in „Blätter f. d. Kunst", „die Zeit".
in dem Gedicht, und der Stoff, die Sehnsucht nach Frieden,
ist alt. Die Form macht den Künstler, mit ihr steht und
fällt er. Wäre die Lyrik nur ein Ausfluss des augenblick-
lichen Seelenzustandes, so könnte doch der Aufsenstehende,
besonders der ältere, erfahrenere höchstens mit wohlwol-
lendem Lächeln in Erinnerung eigener Thorheiten die unreifen
Beteuerungen junger Liebender oder den Hader stürmender
Weltverbesserer lesen. Bilden aber diese — an sich belang-
losen Empfindungswerte — nur den Anlass zu künstlerischer
Betätigung, so verschwinden sie als solche, sie werden auf-
gesogen von der Form, das Unbedingte, Schöne, das unver-
gängliche Werk entsteht, bei dem es gleich ist, ob die un-
erfahrene Jugend zum reifen Alter, die primitive Zeit zum
Verfall redet. So wird das Bekenntnis Gedicht, und sein
Wert dauert, solange schönheitsfrohe Menschen sind. Daher
ist das echt künstlerische nie unzeitgemäfs. Aber da sind
z. B. die politischen oder panegyrischen Zweckdichtungen,
rhetorische, oft von edler Begeisterung flammende Ergüsse
früherer Poeten, etwa Dante's, Petrarca's oder Walters von der
Vogel weide. Sie sind uns unerträglich, aber die aus einer
zweckescheuenden Schöpferlust entstandenen Dichtungen
derselben Verfasser lassen ihre sonnige Wärme durch den
philologischen Staub der Jahrhunderte dringen. Man redet
heute bei uns so viel von dem schönen Wort: l'art pour
l'art. Aber dennoch scheint mir gerade unsere zeitgenössische
Lyrik bei weitem mehr Gedichte zu enthalten, die „etwas
sagen" sollen, als reine im Sinne Kants zwecklose Kunst-
werke. Diese Leute sind mir alle noch zu erbittert gegen
bestehende Mifsbräuche, sie haben noch zu viel gegenständ-
liche Freude an ihrer Freiheit. Sie reden teils die Sprache
entfesselter Sklaven. Doch die jüngere Generation ist in der
Freiheit geboren, ihr ist sie selbstverständlich und darum steht
sie mehr über den Dingen, darum will sie nur Schönheit, nur
Schönheit. Aber sie ist zu warnen, dafs sie dabei des Lebens
nicht vergesse, ohne welches keine Schönheit ist, dafs sie sich
nicht verliere in der heissen Pracht verschwiegener Gemächer
und dem singenden Sehnen in verborgenen Zellen. Zu lange
verweilte sie schon bei sammetbekleideten Pagen in blumen-
bedeckter Gondel, unter leisen, schönen Worten in purpur-
erfüllten Logen. Zu oft sprach sie uns von dem Reiz der
welken Dinge und in Grau ersterbender Töne, von den weissen
goldharigen Königstöchtern kindlicher Sagen und dem saugen-
den Kusse blasser bebender Lippen, von tiefen Schauern der
durchweinten Lenznächte, von den wiedererwachten Düften
vergefsener Schreine.
Vergesset mir des Lebens nicht, ihr rosenbekränzten
Tänzer, ihr schönen Kinder Zarathustras!
Oskar A. H. Schmitz
C 33 3