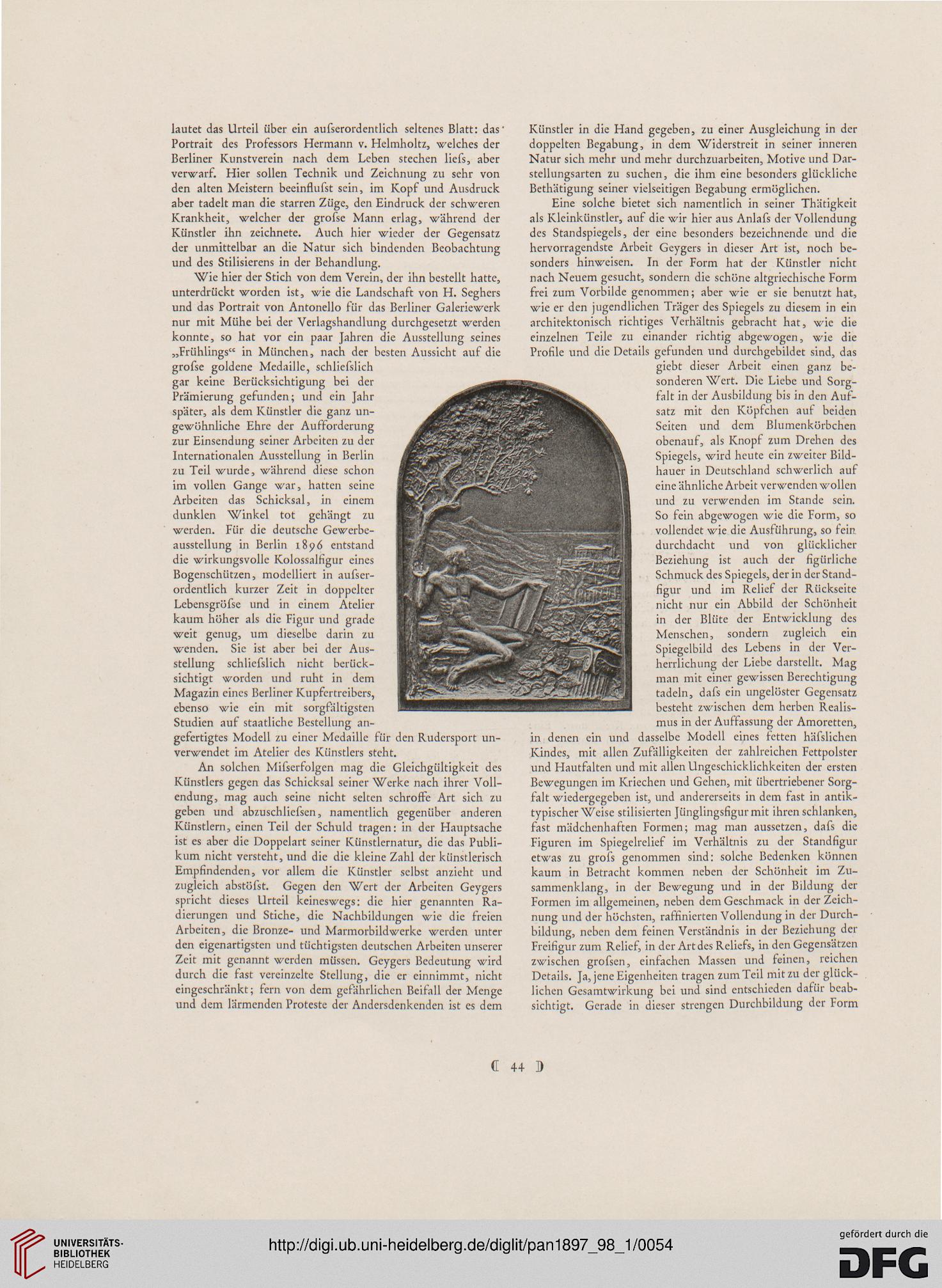lautet das Urteil über ein aufserordentlich seltenes Blatt: das
Portrait des Professors Hermann v. Helmholtz, welches der
Berliner Kunstverein nach dem Leben stechen liefs, aber
verwarf. Hier sollen Technik und Zeichnung zu sehr von
den alten Meistern beeinflufst sein, im Kopf und Ausdruck
aber tadelt man die starren Züge, den Eindruck der schweren
Krankheit, welcher der grofse Mann erlag, während der
Künstler ihn zeichnete. Auch hier wieder der Gegensatz
der unmittelbar an die Natur sich bindenden Beobachtung
und des Stilisierens in der Behandlung.
Wie hier der Stich von dem Verein, der ihn bestellt hatte,
unterdrückt worden ist, wie die Landschaft von H. Seghers
und das Portrait von Antonello für das Berliner Galeriewerk
nur mit Mühe bei der Verlagshandlung durchgesetzt werden
konnte, so hat vor ein paar Jahren die Ausstellung seines
„Frühlings" in München, nach der besten Aussicht auf die
grofse goldene Medaille, schliefslich
gar keine Berücksichtigung bei der
Prämierung gefunden; und ein Jahr
später, als dem Künstler die ganz un-
gewöhnliche Ehre der Aufforderung
zur Einsendung seiner Arbeiten zu der
Internationalen Ausstellung in Berlin
zu Teil wurde, während diese schon
im vollen Gange war, hatten seine
Arbeiten das Schicksal, in einem
dunklen Winkel tot gehängt zu
werden. Für die deutsche Gewerbe-
ausstellung in Berlin 1896 entstand
die wirkungsvolle Kolossalfigur eines
Bogenschützen, modelliert in aufser-
ordentlich kurzer Zeit in doppelter
Lebensgröfse und in einem Atelier
kaum höher als die Figur und grade
weit genug, um dieselbe darin zu
wenden. Sie ist aber bei der Aus-
stellung schliefslich nicht berück-
sichtigt worden und ruht in dem
Magazin eines Berliner Kupfertreibers,
ebenso wie ein mit sorgfältigsten
Studien auf staatliche Bestellung an-
gefertigtes Modell zu einer Medaille für den Rudersport un-
verwendet im Atelier des Künstlers steht.
An solchen Mifserfolgen mag die Gleichgültigkeit des
Künstlers gegen das Schicksal seiner Werke nach ihrer Voll-
endung, mag auch seine nicht selten schroffe Art sich zu
geben und abzuschliefsen, namentlich gegenüber anderen
Künstlern, einen Teil der Schuld tragen: in der Hauptsache
ist es aber die Doppelart seiner Künstlernatur, die das Publi-
kum nicht versteht, und die die kleine Zahl der künstlerisch
Empfindenden, vor allem die Künstler selbst anzieht und
zugleich abstufst. Gegen den Wert der Arbeiten Geygers
spricht dieses Urteil keineswegs: die hier genannten Ra-
dierungen und Stiche, die Nachbildungen wie die freien
Arbeiten, die Bronze- und Marmorbildwerke werden unter
den eigenartigsten und tüchtigsten deutschen Arbeiten unserer
Zeit mit genannt werden müssen. Geygers Bedeutung wird
durch die fast vereinzelte Stellung, die er einnimmt, nicht
eingeschränkt; fern von dem gefährlichen Beifall der Menge
und dem lärmenden Proteste der Andersdenkenden ist es dem
Künstler in die Hand gegeben, zu einer Ausgleichung in der
doppelten Begabung, in dem Widerstreit in seiner inneren
Natur sich mehr und mehr durchzuarbeiten, Motive und Dar-
stellungsarten zu suchen, die ihm eine besonders glückliche
Bethätigung seiner vielseitigen Begabung ermöglichen.
Eine solche bietet sich namentlich in seiner Thätigkeit
als Kleinkünstler, auf die wir hier aus Anlafs der Vollendung
des Standspiegels, der eine besonders bezeichnende und die
hervorragendste Arbeit Geygers in dieser Art ist, noch be-
sonders hinweisen. In der Form hat der Künstler nicht
nach Neuem gesucht, sondern die schöne altgriechische Form
frei zum Vorbilde genommen; aber wie er sie benutzt hat,
wie er den jugendlichen Träger des Spiegels zu diesem in ein
architektonisch richtiges Verhältnis gebracht hat, wie die
einzelnen Teile zu einander richtig abgewogen, wie die
Profile und die Details gefunden und durchgebildet sind, das
giebt dieser Arbeit einen ganz be-
sonderen Wert. Die Liebe und Sorg-
falt in der Ausbildung bis in den Auf-
satz mit den Köpfchen auf beiden
Seiten und dem Blumenkürbchen
obenauf, als Knopf zum Drehen des
Spiegels, wird heute ein zweiter Bild-
hauer in Deutschland schwerlich auf
eine ähnliche Arbeit verwenden wollen
und zu verwenden im Stande sein.
So fein abgewogen wie die Form, so
vollendet wie die Ausführung, so fein
durchdacht und von glücklicher
Beziehung ist auch der figürliche
Schmuck des Spiegels, der in der Stand-
figur und im Relief der Rückseite
nicht nur ein Abbild der Schönheit
in der Blüte der Entwicklung des
Menschen, sondern zugleich ein
Spiegelbild des Lebens in der Ver-
herrlichung der Liebe darstellt. Mag
man mit einer gewissen Berechtigung
tadeln, dafs ein ungelöster Gegensatz
besteht zwischen dem herben Realis-
mus in der Auffassung der Amoretten,
in denen ein und dasselbe Modell eines fetten häfslichen
Kindes, mit allen Zufälligkeiten der zahlreichen Fettpolster
und Hautfalten und mit allen Ungeschicklichkeiten der ersten
Bewegungen im Kriechen und Gehen, mit übertriebener Sorg-
falt wiedergegeben ist, und andererseits in dem fast in antik-
typischer Weise stilisierten Jünglingsfigur mit ihren schlanken,
fast mädchenhaften Formen; mag man aussetzen, dafs die
Figuren im Spiegelrelief im Verhältnis zu der Standfigur
etwas zu grofs genommen sind: solche Bedenken können
kaum in Betracht kommen neben der Schönheit im Zu-
sammenklang, in der Bewegung und in der Bildung der
Formen im allgemeinen, neben dem Geschmack in der Zeich-
nung und der höchsten, raffinierten Vollendung in der Durch-
bildung, neben dem feinen Verständnis in der Beziehung der
Freifigur zum Relief, in der Art des Reliefs, in den Gegensätzen
zwischen grofsen, einfachen Massen und feinen, reichen
Details. Ja, jene Eigenheiten tragen zum Teil mit zu der glück-
lichen Gesamtwirkung bei und sind entschieden dafür beab-
sichtigt. Gerade in dieser strengen Durchbildung der Form
C 44 3
Portrait des Professors Hermann v. Helmholtz, welches der
Berliner Kunstverein nach dem Leben stechen liefs, aber
verwarf. Hier sollen Technik und Zeichnung zu sehr von
den alten Meistern beeinflufst sein, im Kopf und Ausdruck
aber tadelt man die starren Züge, den Eindruck der schweren
Krankheit, welcher der grofse Mann erlag, während der
Künstler ihn zeichnete. Auch hier wieder der Gegensatz
der unmittelbar an die Natur sich bindenden Beobachtung
und des Stilisierens in der Behandlung.
Wie hier der Stich von dem Verein, der ihn bestellt hatte,
unterdrückt worden ist, wie die Landschaft von H. Seghers
und das Portrait von Antonello für das Berliner Galeriewerk
nur mit Mühe bei der Verlagshandlung durchgesetzt werden
konnte, so hat vor ein paar Jahren die Ausstellung seines
„Frühlings" in München, nach der besten Aussicht auf die
grofse goldene Medaille, schliefslich
gar keine Berücksichtigung bei der
Prämierung gefunden; und ein Jahr
später, als dem Künstler die ganz un-
gewöhnliche Ehre der Aufforderung
zur Einsendung seiner Arbeiten zu der
Internationalen Ausstellung in Berlin
zu Teil wurde, während diese schon
im vollen Gange war, hatten seine
Arbeiten das Schicksal, in einem
dunklen Winkel tot gehängt zu
werden. Für die deutsche Gewerbe-
ausstellung in Berlin 1896 entstand
die wirkungsvolle Kolossalfigur eines
Bogenschützen, modelliert in aufser-
ordentlich kurzer Zeit in doppelter
Lebensgröfse und in einem Atelier
kaum höher als die Figur und grade
weit genug, um dieselbe darin zu
wenden. Sie ist aber bei der Aus-
stellung schliefslich nicht berück-
sichtigt worden und ruht in dem
Magazin eines Berliner Kupfertreibers,
ebenso wie ein mit sorgfältigsten
Studien auf staatliche Bestellung an-
gefertigtes Modell zu einer Medaille für den Rudersport un-
verwendet im Atelier des Künstlers steht.
An solchen Mifserfolgen mag die Gleichgültigkeit des
Künstlers gegen das Schicksal seiner Werke nach ihrer Voll-
endung, mag auch seine nicht selten schroffe Art sich zu
geben und abzuschliefsen, namentlich gegenüber anderen
Künstlern, einen Teil der Schuld tragen: in der Hauptsache
ist es aber die Doppelart seiner Künstlernatur, die das Publi-
kum nicht versteht, und die die kleine Zahl der künstlerisch
Empfindenden, vor allem die Künstler selbst anzieht und
zugleich abstufst. Gegen den Wert der Arbeiten Geygers
spricht dieses Urteil keineswegs: die hier genannten Ra-
dierungen und Stiche, die Nachbildungen wie die freien
Arbeiten, die Bronze- und Marmorbildwerke werden unter
den eigenartigsten und tüchtigsten deutschen Arbeiten unserer
Zeit mit genannt werden müssen. Geygers Bedeutung wird
durch die fast vereinzelte Stellung, die er einnimmt, nicht
eingeschränkt; fern von dem gefährlichen Beifall der Menge
und dem lärmenden Proteste der Andersdenkenden ist es dem
Künstler in die Hand gegeben, zu einer Ausgleichung in der
doppelten Begabung, in dem Widerstreit in seiner inneren
Natur sich mehr und mehr durchzuarbeiten, Motive und Dar-
stellungsarten zu suchen, die ihm eine besonders glückliche
Bethätigung seiner vielseitigen Begabung ermöglichen.
Eine solche bietet sich namentlich in seiner Thätigkeit
als Kleinkünstler, auf die wir hier aus Anlafs der Vollendung
des Standspiegels, der eine besonders bezeichnende und die
hervorragendste Arbeit Geygers in dieser Art ist, noch be-
sonders hinweisen. In der Form hat der Künstler nicht
nach Neuem gesucht, sondern die schöne altgriechische Form
frei zum Vorbilde genommen; aber wie er sie benutzt hat,
wie er den jugendlichen Träger des Spiegels zu diesem in ein
architektonisch richtiges Verhältnis gebracht hat, wie die
einzelnen Teile zu einander richtig abgewogen, wie die
Profile und die Details gefunden und durchgebildet sind, das
giebt dieser Arbeit einen ganz be-
sonderen Wert. Die Liebe und Sorg-
falt in der Ausbildung bis in den Auf-
satz mit den Köpfchen auf beiden
Seiten und dem Blumenkürbchen
obenauf, als Knopf zum Drehen des
Spiegels, wird heute ein zweiter Bild-
hauer in Deutschland schwerlich auf
eine ähnliche Arbeit verwenden wollen
und zu verwenden im Stande sein.
So fein abgewogen wie die Form, so
vollendet wie die Ausführung, so fein
durchdacht und von glücklicher
Beziehung ist auch der figürliche
Schmuck des Spiegels, der in der Stand-
figur und im Relief der Rückseite
nicht nur ein Abbild der Schönheit
in der Blüte der Entwicklung des
Menschen, sondern zugleich ein
Spiegelbild des Lebens in der Ver-
herrlichung der Liebe darstellt. Mag
man mit einer gewissen Berechtigung
tadeln, dafs ein ungelöster Gegensatz
besteht zwischen dem herben Realis-
mus in der Auffassung der Amoretten,
in denen ein und dasselbe Modell eines fetten häfslichen
Kindes, mit allen Zufälligkeiten der zahlreichen Fettpolster
und Hautfalten und mit allen Ungeschicklichkeiten der ersten
Bewegungen im Kriechen und Gehen, mit übertriebener Sorg-
falt wiedergegeben ist, und andererseits in dem fast in antik-
typischer Weise stilisierten Jünglingsfigur mit ihren schlanken,
fast mädchenhaften Formen; mag man aussetzen, dafs die
Figuren im Spiegelrelief im Verhältnis zu der Standfigur
etwas zu grofs genommen sind: solche Bedenken können
kaum in Betracht kommen neben der Schönheit im Zu-
sammenklang, in der Bewegung und in der Bildung der
Formen im allgemeinen, neben dem Geschmack in der Zeich-
nung und der höchsten, raffinierten Vollendung in der Durch-
bildung, neben dem feinen Verständnis in der Beziehung der
Freifigur zum Relief, in der Art des Reliefs, in den Gegensätzen
zwischen grofsen, einfachen Massen und feinen, reichen
Details. Ja, jene Eigenheiten tragen zum Teil mit zu der glück-
lichen Gesamtwirkung bei und sind entschieden dafür beab-
sichtigt. Gerade in dieser strengen Durchbildung der Form
C 44 3