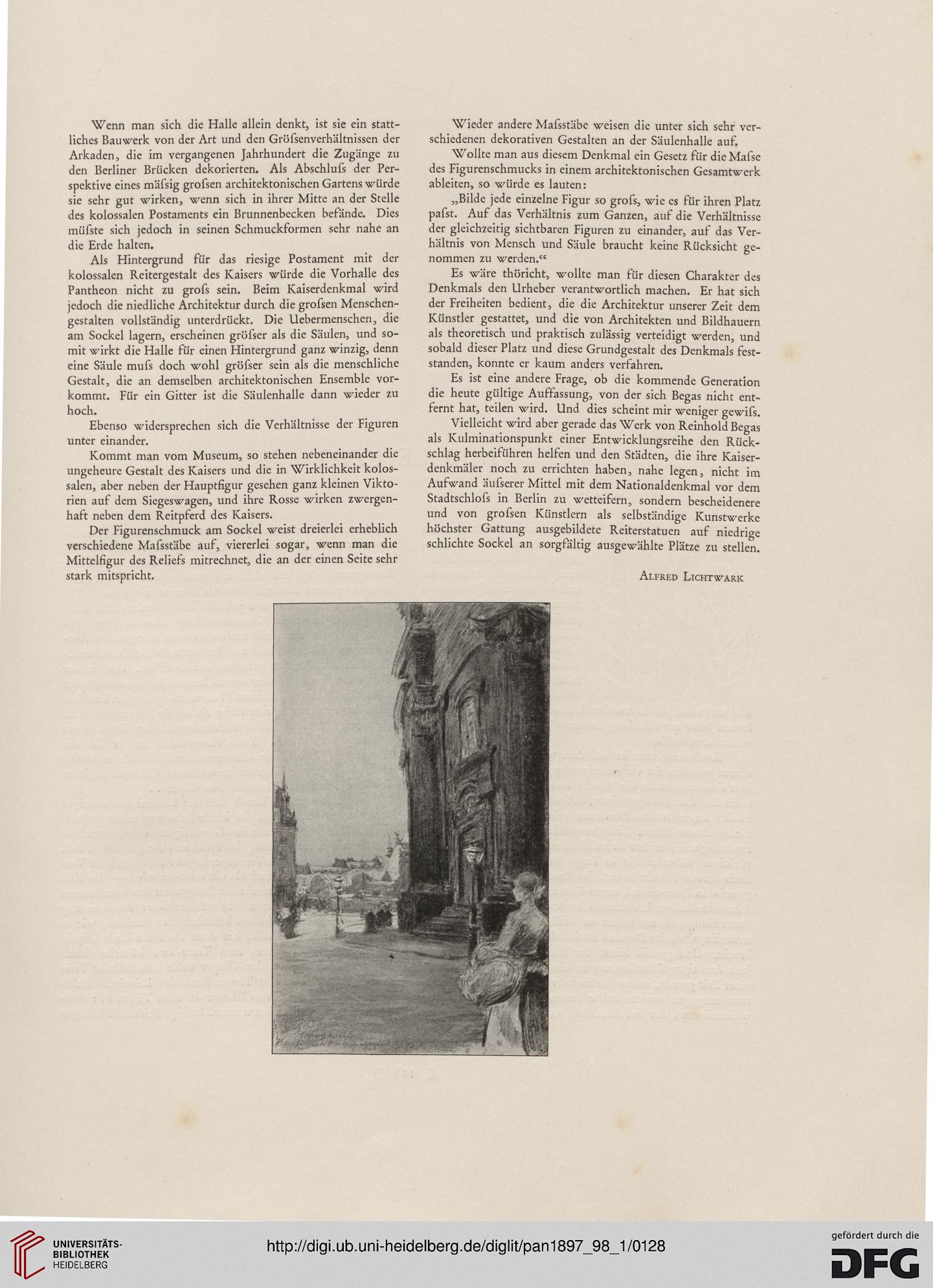Wenn man sich die Halle allein denkt, ist sie ein statt-
liches Bauwerk von der Art und den GröfsenVerhältnissen der
Arkaden, die im vergangenen Jahrhundert die Zugänge zu
den Berliner Brücken dekorierten. Als Abschlufs der Per-
spektive eines mäfsig grofsen architektonischen Gartens würde
sie sehr gut wirken, wenn sich in ihrer Mitte an der Stelle
des kolossalen Postaments ein Brunnenbecken befände. Dies
müfste sich jedoch in seinen Schmuckformen sehr nahe an
die Erde halten.
Als Hintergrund für das riesige Postament mit der
kolossalen Reitergestalt des Kaisers würde die Vorhalle des
Pantheon nicht zu grofs sein. Beim Kaiserdenkmal wird
jedoch die niedliche Architektur durch die grofsen Menschen-
gestalten vollständig unterdrückt. Die Uebermenschen, die
am Sockel lagern, erscheinen grofser als die Säulen, und so-
mit wirkt die Halle für einen Hintergrund ganz winzig, denn
eine Säule mufs doch wohl gröfser sein als die menschliche
Gestalt, die an demselben architektonischen Ensemble vor-
kommt. Für ein Gitter ist die Säulenhalle dann wieder zu
hoch.
Ebenso widersprechen sich die Verhältnisse der Figuren
unter einander.
Kommt man vom Museum, so stehen nebeneinander die
ungeheure Gestalt des Kaisers und die in Wirklichkeit kolos-
salen, aber neben der Hauptfigur gesehen ganz kleinen Vikto-
rien auf dem Siegeswagen, und ihre Rosse wirken zwergen-
haft neben dem Reitpferd des Kaisers.
Der Figurenschmuck am Sockel weist dreierlei erheblich
verschiedene Mafsstäbe auf, viererlei sogar, wenn man die
Mittelfigur des Reliefs mitrechnet, die an der einen Seite sehr
stark mitspricht.
Wieder andere Mafsstäbe weisen die unter sich sehr ver-
schiedenen dekorativen Gestalten an der Säulenhalle auf.
Wollte man aus diesem Denkmal ein Gesetz für die Mafse
des Figurenschmucks in einem architektonischen Gesamtwerk
ableiten, so würde es lauten:
„Bilde jede einzelne Figur so grofs, wie es für ihren Platz
pafst. Auf das Verhältnis zum Ganzen, auf die Verhältnisse
der gleichzeitig sichtbaren Figuren zu einander, auf das Ver-
hältnis von Mensch und Säule braucht keine Rücksicht ge-
nommen zu werden."
Es wäre thöricht, wollte man für diesen Charakter des
Denkmals den Urheber verantwortlich machen. Er hat sich
der Freiheiten bedient, die die Architektur unserer Zeit dem
Künstler gestattet, und die von Architekten und Bildhauern
als theoretisch und praktisch zulässig verteidigt werden, und
sobald dieser Platz und diese Grundgestalt des Denkmals fest-
standen, konnte er kaum anders verfahren.
Es ist eine andere Frage, ob die kommende Generation
die heute gültige Auffassung, von der sich Begas nicht ent-
fernt hat, teilen wird. Und dies scheint mir weniger gewifs.
Vielleicht wird aber gerade das Werk von Reinhold Begas
als Kulminationspunkt einer Entwicklungsreihe den Rück-
schlag herbeiführen helfen und den Städten, die ihre Kaiser-
denkmäler noch zu errichten haben, nahe legen, nicht im
Aufwand äufserer Mittel mit dem Nationaldenkmal vor dem
Stadtschlofs in Berlin zu wetteifern, sondern bescheidenere
und von grofsen Künstlern als selbständige Kunstwerke
höchster Gattung ausgebildete Reiterstatuen auf niedrige
schlichte Sockel an sorgfältig ausgewählte Plätze zu stellen.
Alfred Lichtwark
liches Bauwerk von der Art und den GröfsenVerhältnissen der
Arkaden, die im vergangenen Jahrhundert die Zugänge zu
den Berliner Brücken dekorierten. Als Abschlufs der Per-
spektive eines mäfsig grofsen architektonischen Gartens würde
sie sehr gut wirken, wenn sich in ihrer Mitte an der Stelle
des kolossalen Postaments ein Brunnenbecken befände. Dies
müfste sich jedoch in seinen Schmuckformen sehr nahe an
die Erde halten.
Als Hintergrund für das riesige Postament mit der
kolossalen Reitergestalt des Kaisers würde die Vorhalle des
Pantheon nicht zu grofs sein. Beim Kaiserdenkmal wird
jedoch die niedliche Architektur durch die grofsen Menschen-
gestalten vollständig unterdrückt. Die Uebermenschen, die
am Sockel lagern, erscheinen grofser als die Säulen, und so-
mit wirkt die Halle für einen Hintergrund ganz winzig, denn
eine Säule mufs doch wohl gröfser sein als die menschliche
Gestalt, die an demselben architektonischen Ensemble vor-
kommt. Für ein Gitter ist die Säulenhalle dann wieder zu
hoch.
Ebenso widersprechen sich die Verhältnisse der Figuren
unter einander.
Kommt man vom Museum, so stehen nebeneinander die
ungeheure Gestalt des Kaisers und die in Wirklichkeit kolos-
salen, aber neben der Hauptfigur gesehen ganz kleinen Vikto-
rien auf dem Siegeswagen, und ihre Rosse wirken zwergen-
haft neben dem Reitpferd des Kaisers.
Der Figurenschmuck am Sockel weist dreierlei erheblich
verschiedene Mafsstäbe auf, viererlei sogar, wenn man die
Mittelfigur des Reliefs mitrechnet, die an der einen Seite sehr
stark mitspricht.
Wieder andere Mafsstäbe weisen die unter sich sehr ver-
schiedenen dekorativen Gestalten an der Säulenhalle auf.
Wollte man aus diesem Denkmal ein Gesetz für die Mafse
des Figurenschmucks in einem architektonischen Gesamtwerk
ableiten, so würde es lauten:
„Bilde jede einzelne Figur so grofs, wie es für ihren Platz
pafst. Auf das Verhältnis zum Ganzen, auf die Verhältnisse
der gleichzeitig sichtbaren Figuren zu einander, auf das Ver-
hältnis von Mensch und Säule braucht keine Rücksicht ge-
nommen zu werden."
Es wäre thöricht, wollte man für diesen Charakter des
Denkmals den Urheber verantwortlich machen. Er hat sich
der Freiheiten bedient, die die Architektur unserer Zeit dem
Künstler gestattet, und die von Architekten und Bildhauern
als theoretisch und praktisch zulässig verteidigt werden, und
sobald dieser Platz und diese Grundgestalt des Denkmals fest-
standen, konnte er kaum anders verfahren.
Es ist eine andere Frage, ob die kommende Generation
die heute gültige Auffassung, von der sich Begas nicht ent-
fernt hat, teilen wird. Und dies scheint mir weniger gewifs.
Vielleicht wird aber gerade das Werk von Reinhold Begas
als Kulminationspunkt einer Entwicklungsreihe den Rück-
schlag herbeiführen helfen und den Städten, die ihre Kaiser-
denkmäler noch zu errichten haben, nahe legen, nicht im
Aufwand äufserer Mittel mit dem Nationaldenkmal vor dem
Stadtschlofs in Berlin zu wetteifern, sondern bescheidenere
und von grofsen Künstlern als selbständige Kunstwerke
höchster Gattung ausgebildete Reiterstatuen auf niedrige
schlichte Sockel an sorgfältig ausgewählte Plätze zu stellen.
Alfred Lichtwark