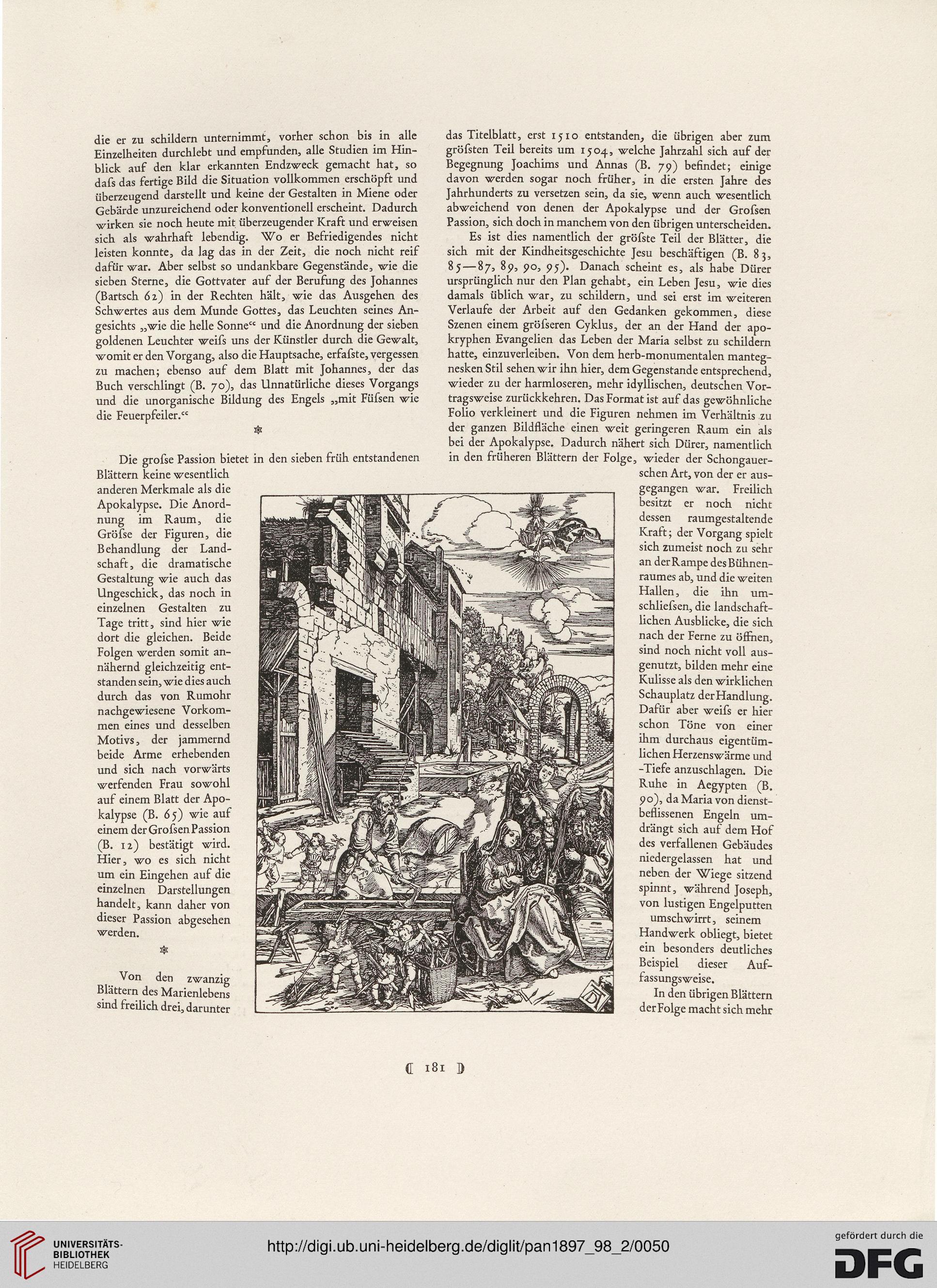die er zu schildern unternimmt, vorher schon bis in alle
Einzelheiten durchlebt und empfunden, alle Studien im Hin-
blick auf den klar erkannten Endzweck gemacht hat, so
dafs das fertige Bild die Situation vollkommen erschöpft und
überzeugend darstellt und keine der Gestalten in Miene oder
Gebärde unzureichend oder konventionell erscheint. Dadurch
wirken sie noch heute mit überzeugender Kraft und erweisen
sich als wahrhaft lebendig. Wo er Befriedigendes nicht
leisten konnte, da lag das in der Zeit, die noch nicht reif
dafür war. Aber selbst so undankbare Gegenstände, wie die
sieben Sterne, die Gottvater auf der Berufung des Johannes
(Bartsch 6z) in der Rechten hält, wie das Ausgehen des
Schwertes aus dem Munde Gottes, das Leuchten seines An-
gesichts „wie die helle Sonne" und die Anordnung der sieben
goldenen Leuchter weifs uns der Künstler durch die Gewalt,
womit er den Vorgang, also die Hauptsache, erfafste, vergessen
zu machen; ebenso auf dem Blatt mit Johannes, der das
Buch verschlingt (B. 70), das Unnatürliche dieses Vorgangs
und die unorganische Bildung des Engels „mit Füfsen wie
die Feuerpfeiler."
Die grofse Passion bietet in den sieben früh entstandenen
Blättern keine wesentlich
anderen Merkmale als die
Apokalypse. Die Anord-
nung im Raum, die
Gröfse der Figuren, die
Behandlung der Land-
schaft, die dramatische
Gestaltung wie auch das
Ungeschick, das noch in
einzelnen Gestalten zu
Tage tritt, sind hier wie
dort die gleichen. Beide
Folgen werden somit an-
nähernd gleichzeitig ent-
standen sein, wie dies auch
durch das von Rumohr
nachgewiesene Vorkom-
men eines und desselben
Motivs, der jammernd
beide Arme erhebenden
und sich nach vorwärts
werfenden Frau sowohl
auf einem Blatt der Apo-
kalypse (B. 65) wie auf
einem der Grofsen Passion
(B. 12) bestätigt wird.
Hier, wo es sich nicht
um ein Eingehen auf die
einzelnen Darstellungen
handelt, kann daher von
dieser Passion abgesehen
werden.
Von den
zwanzig
o
Blättern des Marienlebens
sind freilich drei, darunter
das Titelblatt, erst 1510 entstanden, die übrigen aber zum
gröfsten Teil bereits um 1504, welche Jahrzahl sich auf der
Begegnung Joachims und Annas (B. 79) befindet; einige
davon werden sogar noch früher, in die ersten Jahre des
Jahrhunderts zu versetzen sein, da sie, wenn auch wesentlich
abweichend von denen der Apokalypse und der Grofsen
Passion, sich doch in manchem von den übrigen unterscheiden.
Es ist dies namentlich der gröfste Teil der Blätter, die
sich mit der Kindheitsgeschichte Jesu beschäftigen (B. 83,
85—87, 8p, 00, 95). Danach scheint es, als habe Dürer
ursprünglich nur den Plan gehabt, ein Leben Jesu, wie dies
damals üblich war, zu schildern, und sei erst im weiteren
Verlaufe der Arbeit auf den Gedanken gekommen, diese
Szenen einem gröfseren Cyklus, der an der Hand der apo-
kryphen Evangelien das Leben der Maria selbst zu schildern
hatte, einzuverleiben. Von dem herb-monumentalen manteg-
nesken Stil sehen wir ihn hier, dem Gegenstande entsprechend,
wieder zu der harmloseren, mehr idyllischen, deutschen Vor-
tragsweise zurückkehren. Das Format ist auf das gewöhnliche
Folio verkleinert und die Figuren nehmen im Verhältnis zu
der ganzen Bildfläche einen weit geringeren Raum ein als
bei der Apokalypse. Dadurch nähert sich Dürer, namentlich
in den früheren Blättern der Folge, wieder der Schongauer-
schen Art, von der er aus-
gegangen war. Freilich
besitzt er noch nicht
dessen raumgestaltende
Kraft; der Vorgang spielt
sich zumeist noch zu sehr
an der Rampe des Bühnen-
raumes ab, und die weiten
Hallen, die ihn um-
schliefsen, die landschaft-
lichen Ausblicke, die sich
nach der Ferne zu öffnen,
sind noch nicht voll aus-
genutzt, bilden mehr eine
Kulisse als den wirklichen
Schauplatz der Handlung.
Dafür aber weifs er hier
schon Töne von einer
ihm durchaus eigentüm-
lichen Herzenswärme und
-Tiefe anzuschlagen. Die
Ruhe in Aegypten (B.
90), da Maria von dienst-
beflissenen Engeln um-
drängt sich auf dem Hof
des verfallenen Gebäudes
niedergelassen hat und
neben der Wiege sitzend
spinnt, während Joseph,
von lustigen Engelputten
umschwirrt, seinem
Handwerk obliegt, bietet
ein besonders deutliches
Beispiel dieser Auf-
fassungsweise.
In den übrigen Blättern
der Folge macht sich mehr
C 181 3
Einzelheiten durchlebt und empfunden, alle Studien im Hin-
blick auf den klar erkannten Endzweck gemacht hat, so
dafs das fertige Bild die Situation vollkommen erschöpft und
überzeugend darstellt und keine der Gestalten in Miene oder
Gebärde unzureichend oder konventionell erscheint. Dadurch
wirken sie noch heute mit überzeugender Kraft und erweisen
sich als wahrhaft lebendig. Wo er Befriedigendes nicht
leisten konnte, da lag das in der Zeit, die noch nicht reif
dafür war. Aber selbst so undankbare Gegenstände, wie die
sieben Sterne, die Gottvater auf der Berufung des Johannes
(Bartsch 6z) in der Rechten hält, wie das Ausgehen des
Schwertes aus dem Munde Gottes, das Leuchten seines An-
gesichts „wie die helle Sonne" und die Anordnung der sieben
goldenen Leuchter weifs uns der Künstler durch die Gewalt,
womit er den Vorgang, also die Hauptsache, erfafste, vergessen
zu machen; ebenso auf dem Blatt mit Johannes, der das
Buch verschlingt (B. 70), das Unnatürliche dieses Vorgangs
und die unorganische Bildung des Engels „mit Füfsen wie
die Feuerpfeiler."
Die grofse Passion bietet in den sieben früh entstandenen
Blättern keine wesentlich
anderen Merkmale als die
Apokalypse. Die Anord-
nung im Raum, die
Gröfse der Figuren, die
Behandlung der Land-
schaft, die dramatische
Gestaltung wie auch das
Ungeschick, das noch in
einzelnen Gestalten zu
Tage tritt, sind hier wie
dort die gleichen. Beide
Folgen werden somit an-
nähernd gleichzeitig ent-
standen sein, wie dies auch
durch das von Rumohr
nachgewiesene Vorkom-
men eines und desselben
Motivs, der jammernd
beide Arme erhebenden
und sich nach vorwärts
werfenden Frau sowohl
auf einem Blatt der Apo-
kalypse (B. 65) wie auf
einem der Grofsen Passion
(B. 12) bestätigt wird.
Hier, wo es sich nicht
um ein Eingehen auf die
einzelnen Darstellungen
handelt, kann daher von
dieser Passion abgesehen
werden.
Von den
zwanzig
o
Blättern des Marienlebens
sind freilich drei, darunter
das Titelblatt, erst 1510 entstanden, die übrigen aber zum
gröfsten Teil bereits um 1504, welche Jahrzahl sich auf der
Begegnung Joachims und Annas (B. 79) befindet; einige
davon werden sogar noch früher, in die ersten Jahre des
Jahrhunderts zu versetzen sein, da sie, wenn auch wesentlich
abweichend von denen der Apokalypse und der Grofsen
Passion, sich doch in manchem von den übrigen unterscheiden.
Es ist dies namentlich der gröfste Teil der Blätter, die
sich mit der Kindheitsgeschichte Jesu beschäftigen (B. 83,
85—87, 8p, 00, 95). Danach scheint es, als habe Dürer
ursprünglich nur den Plan gehabt, ein Leben Jesu, wie dies
damals üblich war, zu schildern, und sei erst im weiteren
Verlaufe der Arbeit auf den Gedanken gekommen, diese
Szenen einem gröfseren Cyklus, der an der Hand der apo-
kryphen Evangelien das Leben der Maria selbst zu schildern
hatte, einzuverleiben. Von dem herb-monumentalen manteg-
nesken Stil sehen wir ihn hier, dem Gegenstande entsprechend,
wieder zu der harmloseren, mehr idyllischen, deutschen Vor-
tragsweise zurückkehren. Das Format ist auf das gewöhnliche
Folio verkleinert und die Figuren nehmen im Verhältnis zu
der ganzen Bildfläche einen weit geringeren Raum ein als
bei der Apokalypse. Dadurch nähert sich Dürer, namentlich
in den früheren Blättern der Folge, wieder der Schongauer-
schen Art, von der er aus-
gegangen war. Freilich
besitzt er noch nicht
dessen raumgestaltende
Kraft; der Vorgang spielt
sich zumeist noch zu sehr
an der Rampe des Bühnen-
raumes ab, und die weiten
Hallen, die ihn um-
schliefsen, die landschaft-
lichen Ausblicke, die sich
nach der Ferne zu öffnen,
sind noch nicht voll aus-
genutzt, bilden mehr eine
Kulisse als den wirklichen
Schauplatz der Handlung.
Dafür aber weifs er hier
schon Töne von einer
ihm durchaus eigentüm-
lichen Herzenswärme und
-Tiefe anzuschlagen. Die
Ruhe in Aegypten (B.
90), da Maria von dienst-
beflissenen Engeln um-
drängt sich auf dem Hof
des verfallenen Gebäudes
niedergelassen hat und
neben der Wiege sitzend
spinnt, während Joseph,
von lustigen Engelputten
umschwirrt, seinem
Handwerk obliegt, bietet
ein besonders deutliches
Beispiel dieser Auf-
fassungsweise.
In den übrigen Blättern
der Folge macht sich mehr
C 181 3