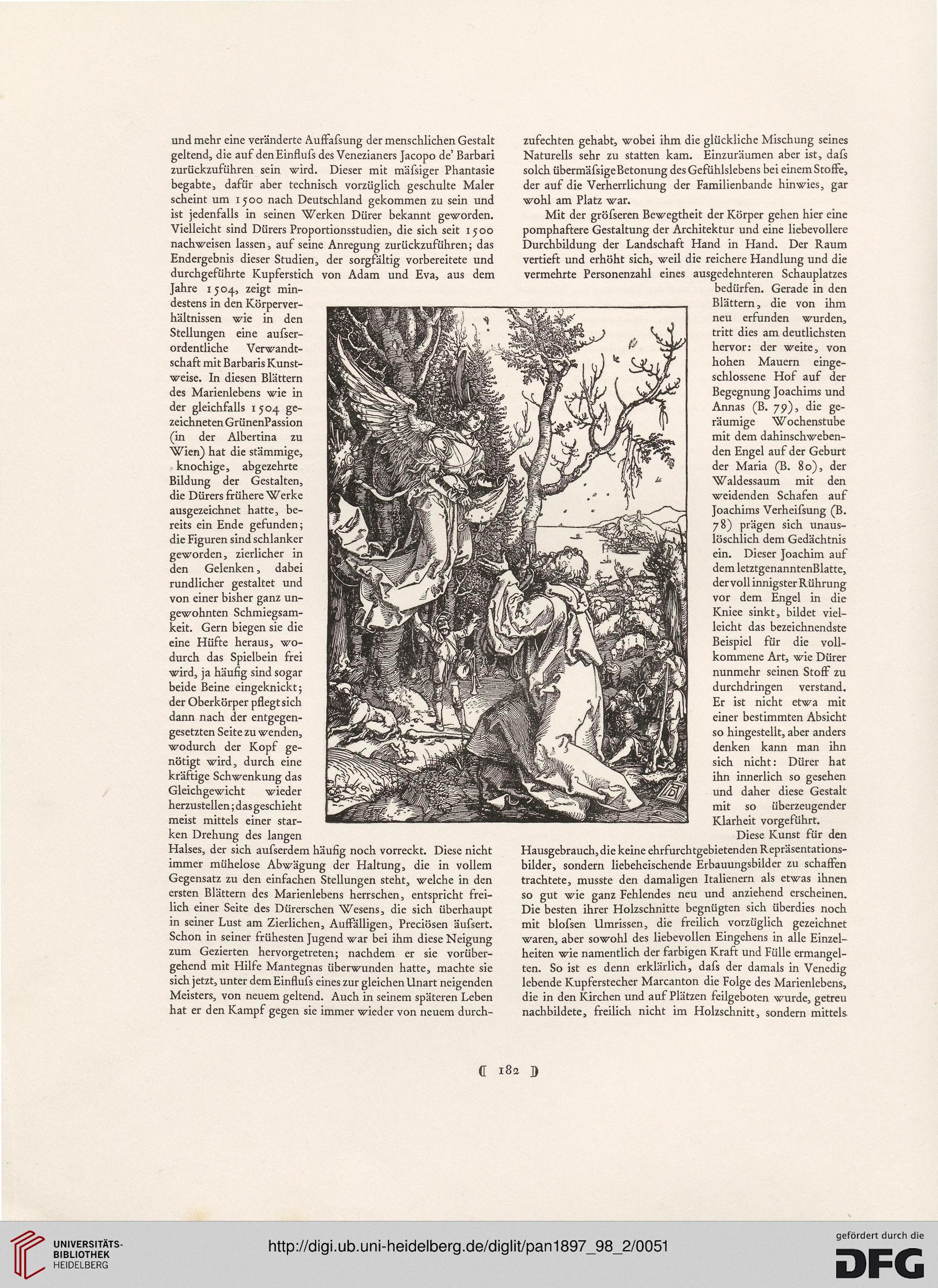und mehr eine veränderte Auffafsung der menschlichen Gestalt
geltend, die auf den Einflufs des Venezianers Jacopo de' Barbari
zurückzuführen sein wird. Dieser mit mäfsiger Phantasie
begabte, dafür aber technisch vorzüglich geschulte Maler
scheint um 1500 nach Deutschland gekommen zu sein und
ist jedenfalls in seinen Werken Dürer bekannt geworden.
Vielleicht sind Dürers Proportionsstudien, die sich seit 1500
nachweisen lassen, auf seine Anregung zurückzuführen; das
Endergebnis dieser Studien, der sorgfältig vorbereitete und
durchgeführte Kupferstich von Adam und Eva, aus dem
Jahre 1504, zeigt min-
destens in den Körperver-
hältnissen wie in den
Stellungen eine aufser-
ordentliche Verwandt-
schaft mit Barbaris Kunst-
weise. In diesen Blättern
des Marienlebens wie in
der gleichfalls 1 504 ge-
zeichneten GrünenPassion
(in der Albertina zu
Wien) hat die stämmige,
knochige, abgezehrte
Bildung der Gestalten,
die Dürers frühere Werke
ausgezeichnet hatte, be-
reits ein Ende gefunden;
die Figuren sind schlanker
geworden, zierlicher in
den Gelenken, dabei
rundlicher gestaltet und
von einer bisher ganz un-
gewohnten Schmiegsam-
keit. Gern biegen sie die
eine Hüfte heraus, wo-
durch das Spielbein frei
wird, ja häufig sind sogar
beide Beine eingeknickt;
der Oberkörper pflegt sich
dann nach der entgegen-
gesetzten Seite zu wenden,
wodurch der Kopf ge-
nötigt wird, durch eine
kräftige Schwenkung das
Gleichgewicht wieder
herzustellen; das geschieht
meist mittels einer star-
ken Drehung des langen
Halses, der sich aufserdem häufig noch vorreckt. Diese nicht
immer mühelose Abwägung der Haltung, die in vollem
Gegensatz zu den einfachen Stellungen steht, welche in den
ersten Blättern des Marienlebens herrschen, entspricht frei-
lich einer Seite des Dürerschen Wesens, die sich überhaupt
in seiner Lust am Zierlichen, Auffälligen, Preciösen äufsert.
Schon in seiner frühesten Jugend war bei ihm diese Neigung
zum Gezierten hervorgetreten; nachdem er sie vorüber-
gehend mit Hilfe Mantegnas überwunden hatte, machte sie
sich jetzt, unter dem Einflufs eines zur gleichen Unart neigenden
Meisters, von neuem geltend. Auch in seinem späteren Leben
hat er den Kampf gegen sie immer wieder von neuem durch-
zufechten gehabt, wobei ihm die glückliche Mischung seines
Naturells sehr zu statten kam. Einzuräumen aber ist, dafs
solch übermäfsigeBetonung des Gefühlslebens bei einem Stoffe,
der auf die Verherrlichung der Familienbande hinwies, gar
wohl am Platz war.
Mit der gröfseren Bewegtheit der Körper gehen hier eine
pomphaftere Gestaltung der Architektur und eine liebevollere
Durchbildung der Landschaft Hand in Hand. Der Raum
vertieft und erhöht sich, weil die reichere Handlung und die
vermehrte Personenzahl eines ausgedehnteren Schauplatzes
bedürfen. Gerade in den
Blättern, die von ihm
neu erfunden wurden,
tritt dies am deutlichsten
hervor: der weite, von
hohen Mauern einge-
schlossene Hof auf der
Begegnung Joachims und
Annas (B. 70), die ge-
räumige Wochenstube
mit dem dahinschweben-
den Engel auf der Geburt
der Maria (B. 80), der
Waldessaum mit den
weidenden Schafen auf
Joachims Verheifsung (B.
78) prägen sich unaus-
löschlich dem Gedächtnis
ein. Dieser Joachim auf
dem letztgenanntenBlatte,
der voll innigster Rührung
vor dem Engel in die
Kniee sinkt, bildet viel-
leicht das bezeichnendste
Beispiel für die voll-
kommene Art, wie Dürer
nunmehr seinen Stoff zu
durchdringen verstand.
Er ist nicht etwa mit
einer bestimmten Absicht
so hingestellt, aber anders
denken kann man ihn
sich nicht: Dürer hat
ihn innerlich so gesehen
und daher diese Gestalt
mit so überzeugender
Klarheit vorgeführt.
Diese Kunst für den
Hausgebrauch, die keine ehrfurchtgebietenden Repräsentations-
bilder, sondern liebeheischende Erbauungsbilder zu schaffen
trachtete, musste den damaligen Italienern als etwas ihnen
so gut wie ganz Fehlendes neu und anziehend erscheinen.
Die besten ihrer Holzschnitte begnügten sich überdies noch
mit blofsen Umrissen, die freilich vorzüglich gezeichnet
waren, aber sowohl des liebevollen Eingehens in alle Einzel-
heiten wie namentlich der farbigen Kraft und Fülle ermangel-
ten. So ist es denn erklärlich, dafs der damals in Venedig
lebende Kupferstecher Marcanton die Folge des Marienlebens,
die in den Kirchen und auf Plätzen feilgeboten wurde, getreu
nachbildete, freilich nicht im Holzschnitt, sondern mittels.
(T 182 3
geltend, die auf den Einflufs des Venezianers Jacopo de' Barbari
zurückzuführen sein wird. Dieser mit mäfsiger Phantasie
begabte, dafür aber technisch vorzüglich geschulte Maler
scheint um 1500 nach Deutschland gekommen zu sein und
ist jedenfalls in seinen Werken Dürer bekannt geworden.
Vielleicht sind Dürers Proportionsstudien, die sich seit 1500
nachweisen lassen, auf seine Anregung zurückzuführen; das
Endergebnis dieser Studien, der sorgfältig vorbereitete und
durchgeführte Kupferstich von Adam und Eva, aus dem
Jahre 1504, zeigt min-
destens in den Körperver-
hältnissen wie in den
Stellungen eine aufser-
ordentliche Verwandt-
schaft mit Barbaris Kunst-
weise. In diesen Blättern
des Marienlebens wie in
der gleichfalls 1 504 ge-
zeichneten GrünenPassion
(in der Albertina zu
Wien) hat die stämmige,
knochige, abgezehrte
Bildung der Gestalten,
die Dürers frühere Werke
ausgezeichnet hatte, be-
reits ein Ende gefunden;
die Figuren sind schlanker
geworden, zierlicher in
den Gelenken, dabei
rundlicher gestaltet und
von einer bisher ganz un-
gewohnten Schmiegsam-
keit. Gern biegen sie die
eine Hüfte heraus, wo-
durch das Spielbein frei
wird, ja häufig sind sogar
beide Beine eingeknickt;
der Oberkörper pflegt sich
dann nach der entgegen-
gesetzten Seite zu wenden,
wodurch der Kopf ge-
nötigt wird, durch eine
kräftige Schwenkung das
Gleichgewicht wieder
herzustellen; das geschieht
meist mittels einer star-
ken Drehung des langen
Halses, der sich aufserdem häufig noch vorreckt. Diese nicht
immer mühelose Abwägung der Haltung, die in vollem
Gegensatz zu den einfachen Stellungen steht, welche in den
ersten Blättern des Marienlebens herrschen, entspricht frei-
lich einer Seite des Dürerschen Wesens, die sich überhaupt
in seiner Lust am Zierlichen, Auffälligen, Preciösen äufsert.
Schon in seiner frühesten Jugend war bei ihm diese Neigung
zum Gezierten hervorgetreten; nachdem er sie vorüber-
gehend mit Hilfe Mantegnas überwunden hatte, machte sie
sich jetzt, unter dem Einflufs eines zur gleichen Unart neigenden
Meisters, von neuem geltend. Auch in seinem späteren Leben
hat er den Kampf gegen sie immer wieder von neuem durch-
zufechten gehabt, wobei ihm die glückliche Mischung seines
Naturells sehr zu statten kam. Einzuräumen aber ist, dafs
solch übermäfsigeBetonung des Gefühlslebens bei einem Stoffe,
der auf die Verherrlichung der Familienbande hinwies, gar
wohl am Platz war.
Mit der gröfseren Bewegtheit der Körper gehen hier eine
pomphaftere Gestaltung der Architektur und eine liebevollere
Durchbildung der Landschaft Hand in Hand. Der Raum
vertieft und erhöht sich, weil die reichere Handlung und die
vermehrte Personenzahl eines ausgedehnteren Schauplatzes
bedürfen. Gerade in den
Blättern, die von ihm
neu erfunden wurden,
tritt dies am deutlichsten
hervor: der weite, von
hohen Mauern einge-
schlossene Hof auf der
Begegnung Joachims und
Annas (B. 70), die ge-
räumige Wochenstube
mit dem dahinschweben-
den Engel auf der Geburt
der Maria (B. 80), der
Waldessaum mit den
weidenden Schafen auf
Joachims Verheifsung (B.
78) prägen sich unaus-
löschlich dem Gedächtnis
ein. Dieser Joachim auf
dem letztgenanntenBlatte,
der voll innigster Rührung
vor dem Engel in die
Kniee sinkt, bildet viel-
leicht das bezeichnendste
Beispiel für die voll-
kommene Art, wie Dürer
nunmehr seinen Stoff zu
durchdringen verstand.
Er ist nicht etwa mit
einer bestimmten Absicht
so hingestellt, aber anders
denken kann man ihn
sich nicht: Dürer hat
ihn innerlich so gesehen
und daher diese Gestalt
mit so überzeugender
Klarheit vorgeführt.
Diese Kunst für den
Hausgebrauch, die keine ehrfurchtgebietenden Repräsentations-
bilder, sondern liebeheischende Erbauungsbilder zu schaffen
trachtete, musste den damaligen Italienern als etwas ihnen
so gut wie ganz Fehlendes neu und anziehend erscheinen.
Die besten ihrer Holzschnitte begnügten sich überdies noch
mit blofsen Umrissen, die freilich vorzüglich gezeichnet
waren, aber sowohl des liebevollen Eingehens in alle Einzel-
heiten wie namentlich der farbigen Kraft und Fülle ermangel-
ten. So ist es denn erklärlich, dafs der damals in Venedig
lebende Kupferstecher Marcanton die Folge des Marienlebens,
die in den Kirchen und auf Plätzen feilgeboten wurde, getreu
nachbildete, freilich nicht im Holzschnitt, sondern mittels.
(T 182 3