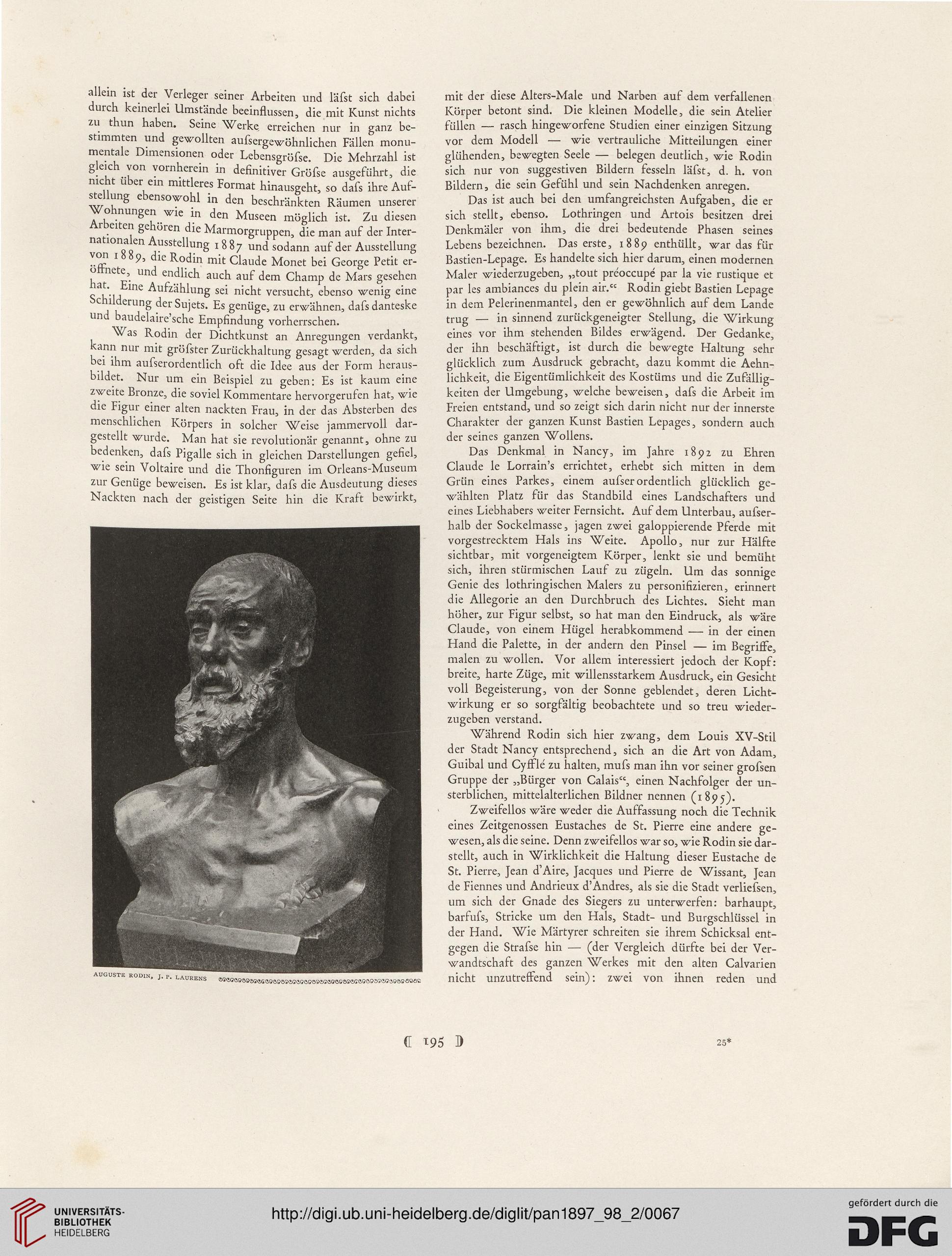allein ist der Verleger seiner Arbeiten und läfst sich dabei
durch keinerlei Umstände beeinflussen, die mit Kunst nichts
zu thun haben. Seine Werke, erreichen nur in ganz be-
stimmten und gewollten aufsergewöhnlichen Fällen monu-
mentale Dimensionen oder Lebensgröfse. Die Mehrzahl ist
gleich von vornherein in definitiver Gröfse ausgeführt, die
nicht über ein mittleres Format hinausgeht, so dafs ihre Auf-
stellung ebensowohl in den beschränkten Räumen unserer
Wohnungen wie in den Museen möglich ist. Zu diesen
Arbeiten gehören die Marmorgruppen, die man auf der Inter-
nationalen Ausstellung 1887 und sodann auf der Ausstellung
von 188p, die Rodin mit Claude Monet bei George Petit er-
öffnete, und endlich auch auf dem Champ de Mars gesehen
<sV'U nC ^u^zänuing sei n'eht versucht, ebenso wenig eine
Schilderung der Sujets. Es genüge, zu erwähnen, dafsdanteske
und baudelaire'sche Empfindung vorherrschen.
Was Rodin der Dichtkunst an Anregungen verdankt,
kann nur mit gröfster Zurückhaltung gesagt werden, da sich
bei ihm aufserordentlich oft die Idee aus der Form heraus-
bildet. Nur um ein Beispiel zu geben: Es ist kaum eine
zweite Bronze, die soviel Kommentare hervorgerufen hat, wie
die Figur einer alten nackten Frau, in der das Absterben des
menschlichen Körpers in solcher Weise jammervoll dar-
gestellt wurde. Man hat sie revolutionär genannt, ohne zu
bedenken, dafs Pigalle sich in gleichen Darstellungen gefiel,
wie sein Voltaire und die Thonfiguren im Orleans-Museum
zur Genüge beweisen. Es ist klar, dafs die Ausdeutung dieses
Nackten nach der geistigen Seite hin die Kraft bewirkt,
AUGUSTE RODIN, J. P. LAURENS
co<w'cG<^«<wac<i<rarc»e£ww*jff3«<w^
mit der diese Alters-Male und Narben auf dem verfallenen
Körper betont sind. Die kleinen Modelle, die sein Atelier
füllen — rasch hingeworfene Studien einer einzigen Sitzung
vor dem Modell — wie vertrauliche Mitteilungen einer
glühenden, bewegten Seele — belegen deutlich, wie Rodin
sich nur von suggestiven Bildern fesseln läfst, d. h. von
Bildern, die sein Gefühl und sein Nachdenken anregen.
Das ist auch bei den umfangreichsten Aufgaben, die er
sich stellt, ebenso. Lothringen und Artois besitzen drei
Denkmäler von ihm, die drei bedeutende Phasen seines
Lebens bezeichnen. Das erste, 188p enthüllt, war das für
Bastien-Lepage. Es handelte sich hier darum, einen modernen
Maler wiederzugeben, „tout preoccupe par la vie rustique et
par les ambiances du plein air." Rodin giebt Bastien Lepage
in dem Pelerinenmantel, den er gewöhnlich auf dem Lande
trug — in sinnend zurückgeneigter Stellung, die Wirkung
eines vor ihm stehenden Bildes erwägend. Der Gedanke,
der ihn beschäftigt, ist durch die bewegte Haltung sehr
glücklich zum Ausdruck gebracht, dazu kommt die Aehn-
lichkeit, die Eigentümlichkeit des Kostüms und die Zufällig-
keiten der Umgebung, welche beweisen, dafs die Arbeit im
Freien entstand, und so zeigt sich darin nicht nur der innerste
Charakter der ganzen Kunst Bastien Lepages, sondern auch
der seines ganzen Wollens.
Das Denkmal in Nancy, im Jahre i8p2 zu Ehren
Claude le Lorrain's errichtet, erhebt sich mitten in dem
Grün eines Parkes, einem aufserordentlich glücklich ge-
wählten Platz für das Standbild eines Landschafters und
eines Liebhabers weiter Fernsicht. Auf dem Unterbau, aufser-
halb der Sockelmasse, jagen zwei galoppierende Pferde mit
vorgestrecktem Hals ins Weite. Apollo, nur zur Hälfte
sichtbar, mit vorgeneigtem Körper, lenkt sie und bemüht
sich, ihren stürmischen Lauf zu zügeln. Um das sonnige
Genie des lothringischen Malers zu personifizieren, erinnert
die Allegorie an den Durchbruch des Lichtes. Sieht man
höher, zur Figur selbst, so hat man den Eindruck, als wäre
Claude, von einem Hügel herabkommend — in der einen
Hand die Palette, in der andern den Pinsel — im Begriffe,
malen zu wollen. Vor allem interessiert jedoch der Kopf:
breite, harte Züge, mit willensstarkem Ausdruck, ein Gesicht
voll Begeisterung, von der Sonne geblendet, deren Licht-
wirkung er so sorgfältig beobachtete und so treu wieder-
zugeben verstand.
Während Rodin sich hier zwang, dem Louis XV-Stil
der Stadt Nancy entsprechend, sich an die Art von Adam,
Guibal und Cyffle zu halten, mufs man ihn vor seiner grofsen
Gruppe der „Bürger von Calais", einen Nachfolger der un-
sterblichen, mittelalterlichen Bildner nennen (i8pO.
Zweifellos wäre weder die Auffassung noch die Technik
eines Zeitgenossen Eustaches de St. Pierre eine andere ge-
wesen, als die seine. Denn zweifellos war so, wie Rodin sie dar-
stellt, auch in Wirklichkeit die Haltung dieser Eustache de
St. Pierre, Jean d'Aire, Jacques und Pierre de Wissant, Jean
de Fiennes und Andrieux d'Andres, als sie die Stadt verliefsen,
um sich der Gnade des Siegers zu unterwerfen: barhaupt,
barfufs, Stricke um den Hals, Stadt- und Burgschlüssel in
der Hand. Wie Märtyrer schreiten sie ihrem Schicksal ent-
gegen die Strafse hin — (der Vergleich dürfte bei der Ver-
wandtschaft des ganzen Werkes mit den alten Calvarien
nicht unzutreffend sein): zwei von ihnen reden und
C T95 3
25*
durch keinerlei Umstände beeinflussen, die mit Kunst nichts
zu thun haben. Seine Werke, erreichen nur in ganz be-
stimmten und gewollten aufsergewöhnlichen Fällen monu-
mentale Dimensionen oder Lebensgröfse. Die Mehrzahl ist
gleich von vornherein in definitiver Gröfse ausgeführt, die
nicht über ein mittleres Format hinausgeht, so dafs ihre Auf-
stellung ebensowohl in den beschränkten Räumen unserer
Wohnungen wie in den Museen möglich ist. Zu diesen
Arbeiten gehören die Marmorgruppen, die man auf der Inter-
nationalen Ausstellung 1887 und sodann auf der Ausstellung
von 188p, die Rodin mit Claude Monet bei George Petit er-
öffnete, und endlich auch auf dem Champ de Mars gesehen
<sV'U nC ^u^zänuing sei n'eht versucht, ebenso wenig eine
Schilderung der Sujets. Es genüge, zu erwähnen, dafsdanteske
und baudelaire'sche Empfindung vorherrschen.
Was Rodin der Dichtkunst an Anregungen verdankt,
kann nur mit gröfster Zurückhaltung gesagt werden, da sich
bei ihm aufserordentlich oft die Idee aus der Form heraus-
bildet. Nur um ein Beispiel zu geben: Es ist kaum eine
zweite Bronze, die soviel Kommentare hervorgerufen hat, wie
die Figur einer alten nackten Frau, in der das Absterben des
menschlichen Körpers in solcher Weise jammervoll dar-
gestellt wurde. Man hat sie revolutionär genannt, ohne zu
bedenken, dafs Pigalle sich in gleichen Darstellungen gefiel,
wie sein Voltaire und die Thonfiguren im Orleans-Museum
zur Genüge beweisen. Es ist klar, dafs die Ausdeutung dieses
Nackten nach der geistigen Seite hin die Kraft bewirkt,
AUGUSTE RODIN, J. P. LAURENS
co<w'cG<^«<wac<i<rarc»e£ww*jff3«<w^
mit der diese Alters-Male und Narben auf dem verfallenen
Körper betont sind. Die kleinen Modelle, die sein Atelier
füllen — rasch hingeworfene Studien einer einzigen Sitzung
vor dem Modell — wie vertrauliche Mitteilungen einer
glühenden, bewegten Seele — belegen deutlich, wie Rodin
sich nur von suggestiven Bildern fesseln läfst, d. h. von
Bildern, die sein Gefühl und sein Nachdenken anregen.
Das ist auch bei den umfangreichsten Aufgaben, die er
sich stellt, ebenso. Lothringen und Artois besitzen drei
Denkmäler von ihm, die drei bedeutende Phasen seines
Lebens bezeichnen. Das erste, 188p enthüllt, war das für
Bastien-Lepage. Es handelte sich hier darum, einen modernen
Maler wiederzugeben, „tout preoccupe par la vie rustique et
par les ambiances du plein air." Rodin giebt Bastien Lepage
in dem Pelerinenmantel, den er gewöhnlich auf dem Lande
trug — in sinnend zurückgeneigter Stellung, die Wirkung
eines vor ihm stehenden Bildes erwägend. Der Gedanke,
der ihn beschäftigt, ist durch die bewegte Haltung sehr
glücklich zum Ausdruck gebracht, dazu kommt die Aehn-
lichkeit, die Eigentümlichkeit des Kostüms und die Zufällig-
keiten der Umgebung, welche beweisen, dafs die Arbeit im
Freien entstand, und so zeigt sich darin nicht nur der innerste
Charakter der ganzen Kunst Bastien Lepages, sondern auch
der seines ganzen Wollens.
Das Denkmal in Nancy, im Jahre i8p2 zu Ehren
Claude le Lorrain's errichtet, erhebt sich mitten in dem
Grün eines Parkes, einem aufserordentlich glücklich ge-
wählten Platz für das Standbild eines Landschafters und
eines Liebhabers weiter Fernsicht. Auf dem Unterbau, aufser-
halb der Sockelmasse, jagen zwei galoppierende Pferde mit
vorgestrecktem Hals ins Weite. Apollo, nur zur Hälfte
sichtbar, mit vorgeneigtem Körper, lenkt sie und bemüht
sich, ihren stürmischen Lauf zu zügeln. Um das sonnige
Genie des lothringischen Malers zu personifizieren, erinnert
die Allegorie an den Durchbruch des Lichtes. Sieht man
höher, zur Figur selbst, so hat man den Eindruck, als wäre
Claude, von einem Hügel herabkommend — in der einen
Hand die Palette, in der andern den Pinsel — im Begriffe,
malen zu wollen. Vor allem interessiert jedoch der Kopf:
breite, harte Züge, mit willensstarkem Ausdruck, ein Gesicht
voll Begeisterung, von der Sonne geblendet, deren Licht-
wirkung er so sorgfältig beobachtete und so treu wieder-
zugeben verstand.
Während Rodin sich hier zwang, dem Louis XV-Stil
der Stadt Nancy entsprechend, sich an die Art von Adam,
Guibal und Cyffle zu halten, mufs man ihn vor seiner grofsen
Gruppe der „Bürger von Calais", einen Nachfolger der un-
sterblichen, mittelalterlichen Bildner nennen (i8pO.
Zweifellos wäre weder die Auffassung noch die Technik
eines Zeitgenossen Eustaches de St. Pierre eine andere ge-
wesen, als die seine. Denn zweifellos war so, wie Rodin sie dar-
stellt, auch in Wirklichkeit die Haltung dieser Eustache de
St. Pierre, Jean d'Aire, Jacques und Pierre de Wissant, Jean
de Fiennes und Andrieux d'Andres, als sie die Stadt verliefsen,
um sich der Gnade des Siegers zu unterwerfen: barhaupt,
barfufs, Stricke um den Hals, Stadt- und Burgschlüssel in
der Hand. Wie Märtyrer schreiten sie ihrem Schicksal ent-
gegen die Strafse hin — (der Vergleich dürfte bei der Ver-
wandtschaft des ganzen Werkes mit den alten Calvarien
nicht unzutreffend sein): zwei von ihnen reden und
C T95 3
25*