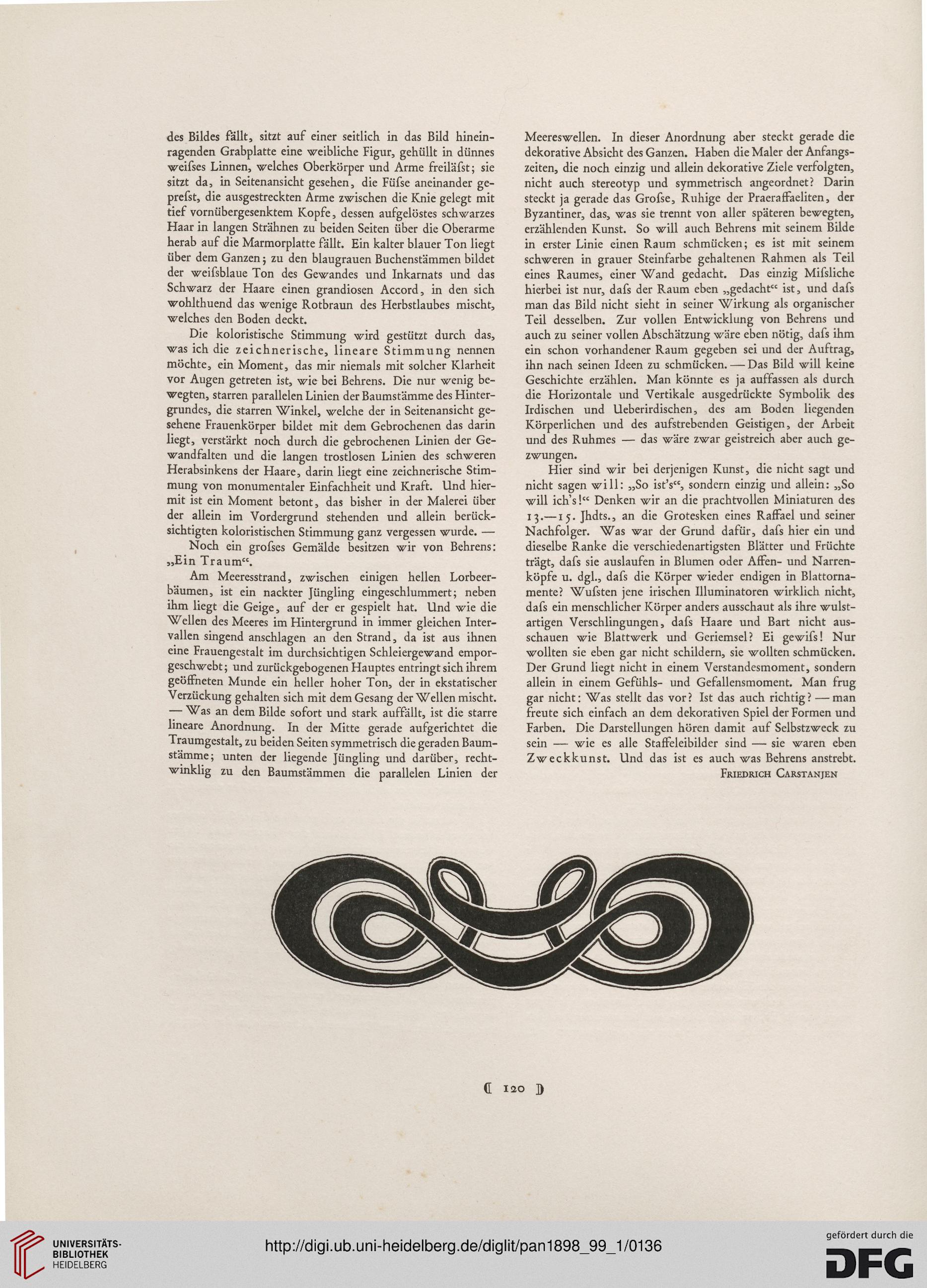des Bildes fällt, sitzt auf einer seitlich in das Bild hinein-
ragenden Grabplatte eine weibliche Figur, gehüllt in dünnes
weifses Linnen, welches Oberkörper und Arme freiläfst; sie
sitzt da, in Seitenansicht gesehen, die Füfse aneinander ge-
prefst, die ausgestreckten Arme zwischen die Knie gelegt mit
tief vornübergesenktem Kopfe, dessen aufgelöstes schwarzes
Haar in langen Strähnen zu beiden Seiten über die Oberarme
herab auf die Marmorplatte fällt. Ein kalter blauer Ton liegt
über dem Ganzen; zu den blaugrauen Buchenstämmen bildet
der weifsblaue Ton des Gewandes und Inkarnats und das
Schwarz der Haare einen grandiosen Accord, in den sich
wohlthuend das wenige Rotbraun des Herbstlaubes mischt,
welches den Boden deckt.
Die koloristische Stimmung wird gestützt durch das,
was ich die zeichnerische, lineare Stimmung nennen
möchte, ein Moment, das mir niemals mit solcher Klarheit
vor Augen getreten ist, wie bei Behrens. Die nur wenig be-
wegten, starren parallelen Linien der Baumstämme des Hinter-
grundes, die starren Winkel, welche der in Seitenansicht ge-
sehene Frauenkörper bildet mit dem Gebrochenen das darin
liegt, verstärkt noch durch die gebrochenen Linien der Ge-
wandfalten und die langen trostlosen Linien des schweren
Herabsinkens der Haare, darin liegt eine zeichnerische Stim-
mung von monumentaler Einfachheit und Kraft. Und hier-
mit ist ein Moment betont, das bisher in der Malerei über
der allein im Vordergrund stehenden und allein berück-
sichtigten koloristischen Stimmung ganz vergessen wurde. —
Noch ein grofses Gemälde besitzen wir von Behrens:
„Ein Traum".
Am Meeresstrand, zwischen einigen hellen Lorbeer-
bäumen, ist ein nackter Jüngling eingeschlummert; neben
ihm liegt die Geige, auf der er gespielt hat. Und wie die
"Wellen des Meeres im Hintergrund in immer gleichen Inter-
vallen singend anschlagen an den Strand, da ist aus ihnen
eine Frauengestalt im durchsichtigen Schleiergewand empor-
geschwebt ; und zurückgebogenen Hauptes entringt sich ihrem
geöffneten Munde ein heller hoher Ton, der in ekstatischer
Verzückung gehalten sich mit dem Gesang der Wellen mischt.
— Was an dem Bilde sofort und stark auffällt, ist die starre
lineare Anordnung. In der Mitte gerade aufgerichtet die
Traumgestalt, zu beiden Seiten symmetrisch die geraden Baum-
stämme; unten der liegende Jüngling und darüber, recht-
winklig zu den Baumstämmen die parallelen Linien der
Meereswellen. In dieser Anordnung aber steckt gerade die
dekorative Absicht des Ganzen. Haben die Maler der Anfangs-
zeiten, die noch einzig und allein dekorative Ziele verfolgten,
nicht auch stereotyp und symmetrisch angeordnet? Darin
steckt ja gerade das Grofse, Ruhige der Praeraffaeliten, der
Byzantiner, das, was sie trennt von aller späteren bewegten,
erzählenden Kunst. So will auch Behrens mit seinem Bilde
in erster Linie einen Raum schmücken; es ist mit seinem
schweren in grauer Steinfarbe gehaltenen Rahmen als Teil
eines Raumes, einer Wand gedacht. Das einzig Mifsliche
hierbei ist nur, dafs der Raum eben „gedacht" ist, und dafs
man das Bild nicht sieht in seiner Wirkung als organischer
Teil desselben. Zur vollen Entwicklung von Behrens und
auch zu seiner vollen Abschätzung wäre eben nötig, dafs ihm
ein schon vorhandener Raum gegeben sei und der Auftrag,
ihn nach seinen Ideen zu schmücken. — Das Bild will keine
Geschichte erzählen. Man könnte es ja auffassen als durch
die Horizontale und Vertikale ausgedrückte Symbolik des
Irdischen und Ueberirdischen, des am Boden liegenden
Körperlichen und des aufstrebenden Geistigen, der Arbeit
und des Ruhmes — das wäre zwar geistreich aber auch ge-
zwungen.
Hier sind wir bei derjenigen Kunst, die nicht sagt und
nicht sagen will: „So ist's", sondern einzig und allein: „So
will ich's!" Denken wir an die prachtvollen Miniaturen des
13.—15. Jhdts., an die Grotesken eines Raffael und seiner
Nachfolger. Was war der Grund dafür, dafs hier ein und
dieselbe Ranke die verschiedenartigsten Blätter und Früchte
trägt, dafs sie auslaufen in Blumen oder Affen- und Narren-
köpfe u. dgl., dafs die Körper wieder endigen in Blattorna-
mente? Wufsten jene irischen Illuminatoren wirklich nicht,
dafs ein menschlicher Körper anders ausschaut als ihre wulst-
artigen Verschlingungen, dafs Haare und Bart nicht aus-
schauen wie Blattwerk und Geriemsel? Ei gewifs! Nur
wollten sie eben gar nicht schildern, sie wollten schmücken.
Der Grund liegt nicht in einem Verstandesmoment, sondern
allein in einem Gefühls- und Gefallensmoment. Man frug
gar nicht: Was stellt das vor ? Ist das auch richtig ? — man
freute sich einfach an dem dekorativen Spiel der Formen und
Farben. Die Darstellungen hören damit auf Selbstzweck zu
sein — wie es alle Staffeleibilder sind — sie waren eben
Zweckkunst. Und das ist es auch was Behrens anstrebt.
Friedrich Carstanjen
C 120 ])
ragenden Grabplatte eine weibliche Figur, gehüllt in dünnes
weifses Linnen, welches Oberkörper und Arme freiläfst; sie
sitzt da, in Seitenansicht gesehen, die Füfse aneinander ge-
prefst, die ausgestreckten Arme zwischen die Knie gelegt mit
tief vornübergesenktem Kopfe, dessen aufgelöstes schwarzes
Haar in langen Strähnen zu beiden Seiten über die Oberarme
herab auf die Marmorplatte fällt. Ein kalter blauer Ton liegt
über dem Ganzen; zu den blaugrauen Buchenstämmen bildet
der weifsblaue Ton des Gewandes und Inkarnats und das
Schwarz der Haare einen grandiosen Accord, in den sich
wohlthuend das wenige Rotbraun des Herbstlaubes mischt,
welches den Boden deckt.
Die koloristische Stimmung wird gestützt durch das,
was ich die zeichnerische, lineare Stimmung nennen
möchte, ein Moment, das mir niemals mit solcher Klarheit
vor Augen getreten ist, wie bei Behrens. Die nur wenig be-
wegten, starren parallelen Linien der Baumstämme des Hinter-
grundes, die starren Winkel, welche der in Seitenansicht ge-
sehene Frauenkörper bildet mit dem Gebrochenen das darin
liegt, verstärkt noch durch die gebrochenen Linien der Ge-
wandfalten und die langen trostlosen Linien des schweren
Herabsinkens der Haare, darin liegt eine zeichnerische Stim-
mung von monumentaler Einfachheit und Kraft. Und hier-
mit ist ein Moment betont, das bisher in der Malerei über
der allein im Vordergrund stehenden und allein berück-
sichtigten koloristischen Stimmung ganz vergessen wurde. —
Noch ein grofses Gemälde besitzen wir von Behrens:
„Ein Traum".
Am Meeresstrand, zwischen einigen hellen Lorbeer-
bäumen, ist ein nackter Jüngling eingeschlummert; neben
ihm liegt die Geige, auf der er gespielt hat. Und wie die
"Wellen des Meeres im Hintergrund in immer gleichen Inter-
vallen singend anschlagen an den Strand, da ist aus ihnen
eine Frauengestalt im durchsichtigen Schleiergewand empor-
geschwebt ; und zurückgebogenen Hauptes entringt sich ihrem
geöffneten Munde ein heller hoher Ton, der in ekstatischer
Verzückung gehalten sich mit dem Gesang der Wellen mischt.
— Was an dem Bilde sofort und stark auffällt, ist die starre
lineare Anordnung. In der Mitte gerade aufgerichtet die
Traumgestalt, zu beiden Seiten symmetrisch die geraden Baum-
stämme; unten der liegende Jüngling und darüber, recht-
winklig zu den Baumstämmen die parallelen Linien der
Meereswellen. In dieser Anordnung aber steckt gerade die
dekorative Absicht des Ganzen. Haben die Maler der Anfangs-
zeiten, die noch einzig und allein dekorative Ziele verfolgten,
nicht auch stereotyp und symmetrisch angeordnet? Darin
steckt ja gerade das Grofse, Ruhige der Praeraffaeliten, der
Byzantiner, das, was sie trennt von aller späteren bewegten,
erzählenden Kunst. So will auch Behrens mit seinem Bilde
in erster Linie einen Raum schmücken; es ist mit seinem
schweren in grauer Steinfarbe gehaltenen Rahmen als Teil
eines Raumes, einer Wand gedacht. Das einzig Mifsliche
hierbei ist nur, dafs der Raum eben „gedacht" ist, und dafs
man das Bild nicht sieht in seiner Wirkung als organischer
Teil desselben. Zur vollen Entwicklung von Behrens und
auch zu seiner vollen Abschätzung wäre eben nötig, dafs ihm
ein schon vorhandener Raum gegeben sei und der Auftrag,
ihn nach seinen Ideen zu schmücken. — Das Bild will keine
Geschichte erzählen. Man könnte es ja auffassen als durch
die Horizontale und Vertikale ausgedrückte Symbolik des
Irdischen und Ueberirdischen, des am Boden liegenden
Körperlichen und des aufstrebenden Geistigen, der Arbeit
und des Ruhmes — das wäre zwar geistreich aber auch ge-
zwungen.
Hier sind wir bei derjenigen Kunst, die nicht sagt und
nicht sagen will: „So ist's", sondern einzig und allein: „So
will ich's!" Denken wir an die prachtvollen Miniaturen des
13.—15. Jhdts., an die Grotesken eines Raffael und seiner
Nachfolger. Was war der Grund dafür, dafs hier ein und
dieselbe Ranke die verschiedenartigsten Blätter und Früchte
trägt, dafs sie auslaufen in Blumen oder Affen- und Narren-
köpfe u. dgl., dafs die Körper wieder endigen in Blattorna-
mente? Wufsten jene irischen Illuminatoren wirklich nicht,
dafs ein menschlicher Körper anders ausschaut als ihre wulst-
artigen Verschlingungen, dafs Haare und Bart nicht aus-
schauen wie Blattwerk und Geriemsel? Ei gewifs! Nur
wollten sie eben gar nicht schildern, sie wollten schmücken.
Der Grund liegt nicht in einem Verstandesmoment, sondern
allein in einem Gefühls- und Gefallensmoment. Man frug
gar nicht: Was stellt das vor ? Ist das auch richtig ? — man
freute sich einfach an dem dekorativen Spiel der Formen und
Farben. Die Darstellungen hören damit auf Selbstzweck zu
sein — wie es alle Staffeleibilder sind — sie waren eben
Zweckkunst. Und das ist es auch was Behrens anstrebt.
Friedrich Carstanjen
C 120 ])