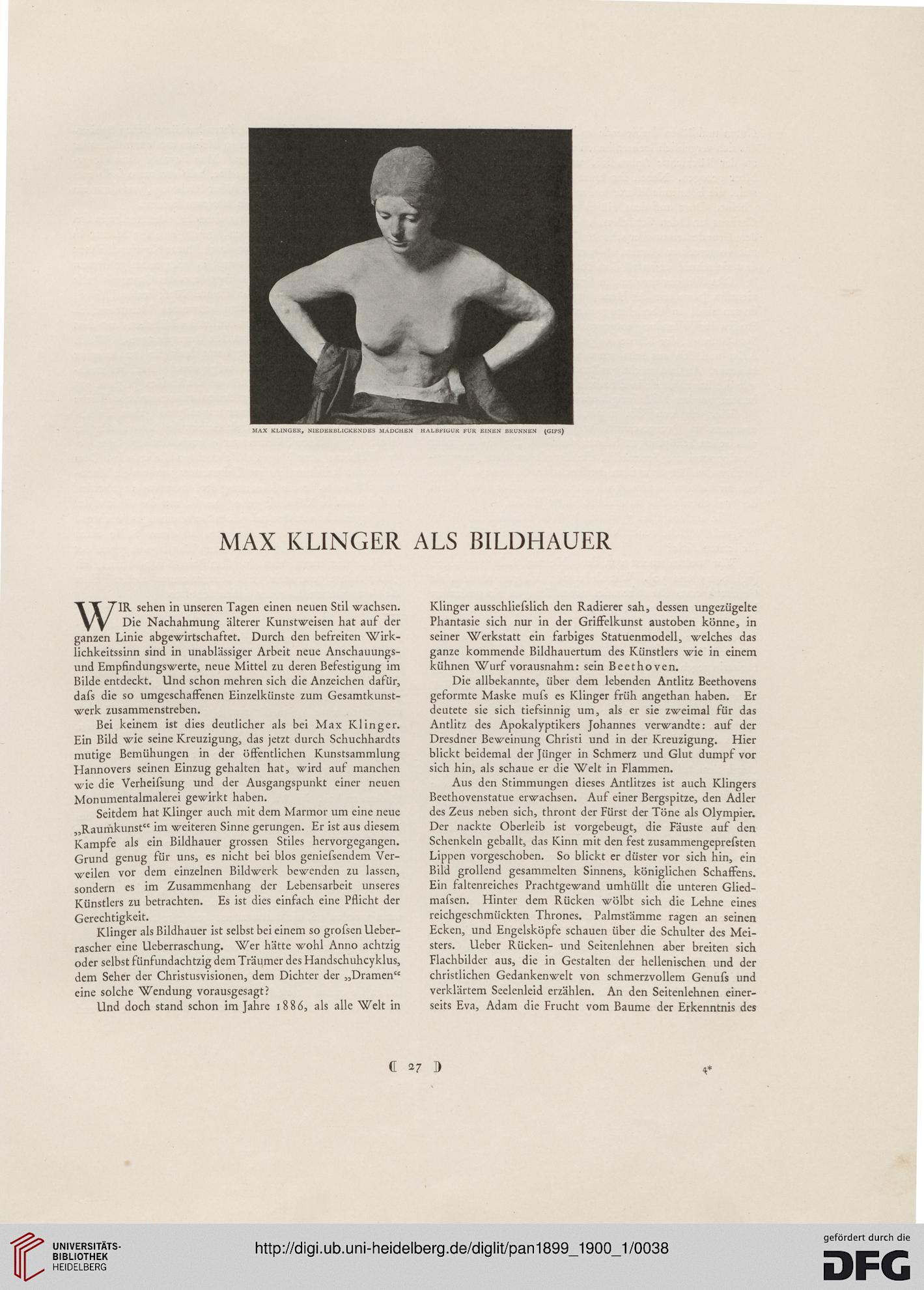MAX KLINGER, NIEDERBLICKENDES MADCHEN HALBFIGUR FÜR EINEN BRUNNEN (GIPS)
MAX KLINGER ALS BILDHAUER
WIR sehen in unseren Tagen einen neuen Stil wachsen.
Die Nachahmung älterer Kunstweisen hat auf der
ganzen Linie abgewirtschaftet. Durch den befreiten Wirk-
lichkeitssinn sind in unablässiger Arbeit neue Anschauungs-
und Empfindungswerte, neue Mittel zu deren Befestigung im
Bilde entdeckt. Und schon mehren sich die Anzeichen dafür,
dafs die so umgeschaffenen Einzelkünste zum Gesamtkunst-
werk zusammenstreben.
Bei keinem ist dies deutlicher als bei Max Klinger.
Ein Bild wie seine Kreuzigung, das jetzt durch Schuchhardts
mutige Bemühungen in der öffentlichen Kunstsammlung
Hannovers seinen Einzug gehalten hat, wird auf manchen
wie die Verheifsung und der Ausgangspunkt einer neuen
Monumentalmalerei gewirkt haben.
Seitdem hat Klinger auch mit dem Marmor um eine neue
,Raunikunst" im weiteren Sinne gerungen. Er ist aus diesem
Kampfe als ein Bildhauer grossen Stiles hervorgegangen.
Grund genug für uns, es nicht bei blos geniefsendem Ver-
weilen vor dem einzelnen Bildwerk bewenden zu lassen,
sondern es im Zusammenhang der Lebensarbeit unseres
Künstlers zu betrachten. Es ist dies einfach eine Pflicht der
Gerechtigkeit.
Klinger als Bildhauer ist selbst bei einem so grofsen Ueber-
rascher eine Ueberraschung. "Wer hätte wohl Anno achtzig
oder selbst fünfundachtzig dem Träumer des Handschuhcyklus,
dem Seher der Christusvisionen, dem Dichter der „Dramen"
eine solche Wendung vorausgesagt?
Und doch stand schon im Jahre 1886, als alle Welt in
Klinger ausschliefslich den Radierer sah, dessen ungezügelte
Phantasie sich nur in der Griffelkunst austoben könne, in
seiner Werkstatt ein farbiges Statuenmodell, welches das
ganze kommende Bildhauertum des Künstlers wie in einem
kühnen Wurf vorausnahm: sein Beethoven.
Die allbekannte, über dem lebenden Antlitz Beethovens
geformte Maske mufs es Klinger früh angethan haben. Er
deutete sie sich tiefsinnig um, als er sie zweimal für das
Antlitz des Apokalyptikers Johannes verwandte: auf der
Dresdner Beweinung Christi und in der Kreuzigung. Hier
blickt beidemal der Jünger in Schmerz und Glut dumpf vor
sich hin, als schaue er die Welt in Flammen.
Aus den Stimmungen dieses Antlitzes ist auch Klingers
Beethovenstatue erwachsen. Auf einer Bergspitze, den Adler
des Zeus neben sich, thront der Fürst der Töne als Olympier.
Der nackte Oberleib ist vorgebeugt, die Fäuste auf den
Schenkeln geballt, das Kinn mit den fest zusammengeprefsten
Lippen vorgeschoben. So blickt er düster vor sich hin, ein
Bild grollend gesammelten Sinnens, königlichen Schaffens.
Ein faltenreiches Prachtgewand umhüllt die unteren Glied-
mafsen. Hinter dem Rücken wölbt sich die Lehne eines
reichgeschmückten Thrones. Palmstämme ragen an seinen
Ecken, und Engelsköpfe schauen über die Schulter des Mei-
sters. Ueber Rücken- und Seitenlehnen aber breiten sich
Flachbilder aus, die in Gestalten der hellenischen und der
christlichen Gedankenwelt von schmerzvollem Genufs und
verklärtem Seelenleid erzählen. An den Seitenlehnen einer-
seits Eva, Adam die Frucht vom Baume der Erkenntnis des
C 27 3
MAX KLINGER ALS BILDHAUER
WIR sehen in unseren Tagen einen neuen Stil wachsen.
Die Nachahmung älterer Kunstweisen hat auf der
ganzen Linie abgewirtschaftet. Durch den befreiten Wirk-
lichkeitssinn sind in unablässiger Arbeit neue Anschauungs-
und Empfindungswerte, neue Mittel zu deren Befestigung im
Bilde entdeckt. Und schon mehren sich die Anzeichen dafür,
dafs die so umgeschaffenen Einzelkünste zum Gesamtkunst-
werk zusammenstreben.
Bei keinem ist dies deutlicher als bei Max Klinger.
Ein Bild wie seine Kreuzigung, das jetzt durch Schuchhardts
mutige Bemühungen in der öffentlichen Kunstsammlung
Hannovers seinen Einzug gehalten hat, wird auf manchen
wie die Verheifsung und der Ausgangspunkt einer neuen
Monumentalmalerei gewirkt haben.
Seitdem hat Klinger auch mit dem Marmor um eine neue
,Raunikunst" im weiteren Sinne gerungen. Er ist aus diesem
Kampfe als ein Bildhauer grossen Stiles hervorgegangen.
Grund genug für uns, es nicht bei blos geniefsendem Ver-
weilen vor dem einzelnen Bildwerk bewenden zu lassen,
sondern es im Zusammenhang der Lebensarbeit unseres
Künstlers zu betrachten. Es ist dies einfach eine Pflicht der
Gerechtigkeit.
Klinger als Bildhauer ist selbst bei einem so grofsen Ueber-
rascher eine Ueberraschung. "Wer hätte wohl Anno achtzig
oder selbst fünfundachtzig dem Träumer des Handschuhcyklus,
dem Seher der Christusvisionen, dem Dichter der „Dramen"
eine solche Wendung vorausgesagt?
Und doch stand schon im Jahre 1886, als alle Welt in
Klinger ausschliefslich den Radierer sah, dessen ungezügelte
Phantasie sich nur in der Griffelkunst austoben könne, in
seiner Werkstatt ein farbiges Statuenmodell, welches das
ganze kommende Bildhauertum des Künstlers wie in einem
kühnen Wurf vorausnahm: sein Beethoven.
Die allbekannte, über dem lebenden Antlitz Beethovens
geformte Maske mufs es Klinger früh angethan haben. Er
deutete sie sich tiefsinnig um, als er sie zweimal für das
Antlitz des Apokalyptikers Johannes verwandte: auf der
Dresdner Beweinung Christi und in der Kreuzigung. Hier
blickt beidemal der Jünger in Schmerz und Glut dumpf vor
sich hin, als schaue er die Welt in Flammen.
Aus den Stimmungen dieses Antlitzes ist auch Klingers
Beethovenstatue erwachsen. Auf einer Bergspitze, den Adler
des Zeus neben sich, thront der Fürst der Töne als Olympier.
Der nackte Oberleib ist vorgebeugt, die Fäuste auf den
Schenkeln geballt, das Kinn mit den fest zusammengeprefsten
Lippen vorgeschoben. So blickt er düster vor sich hin, ein
Bild grollend gesammelten Sinnens, königlichen Schaffens.
Ein faltenreiches Prachtgewand umhüllt die unteren Glied-
mafsen. Hinter dem Rücken wölbt sich die Lehne eines
reichgeschmückten Thrones. Palmstämme ragen an seinen
Ecken, und Engelsköpfe schauen über die Schulter des Mei-
sters. Ueber Rücken- und Seitenlehnen aber breiten sich
Flachbilder aus, die in Gestalten der hellenischen und der
christlichen Gedankenwelt von schmerzvollem Genufs und
verklärtem Seelenleid erzählen. An den Seitenlehnen einer-
seits Eva, Adam die Frucht vom Baume der Erkenntnis des
C 27 3