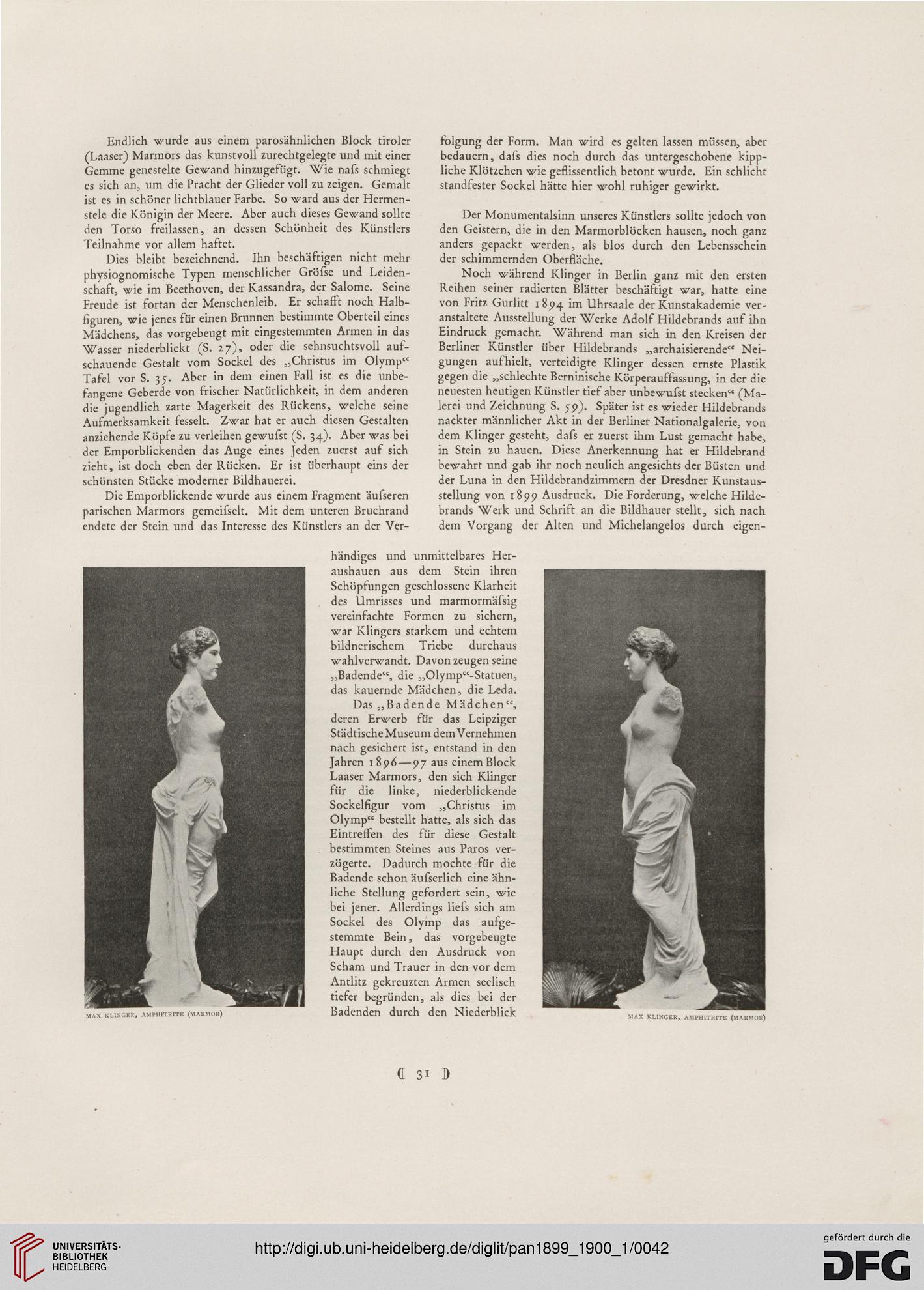Endlich wurde aus einem parosähnlichen Block tiroler
(Laaser) Marmors das kunstvoll zurechtgelegte und mit einer
Gemme genestelte Gewand hinzugefügt. Wie nafs schmiegt
es sich an, um die Pracht der Glieder voll zu zeigen. Gemalt
ist es in schöner lichtblauer Farbe. So ward aus der Hermen-
stele die Königin der Meere. Aber auch dieses Gewand sollte
den Torso freilassen, an dessen Schönheit des Künstlers
Teilnahme vor allem haftet.
Dies bleibt bezeichnend. Ihn beschäftigen nicht mehr
physiognomische Typen menschlicher Gröfse und Leiden-
schaft, wie im Beethoven, der Kassandra, der Salome. Seine
Freude ist fortan der Menschenleib. Er schafft noch Halb-
figuren, wie jenes für einen Brunnen bestimmte Oberteil eines
Mädchens, das vorgebeugt mit eingestemmten Armen in das
Wasser niederblickt (S. 27), oder die sehnsuchtsvoll auf-
schauende Gestalt vom Sockel des „Christus im Olymp"
Tafel vor S. 35. Aber in dem einen Fall ist es die unbe-
fangene Geberde von frischer Natürlichkeit, in dem anderen
die jugendlich zarte Magerkeit des Rückens, welche seine
Aufmerksamkeit fesselt. Zwar hat er auch diesen Gestalten
anziehende Köpfe zu verleihen gewufst (S. 34). Aber was bei
der Emporblickenden das Auge eines Jeden zuerst auf sich
zieht, ist doch eben der Rücken. Er ist überhaupt eins der
schönsten Stücke moderner Bildhauerei.
Die Emporblickende wurde aus einem Fragment äufseren
panschen Marmors gemeifselt. Mit dem unteren Bruchrand
endete der Stein und das Interesse des Künstlers an der Ver-
folgung der Form. Man wird es gelten lassen müssen, aber
bedauern, dafs dies noch durch das untergeschobene kipp-
liche Klötzchen wie geflissentlich betont wurde. Ein schlicht
standfester Sockel hätte hier wohl ruhiger gewirkt.
Der Monumentalsinn unseres Künstlers sollte jedoch von
den Geistern, die in den Marmorblöcken hausen, noch ganz
anders gepackt werden, als blos durch den Lebensschein
der schimmernden Oberfläche.
Noch während Klinger in Berlin ganz mit den ersten
Reihen seiner radierten Blätter beschäftigt war, hatte eine
von Fritz Gurlitt 1894 im Uhrsaale der Kunstakademie ver-
anstaltete Ausstellung der Werke Adolf Hildebrands auf ihn
Eindruck gemacht. Während man sich in den Kreisen der
Berliner Künstler über Hildebrands „archaisierende" Nei-
gungen aufhielt, verteidigte Klinger dessen ernste Plastik
gegen die „schlechte Berninische Körperauffassung, in der die
neuesten heutigen Künstler tief aber unbewufst stecken" (Ma-
lerei und Zeichnung S. 59). Später ist es wieder Hildebrands
nackter männlicher Akt in der Berliner Nationalgalerie, von
dem Klinger gesteht, dafs er zuerst ihm Lust gemacht habe,
in Stein zu hauen. Diese Anerkennung hat er Hildebrand
bewahrt und gab ihr noch neulich angesichts der Büsten und
der Luna in den Hildebrandzimmern der Dresdner Kunstaus-
stellung von 1809 Ausdruck. Die Forderung, welche Hilde-
brands Werk und Schrift an die Bildhauer stellt, sich nach
dem Vorgang der Alten und Michelangelos durch eigen-
*AX KUNGF.K, AMPHITK1TE (MARMOR)
händiges und unmittelbares Her-
aushauen aus dem Stein ihren
Schöpfungen geschlossene Klarheit
des Umrisses und marmormäfsig
vereinfachte Formen zu sichern,
war Klingers starkem und echtem
bildnerischem Triebe durchaus
wahlverwandt. Davon zeugen seine
„Badende", die „Olymp"-Statuen,
das kauernde Mädchen, die Leda.
Das „Badende Mädchen",
deren Erwerb für das Leipziger
Städtische Museum dem Vernehmen
nach gesichert ist, entstand in den
Jahren 1806 — 97 aus einem Block
Laaser Marmors, den sich Klinger
für die linke, niederblickende
Sockelfigur vom „Christus im
Olymp" bestellt hatte, als sich das
Eintreffen des für diese Gestalt
bestimmten Steines aus Paros ver-
zögerte. Dadurch mochte für die
Badende schon äufserlich eine ähn-
liche Stellung gefordert sein, wie
bei jener. Allerdings liefs sich am
Sockel des Olymp das aufge-
stemmte Bein, das vorgebeugte
Haupt durch den Ausdruck von
Scham und Trauer in den vor dem
Antlitz gekreuzten Armen seelisch
tiefer begründen, als dies bei der
Badenden durch den Niederblick
MAX KLINGER, AMPH1TRITE (MARMOR)
C 31 ö
(Laaser) Marmors das kunstvoll zurechtgelegte und mit einer
Gemme genestelte Gewand hinzugefügt. Wie nafs schmiegt
es sich an, um die Pracht der Glieder voll zu zeigen. Gemalt
ist es in schöner lichtblauer Farbe. So ward aus der Hermen-
stele die Königin der Meere. Aber auch dieses Gewand sollte
den Torso freilassen, an dessen Schönheit des Künstlers
Teilnahme vor allem haftet.
Dies bleibt bezeichnend. Ihn beschäftigen nicht mehr
physiognomische Typen menschlicher Gröfse und Leiden-
schaft, wie im Beethoven, der Kassandra, der Salome. Seine
Freude ist fortan der Menschenleib. Er schafft noch Halb-
figuren, wie jenes für einen Brunnen bestimmte Oberteil eines
Mädchens, das vorgebeugt mit eingestemmten Armen in das
Wasser niederblickt (S. 27), oder die sehnsuchtsvoll auf-
schauende Gestalt vom Sockel des „Christus im Olymp"
Tafel vor S. 35. Aber in dem einen Fall ist es die unbe-
fangene Geberde von frischer Natürlichkeit, in dem anderen
die jugendlich zarte Magerkeit des Rückens, welche seine
Aufmerksamkeit fesselt. Zwar hat er auch diesen Gestalten
anziehende Köpfe zu verleihen gewufst (S. 34). Aber was bei
der Emporblickenden das Auge eines Jeden zuerst auf sich
zieht, ist doch eben der Rücken. Er ist überhaupt eins der
schönsten Stücke moderner Bildhauerei.
Die Emporblickende wurde aus einem Fragment äufseren
panschen Marmors gemeifselt. Mit dem unteren Bruchrand
endete der Stein und das Interesse des Künstlers an der Ver-
folgung der Form. Man wird es gelten lassen müssen, aber
bedauern, dafs dies noch durch das untergeschobene kipp-
liche Klötzchen wie geflissentlich betont wurde. Ein schlicht
standfester Sockel hätte hier wohl ruhiger gewirkt.
Der Monumentalsinn unseres Künstlers sollte jedoch von
den Geistern, die in den Marmorblöcken hausen, noch ganz
anders gepackt werden, als blos durch den Lebensschein
der schimmernden Oberfläche.
Noch während Klinger in Berlin ganz mit den ersten
Reihen seiner radierten Blätter beschäftigt war, hatte eine
von Fritz Gurlitt 1894 im Uhrsaale der Kunstakademie ver-
anstaltete Ausstellung der Werke Adolf Hildebrands auf ihn
Eindruck gemacht. Während man sich in den Kreisen der
Berliner Künstler über Hildebrands „archaisierende" Nei-
gungen aufhielt, verteidigte Klinger dessen ernste Plastik
gegen die „schlechte Berninische Körperauffassung, in der die
neuesten heutigen Künstler tief aber unbewufst stecken" (Ma-
lerei und Zeichnung S. 59). Später ist es wieder Hildebrands
nackter männlicher Akt in der Berliner Nationalgalerie, von
dem Klinger gesteht, dafs er zuerst ihm Lust gemacht habe,
in Stein zu hauen. Diese Anerkennung hat er Hildebrand
bewahrt und gab ihr noch neulich angesichts der Büsten und
der Luna in den Hildebrandzimmern der Dresdner Kunstaus-
stellung von 1809 Ausdruck. Die Forderung, welche Hilde-
brands Werk und Schrift an die Bildhauer stellt, sich nach
dem Vorgang der Alten und Michelangelos durch eigen-
*AX KUNGF.K, AMPHITK1TE (MARMOR)
händiges und unmittelbares Her-
aushauen aus dem Stein ihren
Schöpfungen geschlossene Klarheit
des Umrisses und marmormäfsig
vereinfachte Formen zu sichern,
war Klingers starkem und echtem
bildnerischem Triebe durchaus
wahlverwandt. Davon zeugen seine
„Badende", die „Olymp"-Statuen,
das kauernde Mädchen, die Leda.
Das „Badende Mädchen",
deren Erwerb für das Leipziger
Städtische Museum dem Vernehmen
nach gesichert ist, entstand in den
Jahren 1806 — 97 aus einem Block
Laaser Marmors, den sich Klinger
für die linke, niederblickende
Sockelfigur vom „Christus im
Olymp" bestellt hatte, als sich das
Eintreffen des für diese Gestalt
bestimmten Steines aus Paros ver-
zögerte. Dadurch mochte für die
Badende schon äufserlich eine ähn-
liche Stellung gefordert sein, wie
bei jener. Allerdings liefs sich am
Sockel des Olymp das aufge-
stemmte Bein, das vorgebeugte
Haupt durch den Ausdruck von
Scham und Trauer in den vor dem
Antlitz gekreuzten Armen seelisch
tiefer begründen, als dies bei der
Badenden durch den Niederblick
MAX KLINGER, AMPH1TRITE (MARMOR)
C 31 ö