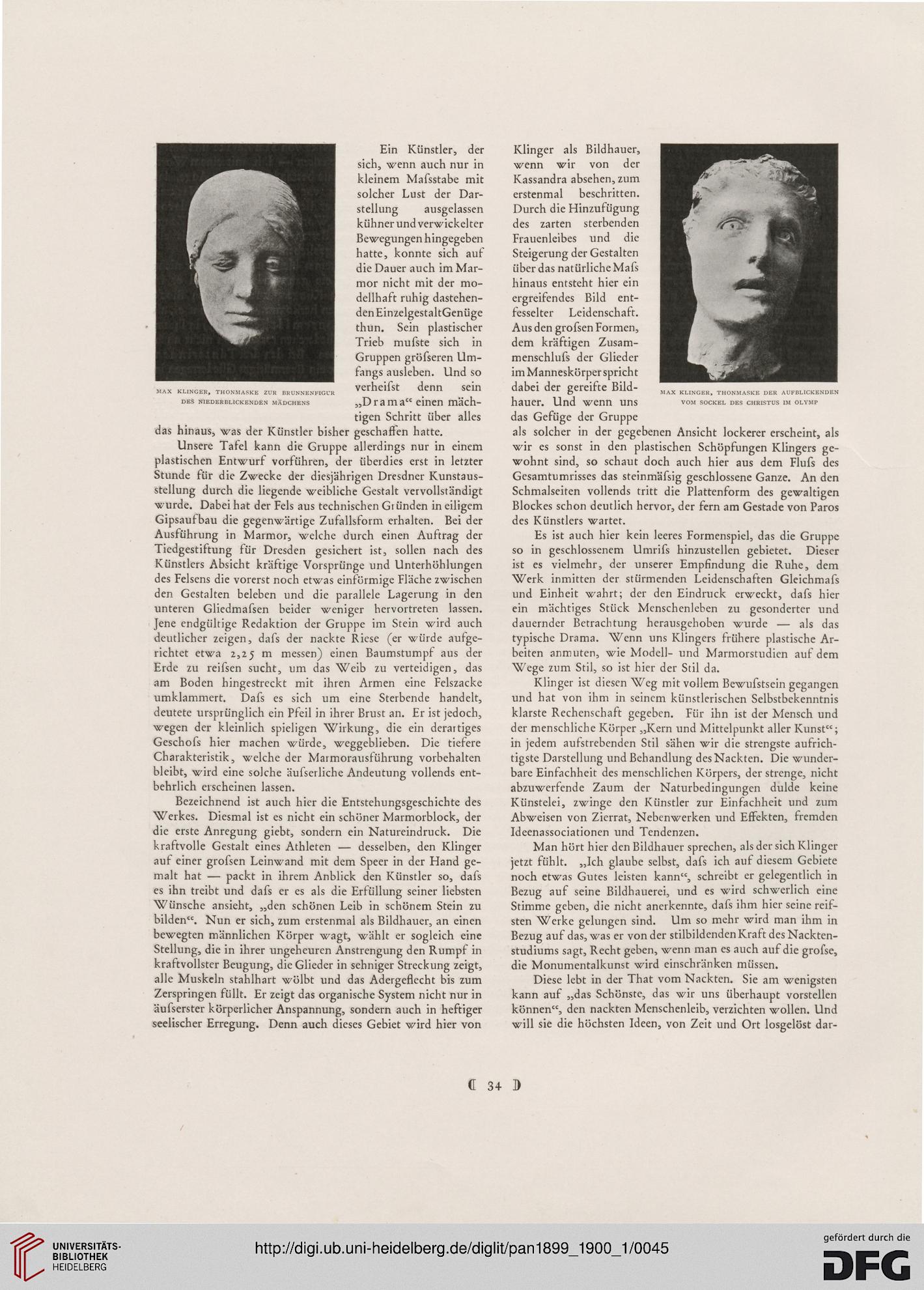MAX KLINGER, THONMASKE ZUR BRUNNENFIGUR
DES NIEDERBLICKENDEN MÄDCHENS
Ein Künstler, der
sich, wenn auch nur in
kleinem Mafsstabe mit
solcher Lust der Dar-
stellung ausgelassen
kühner und verwickelter
Bewegungen hingegeben
hatte, konnte sich auf
die Dauer auch im Mar-
mor nicht mit der mo-
dellhaft ruhig dastehen-
den EinzelgestaltGenüge
thun. Sein plastischer
Trieb mufste sich in
Gruppen gröfseren Um-
fangs ausleben. Und so
verheifst denn sein
„Drama" einen mäch-
tigen Schritt über alles
das hinaus, was der Künstler bisher geschaffen hatte.
Unsere Tafel kann die Gruppe allerdings nur in einem
plastischen Entwurf vorführen, der überdies erst in letzter
Stunde für die Zwecke der diesjährigen Dresdner Kunstaus-
stellung durch die liegende weibliche Gestalt vervollständigt
wurde. Dabei hat der Fels aus technischen Gründen in eiligem
Gipsaufbau die gegenwärtige Zufallsform erhalten. Bei der
Ausführung in Marmor, welche durch einen Auftrag der
Tiedgestiftung für Dresden gesichert ist, sollen nach des
Künstlers Absicht kräftige Vorsprünge und Unterhöhlungen
des Felsens die vorerst noch etwas einförmige Fläche zwischen
den Gestalten beleben und die parallele Lagerung in den
unteren Gliedmafsen beider weniger hervortreten lassen.
Jene endgültige Redaktion der Gruppe im Stein wird auch
deutlicher zeigen, dafs der nackte Riese (er würde aufge-
richtet etwa 2,25 m messen) einen Baumstumpf aus der
Erde zu reifsen sucht, um das "Weib zu verteidigen, das
am Boden hingestreckt mit ihren Armen eine Felszacke
umklammert. Dafs es sich um eine Sterbende handelt,
deutete ursprünglich ein Pfeil in ihrer Brust an. Er ist jedoch,
wegen der kleinlich spieligen Wirkung, die ein derartiges
Geschofs hier machen würde, weggeblieben. Die tiefere
Charakteristik, welche der Marmorausführung vorbehalten
bleibt, wird eine solche äufserliche Andeutung vollends ent-
behrlich erscheinen lassen.
Bezeichnend ist auch hier die Entstehungsgeschichte des
Werkes. Diesmal ist es nicht ein schöner Marmorblock, der
die erste Anregung giebt, sondern ein Natureindruck. Die
kraftvolle Gestalt eines Athleten — desselben, den Klinger
auf einer grofsen Leinwand mit dem Speer in der Hand ge-
malt hat — packt in ihrem Anblick den Künstler so, dafs
es ihn treibt und dafs er es als die Erfüllung seiner liebsten
Wünsche ansieht, „den schönen Leib in schönem Stein zu
bilden". Nun er sich, zum erstenmal als Bildhauer, an einen
bewegten männlichen Körper wagt, wählt er sogleich eine
Stellung, die in ihrer ungeheuren Anstrengung den Rumpf in
kraftvollster Beugung, die Glieder in sehniger Streckung zeigt,
alle Muskeln stahlhart wölbt und das Adergeflecht bis zum
Zerspringen füllt. Er zeigt das organische System nicht nur in
äufserster körperlicher Anspannung, sondern auch in heftiger
seelischer Erregung. Denn auch dieses Gebiet wird hier von
MAX KLINGER, THONMASKE DER AUFBLICKENDEN
VOM SOCKEL DES CHRISTUS IM OLYMP
Klinger als Bildhauer,
wenn wir von der
Kassandra absehen, zum
erstenmal beschritten.
Durch die Hinzufügung
des zarten sterbenden
Frauenleibes und die
Steigerung der Gestalten
über das natürliche Mafs
hinaus entsteht hier ein
ergreifendes Bild ent-
fesselter Leidenschaft.
Aus den grofsen Formen,
dem kräftigen Zusam-
menschlufs der Glieder
im Manneskürperspricht
dabei der gereifte Bild-
hauer. Und wenn uns
das Gefüge der Gruppe
als solcher in der gegebenen Ansicht lockerer erscheint, als
wir es sonst in den plastischen Schöpfungen Klingers ge-
wohnt sind, so schaut doch auch hier aus dem Flufs des
Gesamtumrisses das steinmäfsig geschlossene Ganze. An den
Schmalseiten vollends tritt die Plattenform des gewaltigen
Blockes schon deutlich hervor, der fern am Gestade von Paros
des Künstlers wartet.
Es ist auch hier kein leeres Formenspiel, das die Gruppe
so in geschlossenem Umrifs hinzustellen gebietet. Dieser
ist es vielmehr, der unserer Empfindung die Ruhe, dem
Werk inmitten der stürmenden Leidenschaften Gleichmafs
und Einheit wahrt; der den Eindruck erweckt, dafs hier
ein mächtiges Stück Menschenleben zu gesonderter und
dauernder Betrachtung herausgehoben wurde — als das
typische Drama. Wenn uns Klingers frühere plastische Ar-
beiten anmuten, wie Modell- und Marmorstudien auf dem
"Wege zum Stil, so ist hier der Stil da.
Klinger ist diesen Weg mit vollem Bewufstsein gegangen
und hat von ihm in seinem künstlerischen Selbstbekenntnis
klarste Rechenschaft gegeben. Für ihn ist der Mensch und
der menschliche Körper „Kern und Mittelpunkt aller Kunst";
in jedem aufstrebenden Stil sähen wir die strengste aufrich-
tigste Darstellung und Behandlung des Nackten. Die wunder-
bare Einfachheit des menschlichen Körpers, der strenge, nicht
abzuwerfende Zaum der Naturbedingungen dulde keine
Künstelei, zwinge den Künstler zur Einfachheit und zum
Abweisen von Zierrat, Nebenwerken und Effekten, fremden
Ideenassociationen und Tendenzen.
Man hört hier den Bildhauer sprechen, als der sich Klinger
jetzt fühlt. „Ich glaube selbst, dafs ich auf diesem Gebiete
noch etwas Gutes leisten kann", schreibt er gelegentlich in
Bezug auf seine Bildhauerei, und es wird schwerlich eine
Stimme geben, die nicht anerkennte, dafs ihm hier seine reif-
sten Werke gelungen sind. Um so mehr wird man ihm in
Bezug auf das, was er von der stilbildenden Kraft des Nackten-
studiums sagt, Recht geben, wenn man es auch auf die grofse,
die Monumentalkunst wird einschränken müssen.
Diese lebt in der That vom Nackten. Sie am wenigsten
kann auf „das Schönste, das wir uns überhaupt vorstellen
können", den nackten Menschenleib, verzichten wollen. Und
will sie die höchsten Ideen, von Zeit und Ort losgelöst dar-
C 34 I)
DES NIEDERBLICKENDEN MÄDCHENS
Ein Künstler, der
sich, wenn auch nur in
kleinem Mafsstabe mit
solcher Lust der Dar-
stellung ausgelassen
kühner und verwickelter
Bewegungen hingegeben
hatte, konnte sich auf
die Dauer auch im Mar-
mor nicht mit der mo-
dellhaft ruhig dastehen-
den EinzelgestaltGenüge
thun. Sein plastischer
Trieb mufste sich in
Gruppen gröfseren Um-
fangs ausleben. Und so
verheifst denn sein
„Drama" einen mäch-
tigen Schritt über alles
das hinaus, was der Künstler bisher geschaffen hatte.
Unsere Tafel kann die Gruppe allerdings nur in einem
plastischen Entwurf vorführen, der überdies erst in letzter
Stunde für die Zwecke der diesjährigen Dresdner Kunstaus-
stellung durch die liegende weibliche Gestalt vervollständigt
wurde. Dabei hat der Fels aus technischen Gründen in eiligem
Gipsaufbau die gegenwärtige Zufallsform erhalten. Bei der
Ausführung in Marmor, welche durch einen Auftrag der
Tiedgestiftung für Dresden gesichert ist, sollen nach des
Künstlers Absicht kräftige Vorsprünge und Unterhöhlungen
des Felsens die vorerst noch etwas einförmige Fläche zwischen
den Gestalten beleben und die parallele Lagerung in den
unteren Gliedmafsen beider weniger hervortreten lassen.
Jene endgültige Redaktion der Gruppe im Stein wird auch
deutlicher zeigen, dafs der nackte Riese (er würde aufge-
richtet etwa 2,25 m messen) einen Baumstumpf aus der
Erde zu reifsen sucht, um das "Weib zu verteidigen, das
am Boden hingestreckt mit ihren Armen eine Felszacke
umklammert. Dafs es sich um eine Sterbende handelt,
deutete ursprünglich ein Pfeil in ihrer Brust an. Er ist jedoch,
wegen der kleinlich spieligen Wirkung, die ein derartiges
Geschofs hier machen würde, weggeblieben. Die tiefere
Charakteristik, welche der Marmorausführung vorbehalten
bleibt, wird eine solche äufserliche Andeutung vollends ent-
behrlich erscheinen lassen.
Bezeichnend ist auch hier die Entstehungsgeschichte des
Werkes. Diesmal ist es nicht ein schöner Marmorblock, der
die erste Anregung giebt, sondern ein Natureindruck. Die
kraftvolle Gestalt eines Athleten — desselben, den Klinger
auf einer grofsen Leinwand mit dem Speer in der Hand ge-
malt hat — packt in ihrem Anblick den Künstler so, dafs
es ihn treibt und dafs er es als die Erfüllung seiner liebsten
Wünsche ansieht, „den schönen Leib in schönem Stein zu
bilden". Nun er sich, zum erstenmal als Bildhauer, an einen
bewegten männlichen Körper wagt, wählt er sogleich eine
Stellung, die in ihrer ungeheuren Anstrengung den Rumpf in
kraftvollster Beugung, die Glieder in sehniger Streckung zeigt,
alle Muskeln stahlhart wölbt und das Adergeflecht bis zum
Zerspringen füllt. Er zeigt das organische System nicht nur in
äufserster körperlicher Anspannung, sondern auch in heftiger
seelischer Erregung. Denn auch dieses Gebiet wird hier von
MAX KLINGER, THONMASKE DER AUFBLICKENDEN
VOM SOCKEL DES CHRISTUS IM OLYMP
Klinger als Bildhauer,
wenn wir von der
Kassandra absehen, zum
erstenmal beschritten.
Durch die Hinzufügung
des zarten sterbenden
Frauenleibes und die
Steigerung der Gestalten
über das natürliche Mafs
hinaus entsteht hier ein
ergreifendes Bild ent-
fesselter Leidenschaft.
Aus den grofsen Formen,
dem kräftigen Zusam-
menschlufs der Glieder
im Manneskürperspricht
dabei der gereifte Bild-
hauer. Und wenn uns
das Gefüge der Gruppe
als solcher in der gegebenen Ansicht lockerer erscheint, als
wir es sonst in den plastischen Schöpfungen Klingers ge-
wohnt sind, so schaut doch auch hier aus dem Flufs des
Gesamtumrisses das steinmäfsig geschlossene Ganze. An den
Schmalseiten vollends tritt die Plattenform des gewaltigen
Blockes schon deutlich hervor, der fern am Gestade von Paros
des Künstlers wartet.
Es ist auch hier kein leeres Formenspiel, das die Gruppe
so in geschlossenem Umrifs hinzustellen gebietet. Dieser
ist es vielmehr, der unserer Empfindung die Ruhe, dem
Werk inmitten der stürmenden Leidenschaften Gleichmafs
und Einheit wahrt; der den Eindruck erweckt, dafs hier
ein mächtiges Stück Menschenleben zu gesonderter und
dauernder Betrachtung herausgehoben wurde — als das
typische Drama. Wenn uns Klingers frühere plastische Ar-
beiten anmuten, wie Modell- und Marmorstudien auf dem
"Wege zum Stil, so ist hier der Stil da.
Klinger ist diesen Weg mit vollem Bewufstsein gegangen
und hat von ihm in seinem künstlerischen Selbstbekenntnis
klarste Rechenschaft gegeben. Für ihn ist der Mensch und
der menschliche Körper „Kern und Mittelpunkt aller Kunst";
in jedem aufstrebenden Stil sähen wir die strengste aufrich-
tigste Darstellung und Behandlung des Nackten. Die wunder-
bare Einfachheit des menschlichen Körpers, der strenge, nicht
abzuwerfende Zaum der Naturbedingungen dulde keine
Künstelei, zwinge den Künstler zur Einfachheit und zum
Abweisen von Zierrat, Nebenwerken und Effekten, fremden
Ideenassociationen und Tendenzen.
Man hört hier den Bildhauer sprechen, als der sich Klinger
jetzt fühlt. „Ich glaube selbst, dafs ich auf diesem Gebiete
noch etwas Gutes leisten kann", schreibt er gelegentlich in
Bezug auf seine Bildhauerei, und es wird schwerlich eine
Stimme geben, die nicht anerkennte, dafs ihm hier seine reif-
sten Werke gelungen sind. Um so mehr wird man ihm in
Bezug auf das, was er von der stilbildenden Kraft des Nackten-
studiums sagt, Recht geben, wenn man es auch auf die grofse,
die Monumentalkunst wird einschränken müssen.
Diese lebt in der That vom Nackten. Sie am wenigsten
kann auf „das Schönste, das wir uns überhaupt vorstellen
können", den nackten Menschenleib, verzichten wollen. Und
will sie die höchsten Ideen, von Zeit und Ort losgelöst dar-
C 34 I)