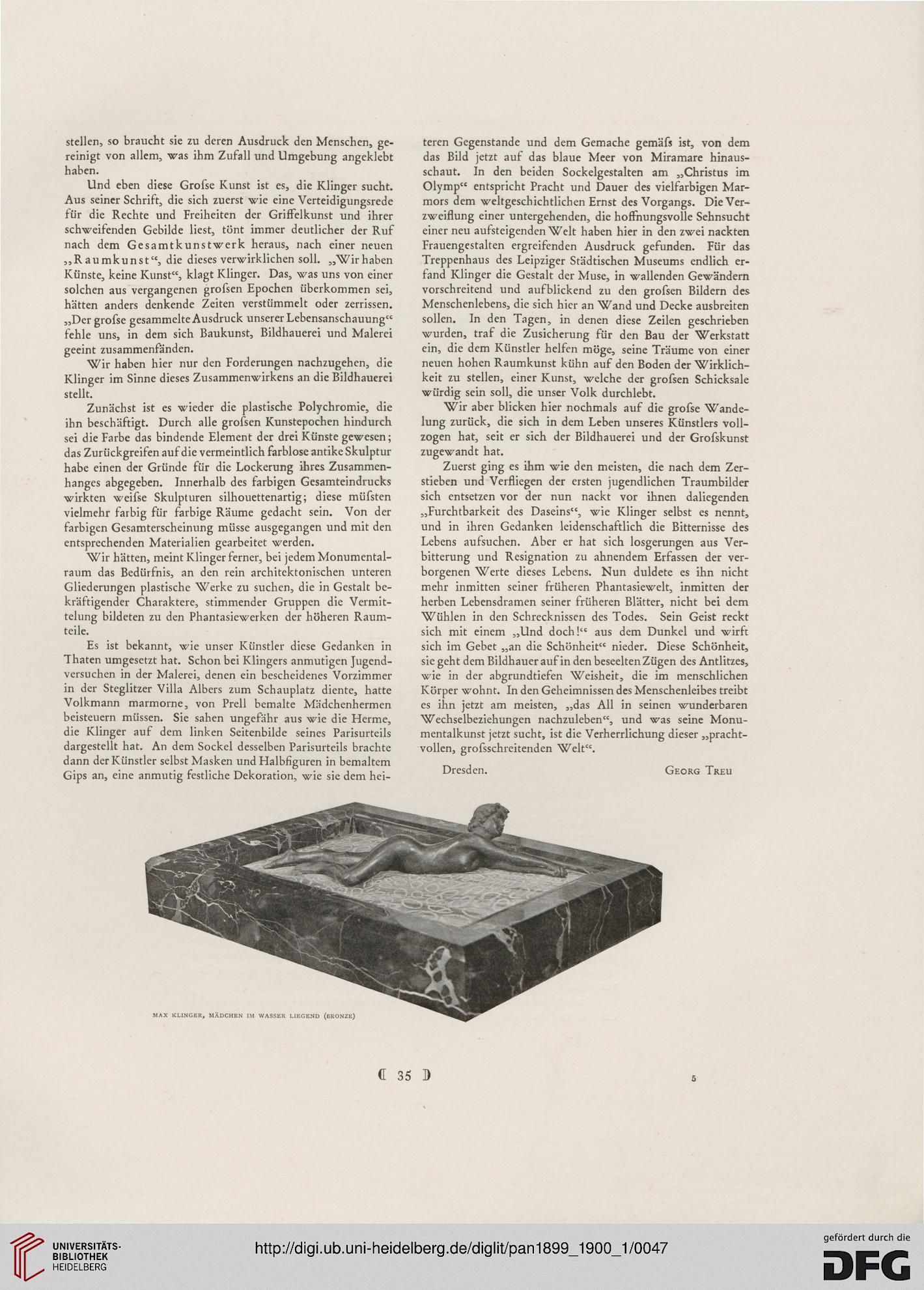stellen, so braucht sie zu deren Ausdruck den Menschen, ge-
reinigt von allem, was ihm Zufall und Umgebung angeklebt
haben.
Und eben diese Grofse Kunst ist es, die Klinger sucht.
Aus seiner Schrift, die sich zuerst wie eine Verteidigungsrede
für die Rechte und Freiheiten der GrifFelkunst und ihrer
schweifenden Gebilde liest, tönt immer deutlicher der Ruf
nach dem Gesamtkunstwerk heraus, nach einer neuen
„Raumkunst", die dieses verwirklichen soll. „Wirhaben
Künste, keine Kunst", klagt Klinger. Das, was uns von einer
solchen aus vergangenen grofsen Epochen überkommen sei,
hätten anders denkende Zeiten verstümmelt oder zerrissen.
„Der grofse gesammelte Ausdruck unserer Lebensanschauung"
fehle uns, in dem sich Baukunst, Bildhauerei und Malerei
geeint zusammenfänden.
Wir haben hier nur den Forderungen nachzugehen, die
Klinger im Sinne dieses Zusammenwirkens an die Bildhauerei
stellt.
Zunächst ist es wieder die plastische Polychromie, die
ihn beschäftigt. Durch alle grofsen Kunstepochen hindurch
sei die Farbe das bindende Element der drei Künste gewesen;
das Zurückgreifen auf die vermeintlich farblose antike Skulptur
habe einen der Gründe für die Lockerung ihres Zusammen-
hanges abgegeben. Innerhalb des farbigen Gesamteindrucks
wirkten weifse Skulpturen silhouettenartig; diese müfsten
vielmehr farbig für farbige Räume gedacht sein. Von der
farbigen Gesamterscheinung müsse ausgegangen und mit den
entsprechenden Materialien gearbeitet werden.
Wir hätten, meint Klinger ferner, bei jedem Monumental-
raum das Bedürfnis, an den rein architektonischen unteren
Gliederungen plastische Werke zu suchen, die in Gestalt be-
kräftigender Charaktere, stimmender Gruppen die Vermit-
telung bildeten zu den Phantasiewerken der höheren Raum-
teile.
Es ist bekannt, wie unser Künstler diese Gedanken in
Thaten umgesetzt hat. Schon bei Klingers anmutigen Jugend-
versuchen in der Malerei, denen ein bescheidenes Vorzimmer
in der Steglitzer Villa Albers zum Schauplatz diente, hatte
Volkmann marmorne, von Prell bemalte Mädchenhermen
beisteuern müssen. Sie sahen ungefähr aus wie die Herme,
die Klinger auf dem linken Seitenbilde seines Parisurteils
dargestellt hat. An dem Sockel desselben Parisurteils brachte
dann der Künstler selbst Masken und Halbfiguren in bemaltem
Gips an, eine anmutig festliche Dekoration, wie sie dem hei-
teren Gegenstande und dem Gemache gemäfs ist, von dem
das Bild jetzt auf das blaue Meer von Miramare hinaus-
schaut. In den beiden Sockelgestalten am „Christus im
Olymp" entspricht Pracht und Dauer des vielfarbigen Mar-
mors dem weltgeschichtlichen Ernst des Vorgangs. Die Ver-
zweiflung einer untergehenden, die hoffnungsvolle Sehnsucht
einer neu aufsteigenden Welt haben hier in den zwei nackten
Frauengestalten ergreifenden Ausdruck gefunden. Für das
Treppenhaus des Leipziger Städtischen Museums endlich er-
fand Klinger die Gestalt der Muse, in wallenden Gewändern
vorschreitend und aufblickend zu den grofsen Bildern des
Menschenlebens, die sich hier an Wand und Decke ausbreiten
sollen. In den Tagen, in denen diese Zeilen geschrieben
wurden, traf die Zusicherung für den Bau der Werkstatt
ein, die dem Künstler helfen möge, seine Träume von einer
neuen hohen Raumkunst kühn auf den Boden der Wirklich-
keit zu stellen, einer Kunst, welche der grofsen Schicksale
würdig sein soll, die unser Volk durchlebt.
Wir aber blicken hier nochmals auf die grofse Wande-
lung zurück, die sich in dem Leben unseres Künstlers voll-
zogen hat, seit er sich der Bildhauerei und der Grofskunst
zugewandt hat.
Zuerst ging es ihm wie den meisten, die nach dem Zer-
stieben und Verfliegen der ersten jugendlichen Traumbilder
sich entsetzen vor der nun nackt vor ihnen daliegenden
„Furchtbarkeit des Daseins", wie Klinger selbst es nennt,
und in ihren Gedanken leidenschaftlich die Bitternisse des
Lebens aufsuchen. Aber er hat sich losgerungen aus Ver-
bitterung und Resignation zu ahnendem Erfassen der ver-
borgenen Werte dieses Lebens. Nun duldete es ihn nicht
mehr inmitten seiner früheren Phantasiewelt, inmitten der
herben Lebensdramen seiner früheren Blätter, nicht bei dem
Wühlen in den Schrecknissen des Todes. Sein Geist reckt
sich mit einem „Und doch!" aus dem Dunkel und wirft
sich im Gebet „an die Schönheit" nieder. Diese Schönheit,
sie geht dem Bildhauer auf in den beseelten Zügen des Antlitzes,
wie in der abgrundtiefen Weisheit, die im menschlichen
Körper wohnt. In den Geheimnissen des Menschenleibes treibt
es ihn jetzt am meisten, „das All in seinen wunderbaren
Wechselbeziehungen nachzuleben", und was seine Monu-
mentalkunst jetzt sucht, ist die Verherrlichung dieser „pracht-
vollen, grofsschreitenden Welt".
Dresd
en.
Georg Treu
MAX KLINGER, MÄDCHEN IM WASSER LIEGEND (BRONZE)
C 35 3
reinigt von allem, was ihm Zufall und Umgebung angeklebt
haben.
Und eben diese Grofse Kunst ist es, die Klinger sucht.
Aus seiner Schrift, die sich zuerst wie eine Verteidigungsrede
für die Rechte und Freiheiten der GrifFelkunst und ihrer
schweifenden Gebilde liest, tönt immer deutlicher der Ruf
nach dem Gesamtkunstwerk heraus, nach einer neuen
„Raumkunst", die dieses verwirklichen soll. „Wirhaben
Künste, keine Kunst", klagt Klinger. Das, was uns von einer
solchen aus vergangenen grofsen Epochen überkommen sei,
hätten anders denkende Zeiten verstümmelt oder zerrissen.
„Der grofse gesammelte Ausdruck unserer Lebensanschauung"
fehle uns, in dem sich Baukunst, Bildhauerei und Malerei
geeint zusammenfänden.
Wir haben hier nur den Forderungen nachzugehen, die
Klinger im Sinne dieses Zusammenwirkens an die Bildhauerei
stellt.
Zunächst ist es wieder die plastische Polychromie, die
ihn beschäftigt. Durch alle grofsen Kunstepochen hindurch
sei die Farbe das bindende Element der drei Künste gewesen;
das Zurückgreifen auf die vermeintlich farblose antike Skulptur
habe einen der Gründe für die Lockerung ihres Zusammen-
hanges abgegeben. Innerhalb des farbigen Gesamteindrucks
wirkten weifse Skulpturen silhouettenartig; diese müfsten
vielmehr farbig für farbige Räume gedacht sein. Von der
farbigen Gesamterscheinung müsse ausgegangen und mit den
entsprechenden Materialien gearbeitet werden.
Wir hätten, meint Klinger ferner, bei jedem Monumental-
raum das Bedürfnis, an den rein architektonischen unteren
Gliederungen plastische Werke zu suchen, die in Gestalt be-
kräftigender Charaktere, stimmender Gruppen die Vermit-
telung bildeten zu den Phantasiewerken der höheren Raum-
teile.
Es ist bekannt, wie unser Künstler diese Gedanken in
Thaten umgesetzt hat. Schon bei Klingers anmutigen Jugend-
versuchen in der Malerei, denen ein bescheidenes Vorzimmer
in der Steglitzer Villa Albers zum Schauplatz diente, hatte
Volkmann marmorne, von Prell bemalte Mädchenhermen
beisteuern müssen. Sie sahen ungefähr aus wie die Herme,
die Klinger auf dem linken Seitenbilde seines Parisurteils
dargestellt hat. An dem Sockel desselben Parisurteils brachte
dann der Künstler selbst Masken und Halbfiguren in bemaltem
Gips an, eine anmutig festliche Dekoration, wie sie dem hei-
teren Gegenstande und dem Gemache gemäfs ist, von dem
das Bild jetzt auf das blaue Meer von Miramare hinaus-
schaut. In den beiden Sockelgestalten am „Christus im
Olymp" entspricht Pracht und Dauer des vielfarbigen Mar-
mors dem weltgeschichtlichen Ernst des Vorgangs. Die Ver-
zweiflung einer untergehenden, die hoffnungsvolle Sehnsucht
einer neu aufsteigenden Welt haben hier in den zwei nackten
Frauengestalten ergreifenden Ausdruck gefunden. Für das
Treppenhaus des Leipziger Städtischen Museums endlich er-
fand Klinger die Gestalt der Muse, in wallenden Gewändern
vorschreitend und aufblickend zu den grofsen Bildern des
Menschenlebens, die sich hier an Wand und Decke ausbreiten
sollen. In den Tagen, in denen diese Zeilen geschrieben
wurden, traf die Zusicherung für den Bau der Werkstatt
ein, die dem Künstler helfen möge, seine Träume von einer
neuen hohen Raumkunst kühn auf den Boden der Wirklich-
keit zu stellen, einer Kunst, welche der grofsen Schicksale
würdig sein soll, die unser Volk durchlebt.
Wir aber blicken hier nochmals auf die grofse Wande-
lung zurück, die sich in dem Leben unseres Künstlers voll-
zogen hat, seit er sich der Bildhauerei und der Grofskunst
zugewandt hat.
Zuerst ging es ihm wie den meisten, die nach dem Zer-
stieben und Verfliegen der ersten jugendlichen Traumbilder
sich entsetzen vor der nun nackt vor ihnen daliegenden
„Furchtbarkeit des Daseins", wie Klinger selbst es nennt,
und in ihren Gedanken leidenschaftlich die Bitternisse des
Lebens aufsuchen. Aber er hat sich losgerungen aus Ver-
bitterung und Resignation zu ahnendem Erfassen der ver-
borgenen Werte dieses Lebens. Nun duldete es ihn nicht
mehr inmitten seiner früheren Phantasiewelt, inmitten der
herben Lebensdramen seiner früheren Blätter, nicht bei dem
Wühlen in den Schrecknissen des Todes. Sein Geist reckt
sich mit einem „Und doch!" aus dem Dunkel und wirft
sich im Gebet „an die Schönheit" nieder. Diese Schönheit,
sie geht dem Bildhauer auf in den beseelten Zügen des Antlitzes,
wie in der abgrundtiefen Weisheit, die im menschlichen
Körper wohnt. In den Geheimnissen des Menschenleibes treibt
es ihn jetzt am meisten, „das All in seinen wunderbaren
Wechselbeziehungen nachzuleben", und was seine Monu-
mentalkunst jetzt sucht, ist die Verherrlichung dieser „pracht-
vollen, grofsschreitenden Welt".
Dresd
en.
Georg Treu
MAX KLINGER, MÄDCHEN IM WASSER LIEGEND (BRONZE)
C 35 3