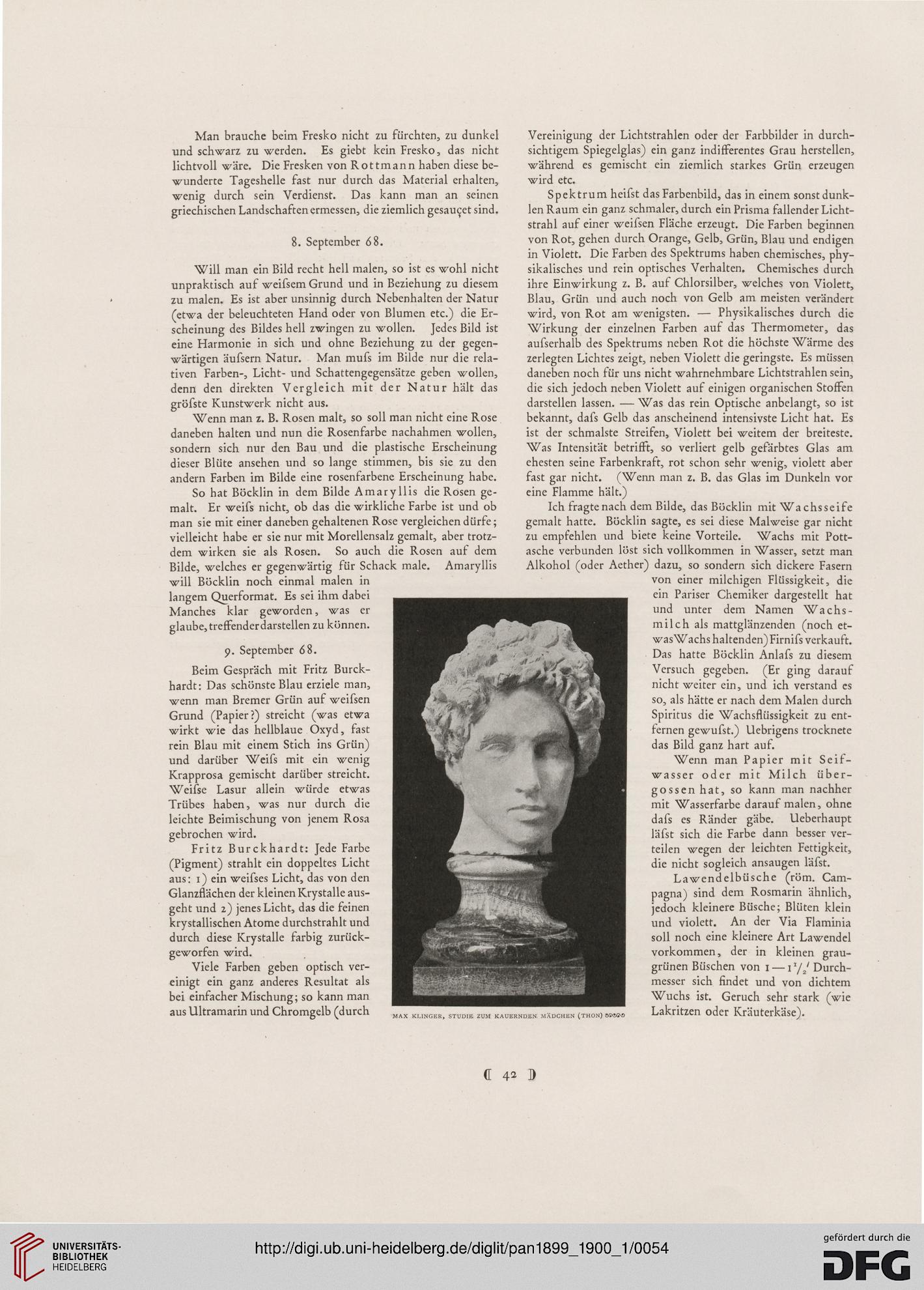Man brauche beim Fresko nicht zu fürchten, zu dunkel
und schwarz zu werden. Es giebt kein Fresko, das nicht
lichtvoll wäre. Die Fresken von Rottmann haben diese be-
wunderte Tageshelle fast nur durch das Material erhalten,
wenig durch sein Verdienst. Das kann man an seinen
griechischen Landschaften ermessen, die ziemlich gesaucet sind.
8. September 68.
Will man ein Bild recht hell malen, so ist es wohl nicht
unpraktisch auf weifsem Grund und in Beziehung zu diesem
zu malen. Es ist aber unsinnig durch Nebenhalten der Natur
(etwa der beleuchteten Hand oder von Blumen etc.) die Er-
scheinung des Bildes hell zwingen zu wollen. Jedes Bild ist
eine Harmonie in sich und ohne Beziehung zu der gegen-
wärtigen äufsern Natur. Man mufs im Bilde nur die rela-
tiven Farben-, Licht- und Schattengegensätze geben wollen,
denn den direkten Vergleich mit der Natur hält das
gröfste Kunstwerk nicht aus.
Wenn man z. B. Rosen malt, so soll man nicht eine Rose
daneben halten und nun die Rosenfarbe nachahmen wollen,
sondern sich nur den Bau und die plastische Erscheinung
dieser Blüte ansehen und so lange stimmen, bis sie zu den
andern Farben im Bilde eine rosenfarbene Erscheinung habe.
So hat Böcklin in dem Bilde Amaryllis die Rosen ge-
malt. Er weifs nicht, ob das die wirkliche Farbe ist und ob
man sie mir einer daneben gehaltenen Rose vergleichen dürfe;
vielleicht habe er sie nur mit Morellensalz gemalt, aber trotz-
dem wirken sie als Rosen. So auch die Rosen auf dem
Bilde, welches er gegenwärtig für Schack male. Amaryllis
will Böcklin noch einmal malen in
langem Querformat. Es sei ihm dabei
Manches klar geworden, was er
glaube, treffender darstellen zu können.
9. September 68.
Beim Gespräch mit Fritz Burck-
hardt: Das schönste Blau erziele man,
wenn man Bremer Grün auf weifsen
Grund (Papier?) streicht (was etwa
wirkt wie das hellblaue Oxyd, fast
rein Blau mit einem Stich ins Grün)
und darüber Weifs mit ein wenig
Krapprosa gemischt darüber streicht.
Weifse Lasur allein würde etwas
Trübes haben, was nur durch die
leichte Beimischung von jenem Rosa
gebrochen wird.
Fritz Burckhardt: Jede Farbe
(Pigment) strahlt ein doppeltes Licht
aus: 1) ein weifses Licht, das von den
Glanzflächen der kleinen Krystalle aus-
geht und 2) jenes Licht, das die feinen
krystallischen Atome durchstrahlt und
durch diese Krystalle farbig zurück-
geworfen wird.
Viele Farben geben optisch ver-
einigt ein ganz anderes Resultat als
bei einfacher Mischung; so kann man
aus Ultramarin und Chromgelb (durch
MAX KUNGER, STUDIE ZUM KAUERNDEN MÄDCHEN (THON) Zß&ZO
Vereinigung der Lichtstrahlen oder der Farbbilder in durch-
sichtigem Spiegelglas) ein ganz indifferentes Grau herstellen,
während es gemischt ein ziemlich starkes Grün erzeugen
wird etc.
Spektrum heifst das Farbenbild, das in einem sonst dunk-
len Raum ein ganz schmaler, durch ein Prisma fallender Licht-
strahl auf einer weifsen Fläche erzeugt. Die Farben beginnen
von Rot, gehen durch Orange, Gelb, Grün, Blau und endigen
in Violett. Die Farben des Spektrums haben chemisches, phy-
sikalisches und rein optisches Verhalten. Chemisches durch
ihre Einwirkung z. B. auf Chlorsilber, welches von Violett,
Blau, Grün und auch noch von Gelb am meisten verändert
wird, von Rot am wenigsten. — Physikalisches durch die
Wirkung der einzelnen Farben auf das Thermometer, das
aufserhalb des Spektrums neben Rot die höchste Wärme des
zerlegten Lichtes zeigt, neben Violett die geringste. Es müssen
daneben noch für uns nicht wahrnehmbare Lichtstrahlen sein,
die sich jedoch neben Violett auf einigen organischen Stoffen
darstellen lassen. — Was das rein Optische anbelangt, so ist
bekannt, dafs Gelb das anscheinend intensivste Licht hat. Es
ist der schmälste Streifen, Violett bei weitem der breiteste.
Was Intensität betrifft, so verliert gelb gefärbtes Glas am
ehesten seine Farbenkraft, rot schon sehr wenig, violett aber
fast gar nicht. (Wenn man z. B. das Glas im Dunkeln vor
eine Flamme hält.)
Ich fragte nach dem Bilde, das Böcklin mit Wachsseife
gemalt hatte. Böcklin sagte, es sei diese Malweise gar nicht
zu empfehlen und biete keine Vorteile. Wachs mit Pott-
asche verbunden löst sich vollkommen in Wasser, setzt man
Alkohol (oder Aether) dazu, so sondern sich dickere Fasern
von einer milchigen Flüssigkeit, die
ein Pariser Chemiker dargestellt hat
und unter dem Namen Wachs-
milch als mattglänzenden (noch et-
wasWachs haltenden) Firnifs verkauft.
Das hatte Böcklin Anlafs zu diesem
Versuch gegeben. (Er ging darauf
nicht weiter ein, und ich verstand es
so, als hätte er nach dem Malen durch
Spiritus die Wachsflüssigkeit zu ent-
fernen gewufst.) Uebrigens trocknete
das Bild ganz hart auf.
Wenn man Papier mit Seif-
wasser oder mit Milch über-
gössen hat, so kann man nachher
mit Wasserfarbe daraufmalen, ohne
dafs es Ränder gäbe. Ueberhaupt
läfst sich die Farbe dann besser ver-
teilen wegen der leichten Fettigkeit,
die nicht sogleich ansaugen läfst.
Lawendelbüsche (röm. Cam-
pagna) sind dem Rosmarin ähnlich,
jedoch kleinere Büsche; Blüten klein
und violett. An der Via Flaminia
soll noch eine kleinere Art Lawendel
vorkommen, der in kleinen grau-
grünen Büschen von 1 — 1X/J Durch-
messer sich findet und von dichtem
Wuchs ist. Geruch sehr stark (wie
Lakritzen oder Kräuterkäse).
C 42 i
und schwarz zu werden. Es giebt kein Fresko, das nicht
lichtvoll wäre. Die Fresken von Rottmann haben diese be-
wunderte Tageshelle fast nur durch das Material erhalten,
wenig durch sein Verdienst. Das kann man an seinen
griechischen Landschaften ermessen, die ziemlich gesaucet sind.
8. September 68.
Will man ein Bild recht hell malen, so ist es wohl nicht
unpraktisch auf weifsem Grund und in Beziehung zu diesem
zu malen. Es ist aber unsinnig durch Nebenhalten der Natur
(etwa der beleuchteten Hand oder von Blumen etc.) die Er-
scheinung des Bildes hell zwingen zu wollen. Jedes Bild ist
eine Harmonie in sich und ohne Beziehung zu der gegen-
wärtigen äufsern Natur. Man mufs im Bilde nur die rela-
tiven Farben-, Licht- und Schattengegensätze geben wollen,
denn den direkten Vergleich mit der Natur hält das
gröfste Kunstwerk nicht aus.
Wenn man z. B. Rosen malt, so soll man nicht eine Rose
daneben halten und nun die Rosenfarbe nachahmen wollen,
sondern sich nur den Bau und die plastische Erscheinung
dieser Blüte ansehen und so lange stimmen, bis sie zu den
andern Farben im Bilde eine rosenfarbene Erscheinung habe.
So hat Böcklin in dem Bilde Amaryllis die Rosen ge-
malt. Er weifs nicht, ob das die wirkliche Farbe ist und ob
man sie mir einer daneben gehaltenen Rose vergleichen dürfe;
vielleicht habe er sie nur mit Morellensalz gemalt, aber trotz-
dem wirken sie als Rosen. So auch die Rosen auf dem
Bilde, welches er gegenwärtig für Schack male. Amaryllis
will Böcklin noch einmal malen in
langem Querformat. Es sei ihm dabei
Manches klar geworden, was er
glaube, treffender darstellen zu können.
9. September 68.
Beim Gespräch mit Fritz Burck-
hardt: Das schönste Blau erziele man,
wenn man Bremer Grün auf weifsen
Grund (Papier?) streicht (was etwa
wirkt wie das hellblaue Oxyd, fast
rein Blau mit einem Stich ins Grün)
und darüber Weifs mit ein wenig
Krapprosa gemischt darüber streicht.
Weifse Lasur allein würde etwas
Trübes haben, was nur durch die
leichte Beimischung von jenem Rosa
gebrochen wird.
Fritz Burckhardt: Jede Farbe
(Pigment) strahlt ein doppeltes Licht
aus: 1) ein weifses Licht, das von den
Glanzflächen der kleinen Krystalle aus-
geht und 2) jenes Licht, das die feinen
krystallischen Atome durchstrahlt und
durch diese Krystalle farbig zurück-
geworfen wird.
Viele Farben geben optisch ver-
einigt ein ganz anderes Resultat als
bei einfacher Mischung; so kann man
aus Ultramarin und Chromgelb (durch
MAX KUNGER, STUDIE ZUM KAUERNDEN MÄDCHEN (THON) Zß&ZO
Vereinigung der Lichtstrahlen oder der Farbbilder in durch-
sichtigem Spiegelglas) ein ganz indifferentes Grau herstellen,
während es gemischt ein ziemlich starkes Grün erzeugen
wird etc.
Spektrum heifst das Farbenbild, das in einem sonst dunk-
len Raum ein ganz schmaler, durch ein Prisma fallender Licht-
strahl auf einer weifsen Fläche erzeugt. Die Farben beginnen
von Rot, gehen durch Orange, Gelb, Grün, Blau und endigen
in Violett. Die Farben des Spektrums haben chemisches, phy-
sikalisches und rein optisches Verhalten. Chemisches durch
ihre Einwirkung z. B. auf Chlorsilber, welches von Violett,
Blau, Grün und auch noch von Gelb am meisten verändert
wird, von Rot am wenigsten. — Physikalisches durch die
Wirkung der einzelnen Farben auf das Thermometer, das
aufserhalb des Spektrums neben Rot die höchste Wärme des
zerlegten Lichtes zeigt, neben Violett die geringste. Es müssen
daneben noch für uns nicht wahrnehmbare Lichtstrahlen sein,
die sich jedoch neben Violett auf einigen organischen Stoffen
darstellen lassen. — Was das rein Optische anbelangt, so ist
bekannt, dafs Gelb das anscheinend intensivste Licht hat. Es
ist der schmälste Streifen, Violett bei weitem der breiteste.
Was Intensität betrifft, so verliert gelb gefärbtes Glas am
ehesten seine Farbenkraft, rot schon sehr wenig, violett aber
fast gar nicht. (Wenn man z. B. das Glas im Dunkeln vor
eine Flamme hält.)
Ich fragte nach dem Bilde, das Böcklin mit Wachsseife
gemalt hatte. Böcklin sagte, es sei diese Malweise gar nicht
zu empfehlen und biete keine Vorteile. Wachs mit Pott-
asche verbunden löst sich vollkommen in Wasser, setzt man
Alkohol (oder Aether) dazu, so sondern sich dickere Fasern
von einer milchigen Flüssigkeit, die
ein Pariser Chemiker dargestellt hat
und unter dem Namen Wachs-
milch als mattglänzenden (noch et-
wasWachs haltenden) Firnifs verkauft.
Das hatte Böcklin Anlafs zu diesem
Versuch gegeben. (Er ging darauf
nicht weiter ein, und ich verstand es
so, als hätte er nach dem Malen durch
Spiritus die Wachsflüssigkeit zu ent-
fernen gewufst.) Uebrigens trocknete
das Bild ganz hart auf.
Wenn man Papier mit Seif-
wasser oder mit Milch über-
gössen hat, so kann man nachher
mit Wasserfarbe daraufmalen, ohne
dafs es Ränder gäbe. Ueberhaupt
läfst sich die Farbe dann besser ver-
teilen wegen der leichten Fettigkeit,
die nicht sogleich ansaugen läfst.
Lawendelbüsche (röm. Cam-
pagna) sind dem Rosmarin ähnlich,
jedoch kleinere Büsche; Blüten klein
und violett. An der Via Flaminia
soll noch eine kleinere Art Lawendel
vorkommen, der in kleinen grau-
grünen Büschen von 1 — 1X/J Durch-
messer sich findet und von dichtem
Wuchs ist. Geruch sehr stark (wie
Lakritzen oder Kräuterkäse).
C 42 i