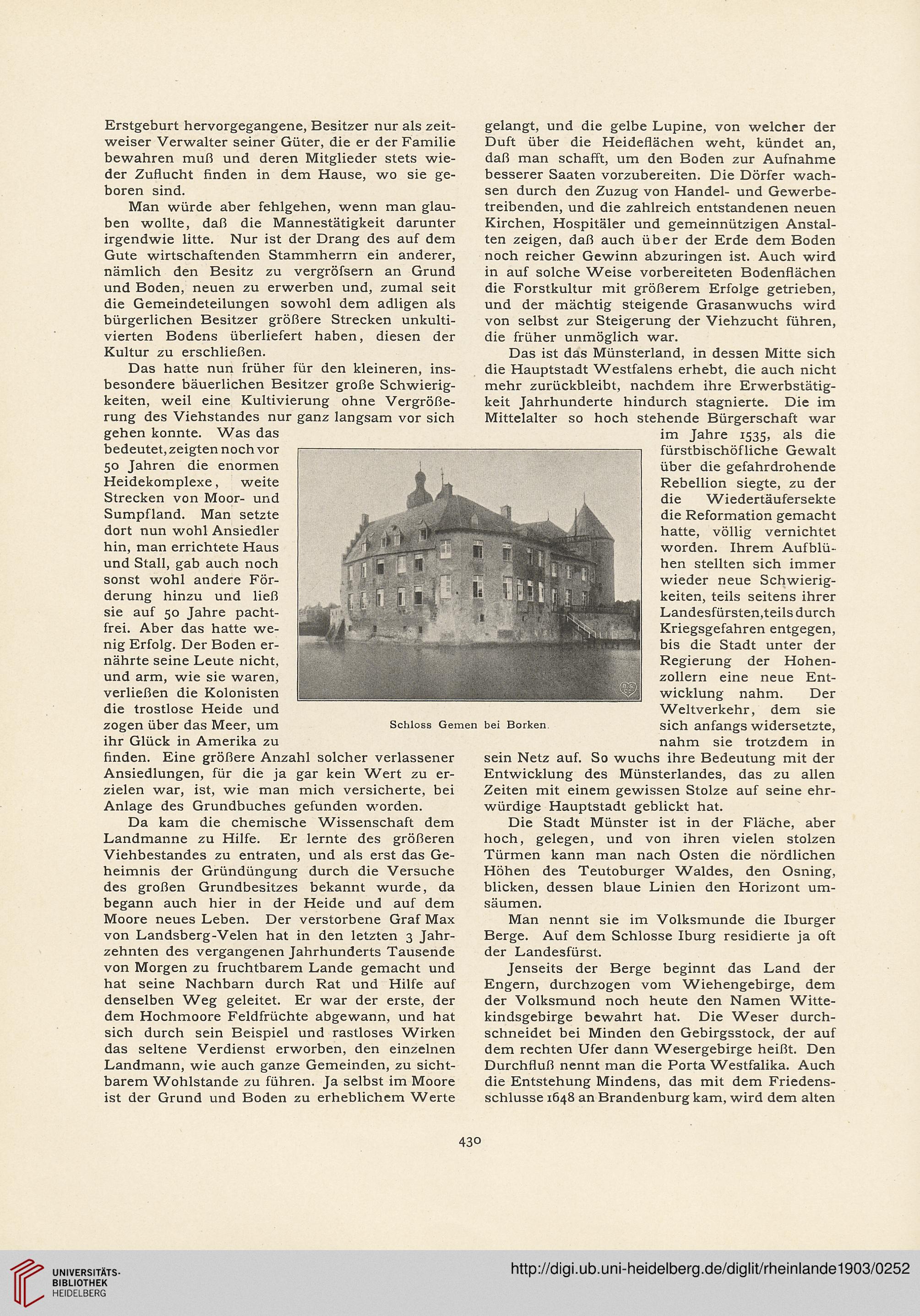Erstgeburt hervorgegangene, Besitzer nur als zeit-
weiser Verwalter seiner Güter, die er der Familie
bewahren muß und deren Mitglieder stets wie-
der Zussucht finden in dem Hause, wo sie ge-
boren sind.
Man würde aber fehlgehen, wenn man glau-
ben wollte, daß die Mannestätigkeit darunter
irgendwie litte. Nur ist der Drang des auf dem
Gute wirtschaftenden Stammherrn ein anderer,
nämlich den Besitz zu vergrössern an Grund
und Boden, neuen zu erwerben und, zumal seit
die Gemeindeteilungen sowohl dem adligen als
bürgerlichen Besitzer größere Strecken unkulti-
vierten Bodens überliefert haben, diesen der
Kultur zu erschließen.
Das hatte nun früher für den kleineren, ins-
besondere bäuerlichen Besitzer große Schwierig-
keiten, weil eine Kultivierung ohne Vergröße-
rung des Viehstandes nur ganz langsam vor sich
gehen konnte. Was das
bedeutet, zeigten noch vor
50 Jahren die enormen
Heidekomplexe, weite
Strecken von Moor- und
Sumpfland. Man setzte
dort nun wohl Ansiedler
hin, man errichtete Haus
und Stall, gab auch noch
sonst wohl andere För-
derung hinzu und ließ
sie auf 50 Jahre pacht-
frei. Aber das hatte we-
nig Ersolg. Der Boden er-
nährte seine Leute nicht,
und arm, wie sie waren,
verließen die Kolonisten
die trostlose Heide und
zogen über das Meer, um
ihr Glück in Amerika zu
finden. Eine größere Anzahl solcher verlassener
Ansiedlungen, für die ja gar kein Wert zu er-
zielen war, ist, wie man mich versicherte, bei
Anlage des Grundbuches gefunden worden.
Da kam die chemische Wissenschaft dem
Landmanne zu Hilfe. Er lernte des größeren
Viehbestandes zu entraten, und als erst das Ge-
heimnis der Gründüngung durch die Versuche
des großen Grundbesitzes bekannt wurde, da
begann auch hier in der Heide und auf dem
Moore neues Leben. Der verstorbene Graf Max
von Landsberg-Velen hat in den letzten 3 Jahr-
zehnten des vergangenen Jahrhunderts Tausende
von Morgen zu fruchtbarem Lande gemacht und
hat seine Nachbarn durch Rat und Hilfe auf
denselben Weg geleitet. Er war der erste, der
dem Hochmoore Feldfrüchte abgewann, und hat
sich durch sein Beispiel und rastloses Wirken
das seltene Verdienst erworben, den einzelnen
Landmann, wie auch ganze Gemeinden, zu sicht-
barem Wohlstände zu führen. Ja selbst im Moore
ist der Grund und Boden zu erheblichem Werte
gelangt, und die gelbe Lupine, von welcher der
Duft über die Heidessächen weht, kündet an,
daß man schafft, um den Boden zur Aufnahme
besserer Saaten vorzubereiten. Die Dörfer wach-
sen durch den Zuzug von Handel- und Gewerbe-
treibenden, und die zahlreich entstandenen neuen
Kirchen, Hospitäler und gemeinnützigen Anstal-
ten zeigen, daß auch über der Erde dem Boden
noch reicher Gewinn abzuringen ist. Auch wird
in auf solche Weise vorbereiteten Bodenssächen
die Forstkultur mit größerem Erfolge getrieben,
und der mächtig steigende Grasanwuchs wird
von selbst zur Steigerung der Viehzucht führen,
die früher unmöglich war.
Das ist das Münsterland, in dessen Mitte sich
die Hauptstadt Westfalens erhebt, die auch nicht
mehr zurückbleibt, nachdem ihre Erwerbstätig-
keit Jahrhunderte hindurch stagnierte. Die im
Mittelalter so hoch stehende Bürgerschaft war
im Jahre 1535, als die
fürstbischöfliche Gewalt
über die gefahrdrohende
Rebellion siegte, zu der
die Wiedertäufersekte
die Reformation gemacht
hatte, völlig vernichtet
worden. Ihrem Aufblü-
hen stellten sich immer
wieder neue Schwierig-
keiten, teils seitens ihrer
Landesfürsten,teils durch
Kriegsgefahren entgegen,
bis die Stadt unter der
Regierung der Hohen-
zollern eine neue Ent-
wicklung nahm. Der
Weltverkehr, dem sie
sich anfangs widersetzte,
nahm sie trotzdem in
sein Netz auf. So wuchs ihre Bedeutung mit der
Entwicklung des Münsterlandes, das zu allen
Zeiten mit einem gewissen Stolze auf seine ehr-
würdige Hauptstadt geblickt hat.
Die Stadt Münster ist in der Fläche, aber
hoch, gelegen, und von ihren vielen stolzen
Türmen kann man nach Osten die nördlichen
Höhen des Teutoburger Waldes, den Osning,
blicken, dessen blaue Linien den Horizont um-
säumen.
Man nennt sie im Volksmunde die Iburger
Berge. Auf dem Schlosse Iburg residierte ja oft
der Landesfürst.
Jenseits der Berge beginnt das Land der
Engern, durchzogen vom Wiehengebirge, dem
der Volksmund noch heute den Namen Witte-
kindsgebirge bewahrt hat. Die Weser durch-
schneidet bei Minden den Gebirgsstock, der auf
dem rechten Ufer dann Wesergebirge heißt. Den
Durchssuß nennt man die Porta Westfalika. Auch
die Entstehung Mindens, das mit dem Friedens-
schlüsse 1648 an Brandenburg kam, wird dem alten
Schloss Gemen bei Borken.
430
weiser Verwalter seiner Güter, die er der Familie
bewahren muß und deren Mitglieder stets wie-
der Zussucht finden in dem Hause, wo sie ge-
boren sind.
Man würde aber fehlgehen, wenn man glau-
ben wollte, daß die Mannestätigkeit darunter
irgendwie litte. Nur ist der Drang des auf dem
Gute wirtschaftenden Stammherrn ein anderer,
nämlich den Besitz zu vergrössern an Grund
und Boden, neuen zu erwerben und, zumal seit
die Gemeindeteilungen sowohl dem adligen als
bürgerlichen Besitzer größere Strecken unkulti-
vierten Bodens überliefert haben, diesen der
Kultur zu erschließen.
Das hatte nun früher für den kleineren, ins-
besondere bäuerlichen Besitzer große Schwierig-
keiten, weil eine Kultivierung ohne Vergröße-
rung des Viehstandes nur ganz langsam vor sich
gehen konnte. Was das
bedeutet, zeigten noch vor
50 Jahren die enormen
Heidekomplexe, weite
Strecken von Moor- und
Sumpfland. Man setzte
dort nun wohl Ansiedler
hin, man errichtete Haus
und Stall, gab auch noch
sonst wohl andere För-
derung hinzu und ließ
sie auf 50 Jahre pacht-
frei. Aber das hatte we-
nig Ersolg. Der Boden er-
nährte seine Leute nicht,
und arm, wie sie waren,
verließen die Kolonisten
die trostlose Heide und
zogen über das Meer, um
ihr Glück in Amerika zu
finden. Eine größere Anzahl solcher verlassener
Ansiedlungen, für die ja gar kein Wert zu er-
zielen war, ist, wie man mich versicherte, bei
Anlage des Grundbuches gefunden worden.
Da kam die chemische Wissenschaft dem
Landmanne zu Hilfe. Er lernte des größeren
Viehbestandes zu entraten, und als erst das Ge-
heimnis der Gründüngung durch die Versuche
des großen Grundbesitzes bekannt wurde, da
begann auch hier in der Heide und auf dem
Moore neues Leben. Der verstorbene Graf Max
von Landsberg-Velen hat in den letzten 3 Jahr-
zehnten des vergangenen Jahrhunderts Tausende
von Morgen zu fruchtbarem Lande gemacht und
hat seine Nachbarn durch Rat und Hilfe auf
denselben Weg geleitet. Er war der erste, der
dem Hochmoore Feldfrüchte abgewann, und hat
sich durch sein Beispiel und rastloses Wirken
das seltene Verdienst erworben, den einzelnen
Landmann, wie auch ganze Gemeinden, zu sicht-
barem Wohlstände zu führen. Ja selbst im Moore
ist der Grund und Boden zu erheblichem Werte
gelangt, und die gelbe Lupine, von welcher der
Duft über die Heidessächen weht, kündet an,
daß man schafft, um den Boden zur Aufnahme
besserer Saaten vorzubereiten. Die Dörfer wach-
sen durch den Zuzug von Handel- und Gewerbe-
treibenden, und die zahlreich entstandenen neuen
Kirchen, Hospitäler und gemeinnützigen Anstal-
ten zeigen, daß auch über der Erde dem Boden
noch reicher Gewinn abzuringen ist. Auch wird
in auf solche Weise vorbereiteten Bodenssächen
die Forstkultur mit größerem Erfolge getrieben,
und der mächtig steigende Grasanwuchs wird
von selbst zur Steigerung der Viehzucht führen,
die früher unmöglich war.
Das ist das Münsterland, in dessen Mitte sich
die Hauptstadt Westfalens erhebt, die auch nicht
mehr zurückbleibt, nachdem ihre Erwerbstätig-
keit Jahrhunderte hindurch stagnierte. Die im
Mittelalter so hoch stehende Bürgerschaft war
im Jahre 1535, als die
fürstbischöfliche Gewalt
über die gefahrdrohende
Rebellion siegte, zu der
die Wiedertäufersekte
die Reformation gemacht
hatte, völlig vernichtet
worden. Ihrem Aufblü-
hen stellten sich immer
wieder neue Schwierig-
keiten, teils seitens ihrer
Landesfürsten,teils durch
Kriegsgefahren entgegen,
bis die Stadt unter der
Regierung der Hohen-
zollern eine neue Ent-
wicklung nahm. Der
Weltverkehr, dem sie
sich anfangs widersetzte,
nahm sie trotzdem in
sein Netz auf. So wuchs ihre Bedeutung mit der
Entwicklung des Münsterlandes, das zu allen
Zeiten mit einem gewissen Stolze auf seine ehr-
würdige Hauptstadt geblickt hat.
Die Stadt Münster ist in der Fläche, aber
hoch, gelegen, und von ihren vielen stolzen
Türmen kann man nach Osten die nördlichen
Höhen des Teutoburger Waldes, den Osning,
blicken, dessen blaue Linien den Horizont um-
säumen.
Man nennt sie im Volksmunde die Iburger
Berge. Auf dem Schlosse Iburg residierte ja oft
der Landesfürst.
Jenseits der Berge beginnt das Land der
Engern, durchzogen vom Wiehengebirge, dem
der Volksmund noch heute den Namen Witte-
kindsgebirge bewahrt hat. Die Weser durch-
schneidet bei Minden den Gebirgsstock, der auf
dem rechten Ufer dann Wesergebirge heißt. Den
Durchssuß nennt man die Porta Westfalika. Auch
die Entstehung Mindens, das mit dem Friedens-
schlüsse 1648 an Brandenburg kam, wird dem alten
Schloss Gemen bei Borken.
430