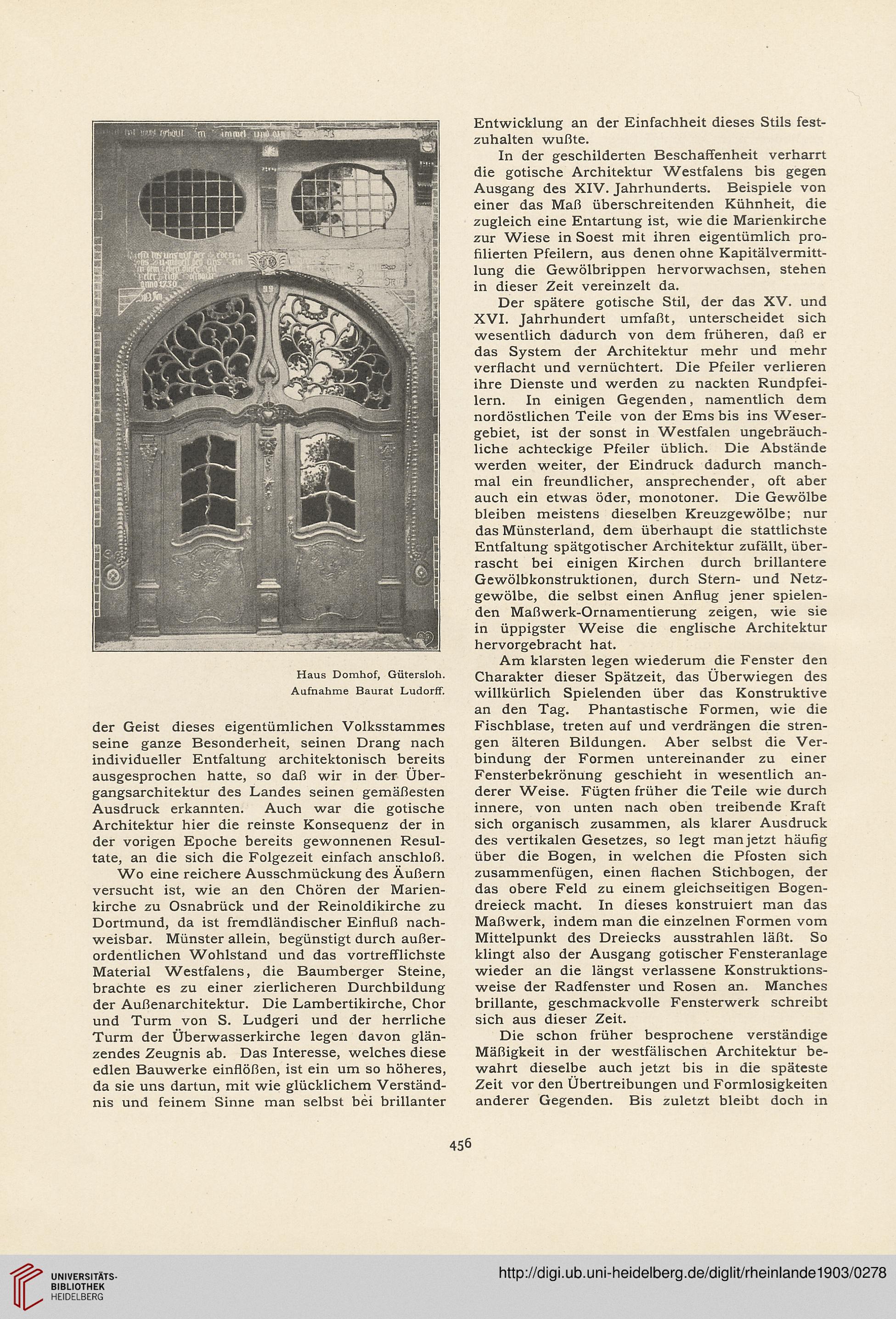Haus Domhof, Gütersloh.
Aufnahme Baurat Ludorff.
der Geist dieses eigentümlichen Volksstammes
seine ganze Besonderheit, seinen Drang nach
individueller Entfaltung architektonisch bereits
ausgesprochen hatte, so daß wir in der Über-
gangsarchitektur des Landes seinen gemäßesten
Ausdruck erkannten. Auch war die gotische
Architektur hier die reinste Konsequenz der in
der vorigen Epoche bereits gewonnenen Resul-
tate, an die sich die Folgezeit einfach anschloß.
Wo eine reichere Ausschmückung des Äußern
versucht ist, wie an den Chören der Marien-
kirche zu Osnabrück und der Reinoldikirche zu
Dortmund, da ist fremdländischer Einssuß nach-
weisbar. Münster allein, begünstigt durch außer-
ordentlichen Wohlstand und das vortrefflichste
Material Westfalens, die Baumberger Steine,
brachte es zu einer zierlicheren Durchbildung
der Außenarchitektur. Die Lambertikirche, Chor
und Turm von S. Ludgeri und der herrliche
Turm der Überwasserkirche legen davon glän-
zendes Zeugnis ab. Das Interesse, welches diese
edlen Bauwerke einssößen, ist ein um so höheres,
da sie uns dartun, mit wie glücklichem Verständ-
nis und feinem Sinne man selbst bei brillanter
Entwicklung an der Einfachheit dieses Stils fest-
zuhalten wußte.
In der geschilderten Beschaffenheit verharrt
die gotische Architektur Westfalens bis gegen
Ausgang des XIV. Jahrhunderts. Beispiele von
einer das Maß überschreitenden Kühnheit, die
zugleich eine Entartung ist, wie die Marienkirche
zur Wiese in Soest mit ihren eigentümlich pro-
filierten Pfeilern, aus denen ohne Kapitälvermitt-
lung die Gewölbrippen hervorwachsen, stehen
in dieser Zeit vereinzelt da.
Der spätere gotische Stil, der das XV. und
XVI. Jahrhundert umfaßt, unterscheidet sich
wesentlich dadurch von dem früheren, daß er
das System der Architektur mehr und mehr
verssacht und vernüchtert. Die Pfeiler verlieren
ihre Dienste und werden zu nackten Rundpfei-
lern. In einigen Gegenden, namentlich dem
nordöstlichen Teile von der Ems bis ins Weser-
gebiet, ist der sonst in Westfalen ungebräuch-
liche achteckige Pfeiler üblich. Die Abstände
werden weiter, der Eindruck dadurch manch-
mal ein freundlicher, ansprechender, oft aber
auch ein etwas öder, monotoner. Die Gewölbe
bleiben meistens dieselben Kreuzgewölbe; nur
das Münsterland, dem überhaupt die stattlichste
Entsaltung spätgotischer Architektur zufällt, über-
rascht bei einigen Kirchen durch brillantere
Gewölbkonstruktionen, durch Stern- und Netz-
gewölbe, die selbst einen Anssug jener spielen-
den Maßwerk-Ornamentierung zeigen, wie sie
in üppigster Weise die englische Architektur
hervorgebracht hat.
Am klarsten legen wiederum die Fenster den
Charakter dieser Spätzeit, das Überwiegen des
willkürlich Spielenden über das Konstruktive
an den Tag. Phantastische Formen, wie die
Fischblase, treten auf und verdrängen die stren-
gen älteren Bildungen. Aber selbst die Ver-
bindung der Formen untereinander zu einer
Fensterbekrönung geschieht in wesentlich an-
derer Weise. Fügten früher die Teile wie durch
innere, von unten nach oben treibende Kraft
sich organisch zusammen, als klarer Ausdruck
des vertikalen Gesetzes, so legt man jetzt häufig
über die Bogen, in welchen die Pfosten sich
zusammenfügen, einen ssachen Stichbogen, der
das obere Feld zu einem gleichseitigen Bogen-
dreieck macht. In dieses konstruiert man das
Maßwerk, indem man die einzelnen Formen vom
Mittelpunkt des Dreiecks ausstrahlen läßt. So
klingt also der Ausgang gotischer Fensteranlage
wieder an die längst verlassene Konstruktions-
weise der Radfenster und Rosen an. Manches
brillante, geschmackvolle Fensterwerk schreibt
sich aus dieser Zeit.
Die schon früher besprochene verständige
Mäßigkeit in der westfälischen Architektur be-
wahrt dieselbe auch jetzt bis in die späteste
Zeit vor den Übertreibungen und Formlosigkeiten
anderer Gegenden. Bis zuletzt bleibt doch in
456