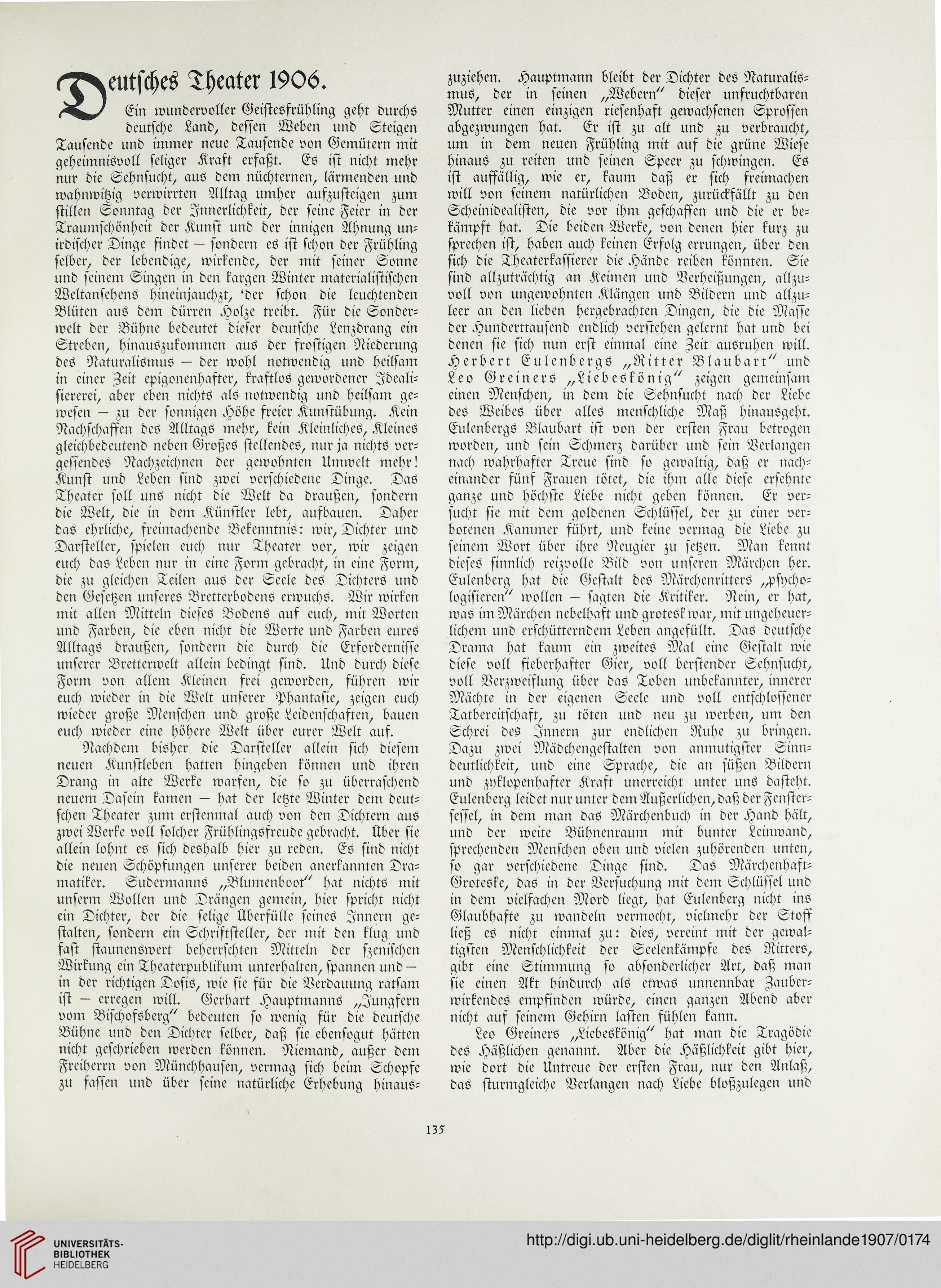eutsches Theater 1906.
Ein wundervoller Geistesfrühling geht durchs
deutsche Land, dessen Weben und Steigen
Tausende und immer neue Tausende von Gemütern mit
geheimnisvoll seliger Krast ersaßt. Es ist nicht mehr
nur die Sehnsucht, aus dem nüchternen, lärmenden und
wahnwitzig verwirrten Alltag umher aufzusteigen zum
stillen Sonntag der Jnnerlichkeit, der seine Feier in der
Traumschönheit der Kunst und der innigen Ahnung un-
irdischer Dinge findet — sondern es ift schon der Frühling
selber, der lebendige, wirkende, der mit seiner Sonne
und seinem Singen in den kargen Winter materialistischen
Weltansehens hineinjauchzt, 'der schon die leuchtenden
Blüten aus dem dürren Holze treibt. Für die Sonder-
welt der Bühne bedcutet dieser deutsche Lenzdrang ein
Streben, hinauszukommen aus der sroftigen Niederung
des NaturalismuS — der wohl notwendig und heilsam
in einer Aeit epigonenhafter, kraftlos gewordener Jdeali-
siererei, aber eben nichts als notwendig und heilsam ge-
wesen — zu der sonnigen Höhe sreier Kunstübung. Kein
Nachschaffen des Alltags mehr, kein Kleinliches, Kleines
gleichbedeutend neben Großes stellendes, nur ja nichts ver-
gestendes Nachzeichnen der gewohnten Umwclt mehr!
Kunst und Leben sind zwei verschiedene Dinge. Das
Theater soll uns nicht die Welt da draußen, sondern
die Welt, die in dem Künstler lebt, ausbauen. Daher
das ehrliche, sreimachende Bekenntnis: wir, Dichter und
Darsteller, spielen euch nur Theater vor, wir zeigen
euch das Lebcn nur in eine Form gebracht, in eine Form,
die zu gleichen Teilen aus der Seele des Dichters und
den Gesetzen unseres Bretterbodens erwuchö. Wir wirken
mit allen Mitteln dieses Bodens aus euch, mit Worten
und Farben, die eben nicht die Worte und Farben eures
Alltags draußen, sondern die durch die Erforderniste
unserer Bretterwelt allein bedingt sind. Und durch diese
Form von allem Kleinen srei geworden, führen wir
euch wieder in die Welt unserer Phantasie, zeigen euch
wieder große Menschen und große Leidenschaften, bauen
euch wieder eine höhere Welt über eurer Welt aus.
Nachdem bisher die Darfteller allein sich diesem
neuen Kunstleben hatten hingeben können und ihren
Drang in alte Werke warfen, die so zu überraschend
neuem Dasein kamen — hat der letzte Winter dem deut-
schen Theater zum erstenmal auch von den Dichtern aus
zwei Werke voll solcher Frühlingsfreude gebracht. Uber sie
allein lohnt es sich deshalb hier zu reden. Es sind nicht
die neuen Schöpfungen unserer beiden anerkannten Dra-
matiker. Sudermanns „Blumenboot" hat nichts mit
unserm Wollen und Drängen gemein, hier spricht nicht
ein Dichter, der die selige Überfülle seines Jnnern ge-
stalten, sondern ein Schriststeller, der mit den klug und
sast ftaunenswert beherrschten Mitteln der szenischen
Wirkung ein Theaterpublikum unterhalten, spannen und —
in der richtigen Dosis, wie sie sür die Verdauung ratsam
ist — erregen will. Gerhart Hauptmanns „Jungfern
vom Bischofsberg" bedeuten so wenig sür die deutsche
Bühne und den Dichter selber, daß sie ebensogut hätten
nicht geschrieben werden können. Niemand, außer dem
Freiherrn von Münchhausen, vermag sich beim Schopse
zu fasten und über seine natürliche Erhebung hinaus-
zuziehen. Hauptmann bleibt der Dichter des Naturalis-
mus, der in seinen „Webern" dieser unsruchtbaren
Mutter einen einzigen riesenhaft gewachsenen Sprossen
abgezwungen hat. Er ift zu alt und zu verbraucht,
um in dem neuen Frühling mit aus die grüne Wiese
hinaus zu reiten und seinen Speer zu schwingen. Es
ist auffällig, wie er, kaum daß er sich sreimachen
will von seinem natürlichen Boden, zurückfällt zu den
Scheinidealisten, die vor ihm geschasten und die er be-
kämpst hat. Die beiden Werke, von denen hier kurz zu
sprechen ist, haben auch keinen Erfolg errungen, über den
sich die Theaterkassierer die Hände reiben könnten. Sie
sind allzuträchtig an Keimen und Verheißungen, allzu-
voll von ungewohnten Klängen und Bildern und allzu-
leer an den lieben hergebrachten Dingen, die die Maste
der Hunderttausend endlich verstehen gelernt hat und bei
denen sie sich nun erst einmal eine Ieit ausruhen will.
Herbert Eulenbergs „Ritter Blaubart" und
Leo Greiners „Liebeskönig" zeigen gemeinsam
einen Menschen, in dem die Sehnsucht nach der Liebe
des Weibes über alles menschliche Maß hinausgeht.
Eulenbergs Blaubart ift von der ersten Frau betrogen
worden, und sein Schmerz darüber und sein Verlangen
nach wahrhafter Treue sind so gewaltig, daß er nach-
einander süns Frauen tötet, die ihm alle diese ersehnte
ganze und höchste Liebe nicht geben können. Er ver-
sucht sie mit dem goldenen Schlüstel, der zu einer ver-
botenen Kammer sührt, und keine vermag die Liebe zu
seinem Wort über ihre Neugier zu setzen. Man kennt
dieses sinnlich reizvolle Bild von unseren Märchen her.
Eulenberg hat die Gestalt des MärchenritterS ,gstycho-
logisiercn" wollen — sagten die Kritiker. Nein, er hat,
was im Märchen nebelhaft und grotesk war, mit ungeheuer-
lichem und erschütterndem Leben angesüllt. Das deutsche
Drama hat kaum ein zweites Mal eine Gestalt wie
diese voll fieberhafter Gier, voll berstender Sehnsucht,
voll Verzweislung über das Toben unbekannter, innerer
Mächte in der eigenen Seele und voll entschlossener
Tatbereitschaft, zu töten und neu zu werben, um den
Schrei des Jnnern zur endlichen Ruhe zu bringen.
Dazu zwei Mädchengestaltcn von anmutigster Sinn-
deutlichkeit, und eine Sprache, die an süßen Bildern
und zyklopenhaster Kraft unerreicht unter uns dasteht.
Eulenberg leidet nur unter dem Außerlichen, daß der Fenster-
sestel, in dem man das Märchenbuch in der Hand hält,
und der weite Bühnenraum mit bunter Leinwand,
sprechenden Mcnschen oben und vielen zuhörenden unten,
so gar verschiedene Dinge sind. Das Märchenhaft-
Groteske, daö in der Versuchung mit dem Schlüstel und
in dem vielfachen Mord liegt, hat Eulenberg nicht inö
Glaubhafte zu wandeln vermocht, vielmehr der Stoff
ließ es nicht einmal zu: dies, vereint mit der gewal-
tigften Menschlichkeit der Seelenkämpfe des Ritters,
gibt eine Stimmung so absonderlicher Art, daß man
sie einen Akt bindurch als etwas unnennbar Iauber-
wirkendes empfinden würde, einen ganzen Abend aber
nicht aus seinem Gehirn lasten sühlen kann.
Leo Greiners „Liebeskönig" hat man die Tragödie
des Häßlichen genannt. Aber die Häßlichkeit gibt hier,
wie dort die Üntreue der ersten Frau, nur den Anlaß,
das sturmgleiche Verlangen nach Liebe bloßzulegen und
Ein wundervoller Geistesfrühling geht durchs
deutsche Land, dessen Weben und Steigen
Tausende und immer neue Tausende von Gemütern mit
geheimnisvoll seliger Krast ersaßt. Es ist nicht mehr
nur die Sehnsucht, aus dem nüchternen, lärmenden und
wahnwitzig verwirrten Alltag umher aufzusteigen zum
stillen Sonntag der Jnnerlichkeit, der seine Feier in der
Traumschönheit der Kunst und der innigen Ahnung un-
irdischer Dinge findet — sondern es ift schon der Frühling
selber, der lebendige, wirkende, der mit seiner Sonne
und seinem Singen in den kargen Winter materialistischen
Weltansehens hineinjauchzt, 'der schon die leuchtenden
Blüten aus dem dürren Holze treibt. Für die Sonder-
welt der Bühne bedcutet dieser deutsche Lenzdrang ein
Streben, hinauszukommen aus der sroftigen Niederung
des NaturalismuS — der wohl notwendig und heilsam
in einer Aeit epigonenhafter, kraftlos gewordener Jdeali-
siererei, aber eben nichts als notwendig und heilsam ge-
wesen — zu der sonnigen Höhe sreier Kunstübung. Kein
Nachschaffen des Alltags mehr, kein Kleinliches, Kleines
gleichbedeutend neben Großes stellendes, nur ja nichts ver-
gestendes Nachzeichnen der gewohnten Umwclt mehr!
Kunst und Leben sind zwei verschiedene Dinge. Das
Theater soll uns nicht die Welt da draußen, sondern
die Welt, die in dem Künstler lebt, ausbauen. Daher
das ehrliche, sreimachende Bekenntnis: wir, Dichter und
Darsteller, spielen euch nur Theater vor, wir zeigen
euch das Lebcn nur in eine Form gebracht, in eine Form,
die zu gleichen Teilen aus der Seele des Dichters und
den Gesetzen unseres Bretterbodens erwuchö. Wir wirken
mit allen Mitteln dieses Bodens aus euch, mit Worten
und Farben, die eben nicht die Worte und Farben eures
Alltags draußen, sondern die durch die Erforderniste
unserer Bretterwelt allein bedingt sind. Und durch diese
Form von allem Kleinen srei geworden, führen wir
euch wieder in die Welt unserer Phantasie, zeigen euch
wieder große Menschen und große Leidenschaften, bauen
euch wieder eine höhere Welt über eurer Welt aus.
Nachdem bisher die Darfteller allein sich diesem
neuen Kunstleben hatten hingeben können und ihren
Drang in alte Werke warfen, die so zu überraschend
neuem Dasein kamen — hat der letzte Winter dem deut-
schen Theater zum erstenmal auch von den Dichtern aus
zwei Werke voll solcher Frühlingsfreude gebracht. Uber sie
allein lohnt es sich deshalb hier zu reden. Es sind nicht
die neuen Schöpfungen unserer beiden anerkannten Dra-
matiker. Sudermanns „Blumenboot" hat nichts mit
unserm Wollen und Drängen gemein, hier spricht nicht
ein Dichter, der die selige Überfülle seines Jnnern ge-
stalten, sondern ein Schriststeller, der mit den klug und
sast ftaunenswert beherrschten Mitteln der szenischen
Wirkung ein Theaterpublikum unterhalten, spannen und —
in der richtigen Dosis, wie sie sür die Verdauung ratsam
ist — erregen will. Gerhart Hauptmanns „Jungfern
vom Bischofsberg" bedeuten so wenig sür die deutsche
Bühne und den Dichter selber, daß sie ebensogut hätten
nicht geschrieben werden können. Niemand, außer dem
Freiherrn von Münchhausen, vermag sich beim Schopse
zu fasten und über seine natürliche Erhebung hinaus-
zuziehen. Hauptmann bleibt der Dichter des Naturalis-
mus, der in seinen „Webern" dieser unsruchtbaren
Mutter einen einzigen riesenhaft gewachsenen Sprossen
abgezwungen hat. Er ift zu alt und zu verbraucht,
um in dem neuen Frühling mit aus die grüne Wiese
hinaus zu reiten und seinen Speer zu schwingen. Es
ist auffällig, wie er, kaum daß er sich sreimachen
will von seinem natürlichen Boden, zurückfällt zu den
Scheinidealisten, die vor ihm geschasten und die er be-
kämpst hat. Die beiden Werke, von denen hier kurz zu
sprechen ist, haben auch keinen Erfolg errungen, über den
sich die Theaterkassierer die Hände reiben könnten. Sie
sind allzuträchtig an Keimen und Verheißungen, allzu-
voll von ungewohnten Klängen und Bildern und allzu-
leer an den lieben hergebrachten Dingen, die die Maste
der Hunderttausend endlich verstehen gelernt hat und bei
denen sie sich nun erst einmal eine Ieit ausruhen will.
Herbert Eulenbergs „Ritter Blaubart" und
Leo Greiners „Liebeskönig" zeigen gemeinsam
einen Menschen, in dem die Sehnsucht nach der Liebe
des Weibes über alles menschliche Maß hinausgeht.
Eulenbergs Blaubart ift von der ersten Frau betrogen
worden, und sein Schmerz darüber und sein Verlangen
nach wahrhafter Treue sind so gewaltig, daß er nach-
einander süns Frauen tötet, die ihm alle diese ersehnte
ganze und höchste Liebe nicht geben können. Er ver-
sucht sie mit dem goldenen Schlüstel, der zu einer ver-
botenen Kammer sührt, und keine vermag die Liebe zu
seinem Wort über ihre Neugier zu setzen. Man kennt
dieses sinnlich reizvolle Bild von unseren Märchen her.
Eulenberg hat die Gestalt des MärchenritterS ,gstycho-
logisiercn" wollen — sagten die Kritiker. Nein, er hat,
was im Märchen nebelhaft und grotesk war, mit ungeheuer-
lichem und erschütterndem Leben angesüllt. Das deutsche
Drama hat kaum ein zweites Mal eine Gestalt wie
diese voll fieberhafter Gier, voll berstender Sehnsucht,
voll Verzweislung über das Toben unbekannter, innerer
Mächte in der eigenen Seele und voll entschlossener
Tatbereitschaft, zu töten und neu zu werben, um den
Schrei des Jnnern zur endlichen Ruhe zu bringen.
Dazu zwei Mädchengestaltcn von anmutigster Sinn-
deutlichkeit, und eine Sprache, die an süßen Bildern
und zyklopenhaster Kraft unerreicht unter uns dasteht.
Eulenberg leidet nur unter dem Außerlichen, daß der Fenster-
sestel, in dem man das Märchenbuch in der Hand hält,
und der weite Bühnenraum mit bunter Leinwand,
sprechenden Mcnschen oben und vielen zuhörenden unten,
so gar verschiedene Dinge sind. Das Märchenhaft-
Groteske, daö in der Versuchung mit dem Schlüstel und
in dem vielfachen Mord liegt, hat Eulenberg nicht inö
Glaubhafte zu wandeln vermocht, vielmehr der Stoff
ließ es nicht einmal zu: dies, vereint mit der gewal-
tigften Menschlichkeit der Seelenkämpfe des Ritters,
gibt eine Stimmung so absonderlicher Art, daß man
sie einen Akt bindurch als etwas unnennbar Iauber-
wirkendes empfinden würde, einen ganzen Abend aber
nicht aus seinem Gehirn lasten sühlen kann.
Leo Greiners „Liebeskönig" hat man die Tragödie
des Häßlichen genannt. Aber die Häßlichkeit gibt hier,
wie dort die Üntreue der ersten Frau, nur den Anlaß,
das sturmgleiche Verlangen nach Liebe bloßzulegen und