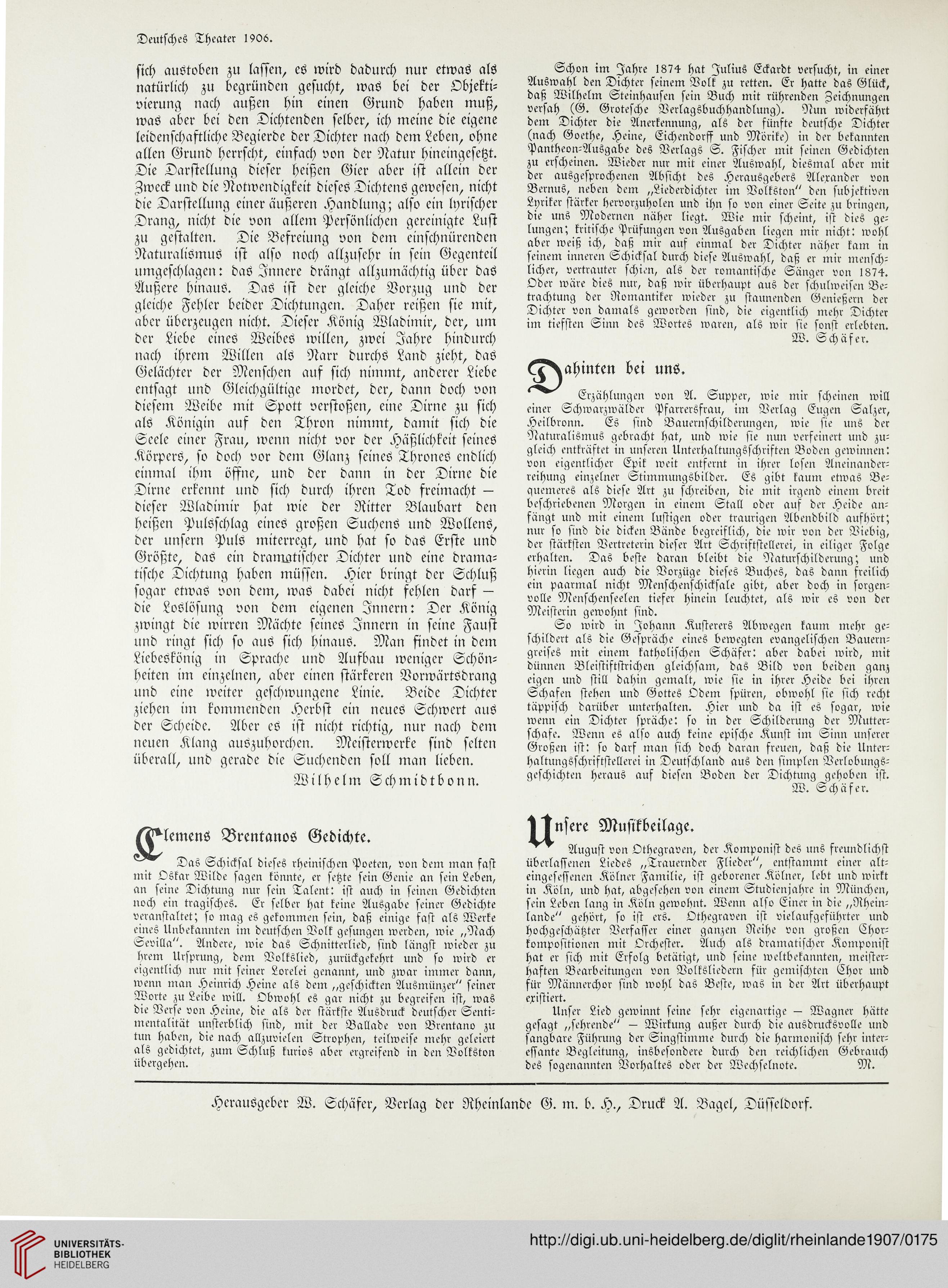Deutschcs Theater 1906.
sich austoben zu lassen, es wl'rd dadurch nur etwas als
natürlich zu begründen gesucht, was bei der Objekti-
vierung nach außen hin einen Grund haben muß,
was aber bei den Dichtenden selber, ich meine die eigene
leidenschaftliche Begierde der Dichter nach dem Leben, ohne
allen Grund herrscht, einfach von der Natur hineingesetzt.
Die Darstellung dieser heißen Gier aber ist allein der
Aweck und die Notwendigkeit dieses Dichtens gewesen, nicht
die Darstellung einer äußeren Handlung; also ein lyrischer
Drang, nicht die von allem Persönlichen gereüugte Lust
zu gestalten. Die Befreiung von dem einschnürenden
Naturalismus ist also noch allzusehr in sein Gegenteil
umgeschlagen: das Jnnere drängt allzumächtig über das
Außere hinaus. Das ist der gleiche Vorzug und der
glei'che Fehler beider Dichtungen. Daher reißen sie mit,
aber überzeugen nicht. Dieser König Wladünir, der, um
der Liebe eines Weibes willen, zwci Jahre hindurch
nach ihrem Willen als Narr durchö Land zieht, das
Gelächter der Menschen aus sich nimmt, anderer Liebe
entsagt und Gleichgültige mordet, der, dann doch von
diesem Weibe mit Spott verstoßen, eine Dirne zu sich
als Königin auf den Thron nimmt, damit sich die
Seele einer Frau, wenn nicht vor der Häßlichkeit seines
Körpers, so doch vor dem Glanz seines Thrones endlich
einmal ihm öffne, und der dann in der Dirne die
Dirne erkennt und sich durch ihren Tod sreimacht —
dicser Wladimir hat wie der Ritter Blaubart den
heißen Pulsschlag eines großen Suchenö und Wollens,
der unsern Puls miterregt, und hat so das Erste und
Größte, das ein dranratischer Dichter und eine drama-
tische Dichtung haben müssen. Hier bringt der Schluß
sogar etwas von dem, was dabei nicht fehlen darf —
die Loslösung von dem eigenen Jnnern: Der König
zwingt die wirren Mächte seines Jnnern in seine Faust
und ringt sich so aus sich hinaus. Man findet in dem
Liebeskönig in Sprache und Aufbau weniger Schön-
beiten im einzelnen, aber einen stärkeren Vorwärtsdrang
und eine wciter geschwungene Linie. Beide Dichter
ziehen im kommenden Herbst ein neueö Schwert aus
der Scheide. Aber es ist nicht richtig, nur nach dem
neuen Klang auszuhorchen. Meisterwerke sind selten
überall, und gerade die Suchenden soll man lieben.
Wilhelm S ch midtbo n n.
/D*ckemens BrentanoS Gedichte.
Das Schicksal dieses rheinischen Poeten, von dem man fast
mit Oskar Wilde sagen könnte, er sehte sein Genie an sein Leben,
an seine Dichtung nur sein Talent! ist auch in seinen Gedichten
noch ein tragisches. Er selber hat keine Ausgabe seiner Gedichte
veranstaltet; so mag es gekommen sein, daß einige fast als Werke
eines Unbekannten im deutschen Dolk gesungen werden, wie „Nach
Sevilla". Andere, wie das Schnitterlied, sind längst wieder zu
brem Ursprung, dem Volkslied, zurückgekehrt und so wird er
eigentlich nur mit seiner Lorelei genannt, und zwar immer dann,
wenn man Heinrich Heine als dem „geschickten Ausmünzer" seiner
Worte zu Leibe will. Obwohl es gar nicht zu begreifen ist, was
die Verse von Heine, die als der siärkste Ausdruck deutscher Senti-
mentalität unsterblich sind, mit der Ballade von Brentano zu
tun haben, die nach allzuvielen Strophen, teilweise mehr geleiert
als gedichtet, zum Schluß kurios aber ergreifend in den Volkston
übergehen.
Schon im Iahre 1874 hat Iulius Eckardt versucht, in einer
Auswahl den Dichter seinem Volk zu retten. Er hatte das Glück,
daß Wilhelm Steinhausen sein Buch mit rührenden Deichnungen
versah (G. Grotesche Verlagsbuchhandlung). Nun widerfährt
dem Dichter die Anerkennung, als der fünfte deutsche Dichter
(nach Goethe, Heine, Cichendorff und Mörike) in der bekannten
Pantheon-Ausgabe des Verlags S. Fischer mit seinen Gedichten
zu erscheinen. Wieder nur mit einer Auswahl, diesmal aber mit
der ausgesprochenen Absicht des Herausgebers Alepander von
Bernus, neben dem „Liederdichter im Volkston" den subjektiven
Lyriker stärker hervorzuholen und ihn so von einer Seite zu bringen,
die uns Modernen näher liegt. Wie mir scheint, ist dies ge-
lungen; kritische Prüfungen von Ausgaben liegen mir nicht: wohl
aber weiß ich, daß mir auf einmal der Dichter näher kam in
seinem inneren Schicksal durch diese Auswahl, daß er mir mensch-
licher, vertrauter schien, als der romantische Sänger von 1874.
Oder wäre dies nur, daß wir überhaupt aus der schulweisen Be-
trachtung der Nomantiker wieder zu staunenden Genießern der
Dichter von damals geworden sind, die eigentlich mehr Dichter
im tiefsten Sinn des Wortes waren, als wir sie sonst erlebten.
W. Schäfer.
D
ahinten bei unö.
Erzählungen von A. Supper, wie mir scheinen will
einer Schwarzwälder Pfarrersfrau, im Verlag Eugen Salzer,
Heilbronn. Es sind Bauernschilderungen, wie sie uns der
Naturalismus gebracht hat, und wie sie nun verfeinert und zu-
gleich entkräftet in unseren Unterhaltungsschriften Boden gewinnen:
von eigentlicher Epik weit entfernt in ihrer losen Aneinander-
reihung einzelner Stimmungsbilder. Es gibt kaum etwas Be-
guemeres als diese Art zu schreiben, die mit irgend einem breit
beschriebenen Morgen in einem Stall oder auf der Heide an-
fängt und mit einem lustigen oder traurigen Abendbild aufhört;
nur so sind die dicken Bände begreiflich, die wir von der Viebig,
der stärksten Vertreterin dieser Art Schriftstellerei, in eiliger Folge
erhalten. Das beste daran bleibt die Naturschilderung; und
hierin liegen auch die Dorzüge dieses Buches, das dann freilich
ein paarmal nicht Menschenschicksale gibt, aber doch in sorgen-
volle Menschenseelen tiefer hinein leuchtet, als wir es von der
Meisterin gewohnt sind.
So wird in Johann Kusterers Abwegen kaum mehr ge-
schildert als die Gespräche eines bewegten evangelischen Bauern-
greises mit einem katholischen Schäfer: aber dabei wird, mit
dünnen Bleistiftstrichen gleichsam, das Bild von beiden ganz
eigen und still dahin gemalt, wie sie in ihrer Heide bei ihren
Schafen stehen und Gottes Odem spüren, obwohl sie sich recht
täppisch darüber unterhalten. Hier und da ist es sogar, wie
wenn ein Dichter spräche! so in der Schilderung der Mutter-
schafe. Wenn es also auch keine epische Kunst im Sinn unserer
Großen ist: so darf man sich doch daran freuen, daß die Unter-
haltungsschriftstellerei in Deutschland aus den simplen Verlobungs-
geschichten heraus auf diesen Boden der Dichtung gehoben ist.
W. Schäfer.
1 ss nsere Musikbeilage.
August von Othegraven, der Komponist des uns freundlichst
überlassenen Liedes „Trauernder Flieder", entstammt einer alt-
eingeseffenen Kölncr Familie, ist geboremr Kölner, lebt und wirkt
in Köln, und hat, abgesehen von einem Studienjahre in München,
sein Leben lang in Köln gewohnt. Wenn also Ciner in die „Nhein-
lande" gehört, so ist ers. Othegraven ist vielaufgeführter und
hochgeschäHter Derfasser einer ganzen Neihe von großen Chor-
kompositionen mit Orchester. Auch als dramatischer Komponist
hat er sich mit Erfolg betätigt, und seine weltbekannten, meister-
haften Bearbeitungen von Volksliedern für gemischten Chor und
für Männerchor sind wohl das Beste, was in der Art überhaupt
existiert.
Unser Lied gewinnt seine sehr eigenartige — Wagner hätte
gesagt „sehrende" — Wirkung außer durch die ausdrucksvolle und
sangbare Führung der Singstimme durch die harmonisch sehr inter-
effante Begleitung, insbesondere durch den reichlichen Gebrauch
des sogenannten Vorhaltes oder der Wechselnote. M.
Herausgeber W. Schäfer, Verlag der Rheinlande G. m. b. H., Druck A. Bagel, Düsseldorf.
sich austoben zu lassen, es wl'rd dadurch nur etwas als
natürlich zu begründen gesucht, was bei der Objekti-
vierung nach außen hin einen Grund haben muß,
was aber bei den Dichtenden selber, ich meine die eigene
leidenschaftliche Begierde der Dichter nach dem Leben, ohne
allen Grund herrscht, einfach von der Natur hineingesetzt.
Die Darstellung dieser heißen Gier aber ist allein der
Aweck und die Notwendigkeit dieses Dichtens gewesen, nicht
die Darstellung einer äußeren Handlung; also ein lyrischer
Drang, nicht die von allem Persönlichen gereüugte Lust
zu gestalten. Die Befreiung von dem einschnürenden
Naturalismus ist also noch allzusehr in sein Gegenteil
umgeschlagen: das Jnnere drängt allzumächtig über das
Außere hinaus. Das ist der gleiche Vorzug und der
glei'che Fehler beider Dichtungen. Daher reißen sie mit,
aber überzeugen nicht. Dieser König Wladünir, der, um
der Liebe eines Weibes willen, zwci Jahre hindurch
nach ihrem Willen als Narr durchö Land zieht, das
Gelächter der Menschen aus sich nimmt, anderer Liebe
entsagt und Gleichgültige mordet, der, dann doch von
diesem Weibe mit Spott verstoßen, eine Dirne zu sich
als Königin auf den Thron nimmt, damit sich die
Seele einer Frau, wenn nicht vor der Häßlichkeit seines
Körpers, so doch vor dem Glanz seines Thrones endlich
einmal ihm öffne, und der dann in der Dirne die
Dirne erkennt und sich durch ihren Tod sreimacht —
dicser Wladimir hat wie der Ritter Blaubart den
heißen Pulsschlag eines großen Suchenö und Wollens,
der unsern Puls miterregt, und hat so das Erste und
Größte, das ein dranratischer Dichter und eine drama-
tische Dichtung haben müssen. Hier bringt der Schluß
sogar etwas von dem, was dabei nicht fehlen darf —
die Loslösung von dem eigenen Jnnern: Der König
zwingt die wirren Mächte seines Jnnern in seine Faust
und ringt sich so aus sich hinaus. Man findet in dem
Liebeskönig in Sprache und Aufbau weniger Schön-
beiten im einzelnen, aber einen stärkeren Vorwärtsdrang
und eine wciter geschwungene Linie. Beide Dichter
ziehen im kommenden Herbst ein neueö Schwert aus
der Scheide. Aber es ist nicht richtig, nur nach dem
neuen Klang auszuhorchen. Meisterwerke sind selten
überall, und gerade die Suchenden soll man lieben.
Wilhelm S ch midtbo n n.
/D*ckemens BrentanoS Gedichte.
Das Schicksal dieses rheinischen Poeten, von dem man fast
mit Oskar Wilde sagen könnte, er sehte sein Genie an sein Leben,
an seine Dichtung nur sein Talent! ist auch in seinen Gedichten
noch ein tragisches. Er selber hat keine Ausgabe seiner Gedichte
veranstaltet; so mag es gekommen sein, daß einige fast als Werke
eines Unbekannten im deutschen Dolk gesungen werden, wie „Nach
Sevilla". Andere, wie das Schnitterlied, sind längst wieder zu
brem Ursprung, dem Volkslied, zurückgekehrt und so wird er
eigentlich nur mit seiner Lorelei genannt, und zwar immer dann,
wenn man Heinrich Heine als dem „geschickten Ausmünzer" seiner
Worte zu Leibe will. Obwohl es gar nicht zu begreifen ist, was
die Verse von Heine, die als der siärkste Ausdruck deutscher Senti-
mentalität unsterblich sind, mit der Ballade von Brentano zu
tun haben, die nach allzuvielen Strophen, teilweise mehr geleiert
als gedichtet, zum Schluß kurios aber ergreifend in den Volkston
übergehen.
Schon im Iahre 1874 hat Iulius Eckardt versucht, in einer
Auswahl den Dichter seinem Volk zu retten. Er hatte das Glück,
daß Wilhelm Steinhausen sein Buch mit rührenden Deichnungen
versah (G. Grotesche Verlagsbuchhandlung). Nun widerfährt
dem Dichter die Anerkennung, als der fünfte deutsche Dichter
(nach Goethe, Heine, Cichendorff und Mörike) in der bekannten
Pantheon-Ausgabe des Verlags S. Fischer mit seinen Gedichten
zu erscheinen. Wieder nur mit einer Auswahl, diesmal aber mit
der ausgesprochenen Absicht des Herausgebers Alepander von
Bernus, neben dem „Liederdichter im Volkston" den subjektiven
Lyriker stärker hervorzuholen und ihn so von einer Seite zu bringen,
die uns Modernen näher liegt. Wie mir scheint, ist dies ge-
lungen; kritische Prüfungen von Ausgaben liegen mir nicht: wohl
aber weiß ich, daß mir auf einmal der Dichter näher kam in
seinem inneren Schicksal durch diese Auswahl, daß er mir mensch-
licher, vertrauter schien, als der romantische Sänger von 1874.
Oder wäre dies nur, daß wir überhaupt aus der schulweisen Be-
trachtung der Nomantiker wieder zu staunenden Genießern der
Dichter von damals geworden sind, die eigentlich mehr Dichter
im tiefsten Sinn des Wortes waren, als wir sie sonst erlebten.
W. Schäfer.
D
ahinten bei unö.
Erzählungen von A. Supper, wie mir scheinen will
einer Schwarzwälder Pfarrersfrau, im Verlag Eugen Salzer,
Heilbronn. Es sind Bauernschilderungen, wie sie uns der
Naturalismus gebracht hat, und wie sie nun verfeinert und zu-
gleich entkräftet in unseren Unterhaltungsschriften Boden gewinnen:
von eigentlicher Epik weit entfernt in ihrer losen Aneinander-
reihung einzelner Stimmungsbilder. Es gibt kaum etwas Be-
guemeres als diese Art zu schreiben, die mit irgend einem breit
beschriebenen Morgen in einem Stall oder auf der Heide an-
fängt und mit einem lustigen oder traurigen Abendbild aufhört;
nur so sind die dicken Bände begreiflich, die wir von der Viebig,
der stärksten Vertreterin dieser Art Schriftstellerei, in eiliger Folge
erhalten. Das beste daran bleibt die Naturschilderung; und
hierin liegen auch die Dorzüge dieses Buches, das dann freilich
ein paarmal nicht Menschenschicksale gibt, aber doch in sorgen-
volle Menschenseelen tiefer hinein leuchtet, als wir es von der
Meisterin gewohnt sind.
So wird in Johann Kusterers Abwegen kaum mehr ge-
schildert als die Gespräche eines bewegten evangelischen Bauern-
greises mit einem katholischen Schäfer: aber dabei wird, mit
dünnen Bleistiftstrichen gleichsam, das Bild von beiden ganz
eigen und still dahin gemalt, wie sie in ihrer Heide bei ihren
Schafen stehen und Gottes Odem spüren, obwohl sie sich recht
täppisch darüber unterhalten. Hier und da ist es sogar, wie
wenn ein Dichter spräche! so in der Schilderung der Mutter-
schafe. Wenn es also auch keine epische Kunst im Sinn unserer
Großen ist: so darf man sich doch daran freuen, daß die Unter-
haltungsschriftstellerei in Deutschland aus den simplen Verlobungs-
geschichten heraus auf diesen Boden der Dichtung gehoben ist.
W. Schäfer.
1 ss nsere Musikbeilage.
August von Othegraven, der Komponist des uns freundlichst
überlassenen Liedes „Trauernder Flieder", entstammt einer alt-
eingeseffenen Kölncr Familie, ist geboremr Kölner, lebt und wirkt
in Köln, und hat, abgesehen von einem Studienjahre in München,
sein Leben lang in Köln gewohnt. Wenn also Ciner in die „Nhein-
lande" gehört, so ist ers. Othegraven ist vielaufgeführter und
hochgeschäHter Derfasser einer ganzen Neihe von großen Chor-
kompositionen mit Orchester. Auch als dramatischer Komponist
hat er sich mit Erfolg betätigt, und seine weltbekannten, meister-
haften Bearbeitungen von Volksliedern für gemischten Chor und
für Männerchor sind wohl das Beste, was in der Art überhaupt
existiert.
Unser Lied gewinnt seine sehr eigenartige — Wagner hätte
gesagt „sehrende" — Wirkung außer durch die ausdrucksvolle und
sangbare Führung der Singstimme durch die harmonisch sehr inter-
effante Begleitung, insbesondere durch den reichlichen Gebrauch
des sogenannten Vorhaltes oder der Wechselnote. M.
Herausgeber W. Schäfer, Verlag der Rheinlande G. m. b. H., Druck A. Bagel, Düsseldorf.