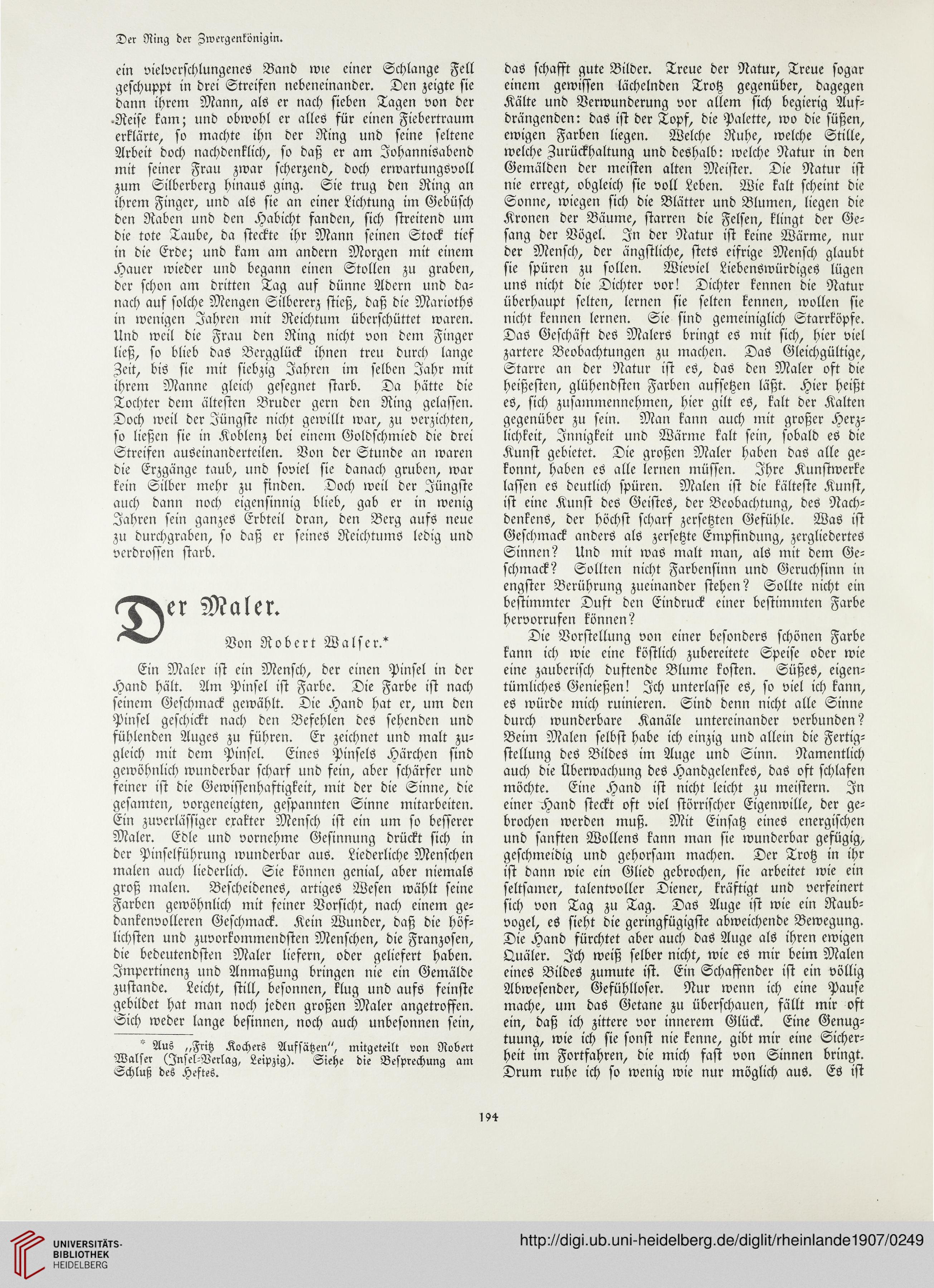Der Ning der Zwergenkönigin.
em vielverschlungenes Band wle einer Schlange Fell
geschuppr in drei Streisen nebeneinander. Den zeigte sie
dann ihrem Mann, als er nach sieben Tagen von der
-Reise kam; und obwohl er alles für einen Fiebertraum
erklärte, so machte ihn der Ring und seine seltene
Arbeit doch nachdenklich, so daß er am Johannisabend
mit seiner Frau zwar scherzend, doch erwartungövoll
zum Silberberg hinaus ging. Sie trug den Ring an
ihrem Finger, und als sie an einer Lichtung im Gebüsch
den Raben und den Habicht sanden, sich streitend um
die tote Taube, da steckte ihr Mann seinen Stock tief
in die Erde; und kam am andern Morgen mit einem
Hauer wieder und begann einen Stollen zu graben,
der schon am dritten Tag aus dünne Adern und da-
nach auf solche Mengen Silbererz stieß, daß die Marioths
in wenigen Jahren mit Reichtum überschüttet waren.
Und weil die Frau den Ring nicht von dem Finger
ließ, so blieb das Bergglück ihnen treu durch lange
Zeit, bis sie mit siebzig Iahren im selben Jahr mit
ihrem Manne gleich gesegnet starb. Da hätte die
Tochter dem ältesten Bruder gern den Ring gelassen.
Doch weil der Iüngste nicht gewillt war, zu verzichten,
so ließen sie in Koblenz bei einem Goldschmied die drei
Streifen auseinanderteilen. Von der Stunde an waren
die Erzgänge taub, und soviel sie danach gruben, war
kein Silber mehr zu finden. Doch weil der Iüngste
auch dann noch eigensinnig blieb, gab er in wenig
Iahren sein ganzes Erbteil dran, den Berg auss neue
zu durchgraben, so daß er seines Reichtumö ledig und
verdrossen starb.
er Maler.
Von Robert Wa
lser.*
Ein Maler ist ein Mensch, der einen Pinsel in der
Hand hält. Am Pinsel ist Farbe. Die Farbe ist nach
seinem Geschmack gewählt. Die Hand hat er, um den
Pinsel geschickt nach den Befehlen des sehenden und
ftihlenden Auges zu sühren. Er zeichnet und malt zu-
gleich mit dem Pinsel. Eines Pinsels Härchen sind
gewöhnlich wunderbar scharf und sein, aber schärfer und
feiner ist die Gewissenhaftigkeit, mit der die Sinne, die
gesamten, vorgeneigten, gespannten Sinne mitarbeiten.
Ein zuverlässiger exakter Mensch ist ein um so besserer
Maler. Edle und vornehme Gesinnung drückt sich in
der Pinselführung wunderbar aus. Liederliche Menschen
malen auch liederlich. Sie können genial, aber niemals
groß malen. Bescheideneö, artiges Wesen wählt seine
Farben gewöhnlich mit feiner Vorsicht, nach einem ge-
dankenvolleren Geschmack. Kein Wunder, daß die höf-
lichsten und zuvorkommendften Menschen, die Franzosen,
die bedeutendsten Maler liefern, oder geliefert haben.
Impertinenz und Anmaßung bringen nie ein Gemälde
zustande. Leicht, still, besonnen, klug und aufs feinste
gebildet hat man noch jeden großen Maler angetroffen.
Sich weder lange besinnen, noch auch unbesonnen sein,
Aus ,,Fritz Kochers Aufsätzen", mitgeteilt von Nobert
Walser (Insel-Verlag, Leipzig). Siehe die Besprechung arn
Schluß des Heftes.
daS schafft gute Bilder. Treue der Natur, Treue sogar
einem gewissen lächelnden Trotz gegenüber, dagegen
Kälte und Verwunderung vor allem sich begierig Auf-
drängenden: das ist der Topf, die Palette, wo die süßen,
ewigen Farben liegen. Welche Ruhe, welche Stille,
welche Iurückhaltung und deshalb: welche Natur in den
Gemälden der meisten alten Meister. Die Natur ift
nie erregt, obgleich sie voll Leben. Wie kalt scheint die
Sonne, wiegen sich die Blätter und Blumen, liegen die
Kronen der Bäume, starren die Felsen, klingt der Ge-
sang der Vögel. Jn der Natur ift keine Wärme, nur
der Mensch, der ängstliche, stets eifrige Mensch glaubt
sie spüren zu sollen. Wieviel Liebenswürdiges lügen
uns nicht die Dichter vor! Dichter kennen die Natur
überhaupt selten, lernen sie selten kennen, wollen sie
nicht kennen lernen. Sie sind gemeiniglich Starrköpfe.
Das Geschäft des Malers bringt es mit sich, hier viel
zartere Beobachtungen zu machen. Das Gleichgültige,
Starre an der Natur ist es, das den Maler oft die
heißesten, glühendsten Farben aufsetzen läßt. Hier heißt
es, sich zusammennehmen, hier gilt es, kalt der Kalten
gegenüber zu sein. Man kann auch mit großer Herz-
lichkeit, Innigkeit und Wärme kalt sein, sobald es die
Kunst gebietet. Die großen Maler haben das alle ge-
konnt, haben es alle lernen müssen. Ihre Kunstwerke
lassen es deutlich spüren. Malen ist die kältefte Kunst,
ist eine Kunft des Geiftes, der Beobachtung, deö Nach-
denkens, der höchst scharf zersetzten Gefühle. Was ist
Geschmack anders als zersetzte Empfindung, zergliedertes
Sinnen? Und mit was malt man, als mit dem Ge-
schmack? Sollten nicht Farbensinn und Geruchfinn in
engster Berührung zueinander stehen? Sollte nicht ein
bestimmter Duft den Eindruck einer bestimmten Farbe
hervorrufen können?
Die Vorstellung von einer besonders schönen Farbe
kann ich wie eine köstlich zubereitete Speise oder wie
eine zauberisch duftende Blume kosten. Süßes, eigen-
tümliches Genießen! Ich unterlasse es, so viel ich kann,
es würde mich ruinieren. Sind denn nicht alle Sinne
durch wunderbare Kanäle untereinander verbunden?
Beim Malen selbst habe ich einzig und allein die Fertig-
ftellung des Bildes im Auge und Sinn. Namentlich
auch die Überwachung des Handgelenkes, das oft schlafen
möchte. Eine Hand ist nicht leicht zu meiftern. Jn
einer Hand steckt oft viel störrischer Eigenwille, der ge-
brochen werden muß. Mit Einsatz eines energischen
und sanften Wollens kann man sie wunderbar gefügig,
geschmeidig und gehorsam machen. Der Trotz in ihr
ist dann wie ein Glied gebrochen, sie arbeitet wie ein
seltsamer, talentvoller Diener, kräftigt und verfeinert
sich von Tag zu Tag. Das Auge ift wie ein Raub-
vogel, es sieht die geringfügigste abweichende Bewegung.
Die Hand fürchtet aber auch das Auge als ihren ewigen
Quäler. Ich weiß selber nicht, wie es mir beim Malen
eines Bildes zumute ist. Ein Schaffender ist ein völlig
Abwesender, Gefühlloser. Nur wenn ich eine Pause
mache, um das Getane zu überschauen, fällt mir oft
ein, daß ich zittere vor innerem Glück. Eine Genug-
tuung, wie ich sie sonst nie kenne, gibt mir eine Sicher-
heit im Fortfahren, die mich fast von Sinnen bringt.
Drum ruhe ich so wenig wie nur möglich aus. Es ist
194
em vielverschlungenes Band wle einer Schlange Fell
geschuppr in drei Streisen nebeneinander. Den zeigte sie
dann ihrem Mann, als er nach sieben Tagen von der
-Reise kam; und obwohl er alles für einen Fiebertraum
erklärte, so machte ihn der Ring und seine seltene
Arbeit doch nachdenklich, so daß er am Johannisabend
mit seiner Frau zwar scherzend, doch erwartungövoll
zum Silberberg hinaus ging. Sie trug den Ring an
ihrem Finger, und als sie an einer Lichtung im Gebüsch
den Raben und den Habicht sanden, sich streitend um
die tote Taube, da steckte ihr Mann seinen Stock tief
in die Erde; und kam am andern Morgen mit einem
Hauer wieder und begann einen Stollen zu graben,
der schon am dritten Tag aus dünne Adern und da-
nach auf solche Mengen Silbererz stieß, daß die Marioths
in wenigen Jahren mit Reichtum überschüttet waren.
Und weil die Frau den Ring nicht von dem Finger
ließ, so blieb das Bergglück ihnen treu durch lange
Zeit, bis sie mit siebzig Iahren im selben Jahr mit
ihrem Manne gleich gesegnet starb. Da hätte die
Tochter dem ältesten Bruder gern den Ring gelassen.
Doch weil der Iüngste nicht gewillt war, zu verzichten,
so ließen sie in Koblenz bei einem Goldschmied die drei
Streifen auseinanderteilen. Von der Stunde an waren
die Erzgänge taub, und soviel sie danach gruben, war
kein Silber mehr zu finden. Doch weil der Iüngste
auch dann noch eigensinnig blieb, gab er in wenig
Iahren sein ganzes Erbteil dran, den Berg auss neue
zu durchgraben, so daß er seines Reichtumö ledig und
verdrossen starb.
er Maler.
Von Robert Wa
lser.*
Ein Maler ist ein Mensch, der einen Pinsel in der
Hand hält. Am Pinsel ist Farbe. Die Farbe ist nach
seinem Geschmack gewählt. Die Hand hat er, um den
Pinsel geschickt nach den Befehlen des sehenden und
ftihlenden Auges zu sühren. Er zeichnet und malt zu-
gleich mit dem Pinsel. Eines Pinsels Härchen sind
gewöhnlich wunderbar scharf und sein, aber schärfer und
feiner ist die Gewissenhaftigkeit, mit der die Sinne, die
gesamten, vorgeneigten, gespannten Sinne mitarbeiten.
Ein zuverlässiger exakter Mensch ist ein um so besserer
Maler. Edle und vornehme Gesinnung drückt sich in
der Pinselführung wunderbar aus. Liederliche Menschen
malen auch liederlich. Sie können genial, aber niemals
groß malen. Bescheideneö, artiges Wesen wählt seine
Farben gewöhnlich mit feiner Vorsicht, nach einem ge-
dankenvolleren Geschmack. Kein Wunder, daß die höf-
lichsten und zuvorkommendften Menschen, die Franzosen,
die bedeutendsten Maler liefern, oder geliefert haben.
Impertinenz und Anmaßung bringen nie ein Gemälde
zustande. Leicht, still, besonnen, klug und aufs feinste
gebildet hat man noch jeden großen Maler angetroffen.
Sich weder lange besinnen, noch auch unbesonnen sein,
Aus ,,Fritz Kochers Aufsätzen", mitgeteilt von Nobert
Walser (Insel-Verlag, Leipzig). Siehe die Besprechung arn
Schluß des Heftes.
daS schafft gute Bilder. Treue der Natur, Treue sogar
einem gewissen lächelnden Trotz gegenüber, dagegen
Kälte und Verwunderung vor allem sich begierig Auf-
drängenden: das ist der Topf, die Palette, wo die süßen,
ewigen Farben liegen. Welche Ruhe, welche Stille,
welche Iurückhaltung und deshalb: welche Natur in den
Gemälden der meisten alten Meister. Die Natur ift
nie erregt, obgleich sie voll Leben. Wie kalt scheint die
Sonne, wiegen sich die Blätter und Blumen, liegen die
Kronen der Bäume, starren die Felsen, klingt der Ge-
sang der Vögel. Jn der Natur ift keine Wärme, nur
der Mensch, der ängstliche, stets eifrige Mensch glaubt
sie spüren zu sollen. Wieviel Liebenswürdiges lügen
uns nicht die Dichter vor! Dichter kennen die Natur
überhaupt selten, lernen sie selten kennen, wollen sie
nicht kennen lernen. Sie sind gemeiniglich Starrköpfe.
Das Geschäft des Malers bringt es mit sich, hier viel
zartere Beobachtungen zu machen. Das Gleichgültige,
Starre an der Natur ist es, das den Maler oft die
heißesten, glühendsten Farben aufsetzen läßt. Hier heißt
es, sich zusammennehmen, hier gilt es, kalt der Kalten
gegenüber zu sein. Man kann auch mit großer Herz-
lichkeit, Innigkeit und Wärme kalt sein, sobald es die
Kunst gebietet. Die großen Maler haben das alle ge-
konnt, haben es alle lernen müssen. Ihre Kunstwerke
lassen es deutlich spüren. Malen ist die kältefte Kunst,
ist eine Kunft des Geiftes, der Beobachtung, deö Nach-
denkens, der höchst scharf zersetzten Gefühle. Was ist
Geschmack anders als zersetzte Empfindung, zergliedertes
Sinnen? Und mit was malt man, als mit dem Ge-
schmack? Sollten nicht Farbensinn und Geruchfinn in
engster Berührung zueinander stehen? Sollte nicht ein
bestimmter Duft den Eindruck einer bestimmten Farbe
hervorrufen können?
Die Vorstellung von einer besonders schönen Farbe
kann ich wie eine köstlich zubereitete Speise oder wie
eine zauberisch duftende Blume kosten. Süßes, eigen-
tümliches Genießen! Ich unterlasse es, so viel ich kann,
es würde mich ruinieren. Sind denn nicht alle Sinne
durch wunderbare Kanäle untereinander verbunden?
Beim Malen selbst habe ich einzig und allein die Fertig-
ftellung des Bildes im Auge und Sinn. Namentlich
auch die Überwachung des Handgelenkes, das oft schlafen
möchte. Eine Hand ist nicht leicht zu meiftern. Jn
einer Hand steckt oft viel störrischer Eigenwille, der ge-
brochen werden muß. Mit Einsatz eines energischen
und sanften Wollens kann man sie wunderbar gefügig,
geschmeidig und gehorsam machen. Der Trotz in ihr
ist dann wie ein Glied gebrochen, sie arbeitet wie ein
seltsamer, talentvoller Diener, kräftigt und verfeinert
sich von Tag zu Tag. Das Auge ift wie ein Raub-
vogel, es sieht die geringfügigste abweichende Bewegung.
Die Hand fürchtet aber auch das Auge als ihren ewigen
Quäler. Ich weiß selber nicht, wie es mir beim Malen
eines Bildes zumute ist. Ein Schaffender ist ein völlig
Abwesender, Gefühlloser. Nur wenn ich eine Pause
mache, um das Getane zu überschauen, fällt mir oft
ein, daß ich zittere vor innerem Glück. Eine Genug-
tuung, wie ich sie sonst nie kenne, gibt mir eine Sicher-
heit im Fortfahren, die mich fast von Sinnen bringt.
Drum ruhe ich so wenig wie nur möglich aus. Es ist
194