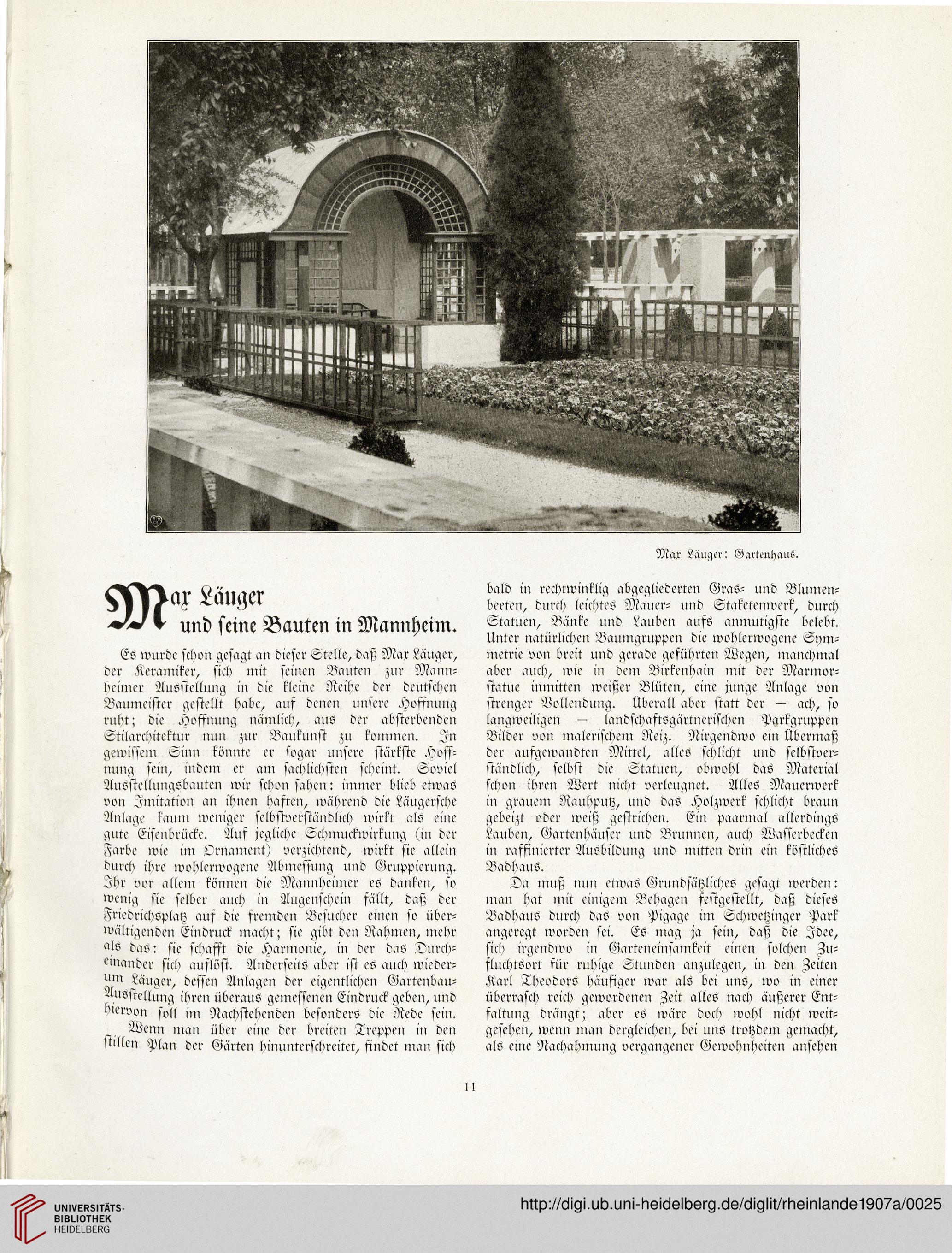Max Länger: Gartenhaus.
ar Länger
und seine Bauten in Mannheim.
Es wurde schon gesagt an dieser Stelle, daß Mar Länger,
der Keramiker, sich mit seinen Bauten zur Mann-
heimer Ausstellung in die kleine Reihe der deutschen
Baumeister gestellt habe, aus denen unsere Hoffnung
ruht; die Hoffnung nämlich, aus der absterbenden
Stilarchitcktur nun zur Baukunst zu kommen. In
gewissem Sinn könnte er sogar unsere stärkste Hoff-
nung sein, indem er am sachlichsten scheint. Soviel
Auöstellungsbauten wir schon sahen: immer blieb etwas
von Imitation an ihnen haften, während die Läugersche
Anlage kaum weniger selbstverständlich wirkt als eine
gute Eiscnbrüeke. Aus jegliche Schmuckwirkung (in der
Farbe wie im Ornament) verzichtend, wirkt sic allein
durch ihre wohlerwogene Abmessung und Gruppierung.
Ihr vor allem können die Mannheimer cs danken, so
wenig sie selber auch in Augenschein fällt, daß der
Friedrichsplatz auf die fremden Besucher einen so über-
wältigenden Eindruck macht; sic gibt den Rahmen, mcbr
als das: sie schafft die Harmonie, in der das Durch-
einander sich auflöst. Anderseits aber ist cs auch wieder-
um Läugcr, dessen Anlagen der eigentlichen Gartcnbau-
Ausstellung ihren überaus gemessenen Eindruck geben, und
lucrvon soll im Nachstehenden besonders die Rede sein.
Wenn man über eilte der breiten Treppen in den
stillen Plan der Gärten hinunterschrcitet, findet man sich
bald in rechtwinklig abgegliedcrten Gras- und Blumen-
beeten, durch leichtes Mauer- und Staketenwcrk, durch
Statuen, Bänke und Lauben aufs anmutigste belebt.
Unter natürlichen Baumgruppcn die wohlerwogene Sym-
metrie von breit und gerade geführten Wegen, manchmal
aber auch, wie in dein Birkenhain mit der Marmor-
statue inmitten weißer Blüten, eine junge Anlage von
strenger Vollendung. Überall aber statt der — ach, so
langweiligen — landschaftsgärtnerischen Parkgruppen
Bilder von malerischem Reiz. Nirgendwo ein Übermaß
der aufgewandtcn Mittel, alles schlicht und selbstver-
ständlich, selbst die Statuen, obwohl das Material
schon ihren Wert nicht verleugnet. Alles Mauerwerk
in grauem Raubputz, und daö Holzwcrk schlicht braun
gebeizt oder weiß gestrichen. Ein paarmal allerdings
Lauben, Gartenhäuser uud Brunnen, auch Wasserbecken
in raffinierter Ausbildung und mitten drin ein köstliches
BadhauS.
Da muß nun etwas Grundsätzliches gesagt werden:
man hat mit einigen: Behagen sestgestcllt, daß dieses
Badhaus durch daS von Pigage im Schwetzinger Park
angeregt worden sei. Es mag ja sein, daß die Idee,
sich irgendwo in Garteneinsamkeit einen solchen Zu-
fluchtsort für ruhige Stunden anzulcgen, in den Zeiten
Karl Theodors häufiger war als bei uns, wo in einer
überrasch reich gewordenen Zeit alles nach äußerer Ent-
faltung drängt; aber es wäre doch wohl nicht weit-
gesehen, wenn inan dergleichen, bei uns trotzdem gemacht,
als eine Nachahmung vergangener Gewohnheiten ansehen
n